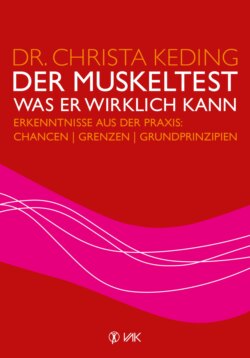Читать книгу Der Muskeltest - Was er wirklich kann - Dr. Christa Keding - Страница 21
Reicht Empirie aus?
ОглавлениеKinesiologie hat sich im Wesentlichen aus Erfahrungen und Ideen dazu entwickelt; sie wurde, wie bei Heilverfahren üblich, nicht als Theorie auf dem Reißbrett entworfen und erfunden, sondern entdeckt. Deshalb ist sie zunächst auf eine Sammlung von Beobachtungsdaten angewiesen, im Sinne der Frage: „Was passiert, wenn …?“.
Logischerweise können in den seltensten Fällen aus einem Einzelfall allgemeine Rückschlüsse gezogen werden, zumal gerade Heilung vielen komplexen Einwirkungen unterliegt, nicht zuletzt auch suggestiven. Das heißt aber, es müssen sehr viele Fälle verfolgt und dokumentiert werden, auch langfristig, wenn man beurteilen will, wo die Kinesiologie Wirkung gezeigt hat. Die erste Aufgabe heißt also Dokumentation und Langzeitbeobachtung.
Davon hat die Kinesiologie schon einiges zu bieten. Doch ihren Kritikern reicht das offenbar nicht, um das gewissermaßen revolutionäre Potenzial des Muskeltests anzuerkennen. Und auch mir reicht es nicht. Denn empirische Belege allein sind zwar notwendig, aber sie stehen verloren im Raum, solange die Resultate der Methode nicht durch Beweise oder zumindest Hypothesen in einen stimmigen Bezug gesetzt werden können. Ohne die Vorstellung, wie die Erfolge der Kinesiologie erklärt werden können, fehlen orientierende Anhaltspunkte für die Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit der Methode. Reine Empirie ist reine Statistik – und damit ließe sich beispielsweise sogar „beweisen“, dass der Rückgang der Geburtenrate in Deutschland auf die Verdrängung der Störche zurückzuführen ist, da sich beides ziemlich zeitgleich abspielt …
Was eine Methode also ebenfalls braucht, um zu überzeugen, sind Erklärungsmodelle, mit deren Hilfe man sich die inneren Zusammenhänge vorstellen kann. Bei dem Beispiel mit den Störchen könnte als Erklärungsmodell angenommen werden, dass sie tatsächlich die Babys bringen. Oder, wenn wir eine Ebene höher ansetzen würden, kämen wir vielleicht auf den gemeinsamen Nenner, dass sich in unserer denaturierten Umwelt die Störche nicht mehr wohlfühlen und die Menschen keine Lust mehr auf Nachwuchs haben.
Erklärungsmodelle helfen den Anwendern, ihre Erfahrungswerte abzugleichen und damit einerseits die Hypothesen zu überprüfen und zu korrigieren, andererseits die eigenen Ergebnisse besser nachvollziehen und entsprechende Erfahrungen weitergeben zu können. Denn nicht nur die Kritiker, auch wir als anwendende Therapeuten schauen vor allem auf die „Therapieversager“, die uns die Nachtruhe kosten. Erst mit geeigneten Denkmodellen lernen wir verstehen, was möglicherweise falsch gelaufen ist, und wir erkennen, worauf es wirklich ankommt. Dabei sind diejenigen Erklärungsmodelle am tauglichsten, aus denen sich innerhalb einer Grundhypothese alle auftauchenden Phänomene der Methode herleiten lassen.
Der nächste Schritt muss demnach nicht nur zu der Überlegung führen, wie es funktioniert (im Sinne einer Gebrauchsanweisung), sondern warum es funktioniert, das heißt, welche Steuerungsprinzipien dahinterliegen. Wir müssen verstehen, wenn wir sinnvoll handeln wollen – das wird in diesem Buch noch öfter Thema sein.
Solange Erfahrungen nur beschreibend und ohne Verständnis tieferer Bezüge weitergegeben werden, wird sich bei der Verbreitung einer Methode der „Stille-Post-Effekt“ einschleichen: Am Ende kommt nur unverständliches Kauderwelsch heraus. Oder es werden Hypothesen konstruiert, die letztlich gar nichts mehr mit der Sache zu tun haben. Das kann sich die Kinesiologie, wenn sie als ernst zu nehmende Methode Fuß fassen will, meiner Ansicht nach nicht leisten. Und sie hat es auch nicht nötig.
Eine der Schwachstellen der Kinesiologie, die die Kritiker zum Nachbohren veranlasst, sehe ich genau darin, dass sie sehr viele positive Erfahrungswerte aufweist, aber kein einheitliches Denkmodell. Was natürlich bei einer derart komplexen Methode kein Wunder ist, denn jeder Anwender wird zunächst seinen Teilbereich vertreten und zu erklären versuchen. Folglich „zersplittern“ Theorien im Großen und im Kleinen die Methode, gerade in den Randbereichen der Weiterentwicklung; die Bandbreite ihrer Erklärungen erstreckt sich von neurophysiologischen Messungen und Erkenntnissen der Gehirnforschung über mystische Deutungen bis hin zu esoterischen Konstrukten, die von seriösen Vertretern der Kinesiologie mit „Bauchschmerzen“ registriert werden.
Die Krux der Kinesiologie ist, dass sie einerseits noch so jung, andererseits enorm potent ist. Wir als Anwender und Lehrende sitzen in der Klemme, da wir dieses Potenzial zu einer Zeit entdeckt haben und weitervermitteln, in der die „Beweisführung“ noch zu wünschen übrig lässt. Eine entscheidende Frage ist deshalb, wie wir trotzdem zur Anerkennung beitragen können.
Hier ist und bleibt mein Schlüsselwort Glaubwürdigkeit. Diese Glaubwürdigkeit basiert allerdings nicht ausschließlich auf wissenschaftlichen Beweisen.