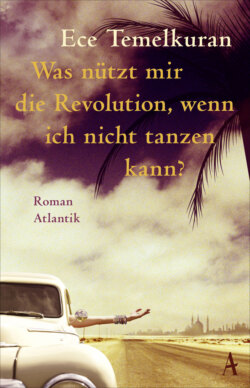Читать книгу Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann - Ece Temelkuran - Страница 6
1. Kapitel
ОглавлениеEigentlich hatte ich mir vorgenommen zu schlafen. Doch dann hörte ich das Schlurfen von Pantoffeln auf den steinernen Hoteltreppen. Ich hörte, wie nackte Füße an Lederpantoffeln kleben blieben und sich mit einem Schmatzen wieder lösten. Und das trotz der Hochzeit, die ganz in der Nähe lautstark gefeiert wurde. Über spitze Freudenschreie und Feuerwerksraketen hinweg. Eine Frau. Leicht und jung. Dann ging noch eine Frau die Treppe hinauf. Ich hörte, wie klein ihre Füße waren. Ich hörte, dass beide Nachthemden trugen, hörte das Rascheln von Stoff: dünne Baumwolle. Ich hörte die Größe ihrer Nachthemden, hörte sogar, dass sie weiß waren. Aber in dieser Nacht war mir nicht nach Gesellschaft zumute. Ich hatte gerade erst meinen Job bei der Zeitung verloren. Ich war am Boden zerstört.
Außerdem hatte ich Hunger. Zu spät war mir klar geworden, dass das Mädchen am Empfang sich für meine unwillige Reaktion auf den Fehler, der ihr beim Einchecken unterlaufen war, postwendend revanchiert hatte. »Aber sicher doch«, hatte sie zu vorgerückter nächtlicher Stunde gesagt, mit einem leeren Ausdruck in den Augen, der sich erst im Nachhinein als teuflisch herausstellen sollte.
»Hat um diese Zeit noch irgendein Restaurant in der Altstadt geöffnet?«, hatte ich sie im Anschluss an unseren kleinen Disput gefragt. »Aber sicher doch!«, hatte sie erwidert, und so hatte ich mich im stockdunklen Labyrinth der Altstadt bald verlaufen. Aus jeder Gasse waren mir Schatten entgegengekrochen. Schatten, wie man sie immer dann sieht, wenn man mitten in der Nacht in eine fremde Stadt kommt und prompt die falsche Richtung einschlägt. Natürlich würde ich am nächsten Morgen merken, dass ich einfach nur in die andere Richtung hätte laufen müssen, um direkt im Zentrum zu landen. Doch das Schicksal einer Nachtreisenden lässt sich so leicht nicht überlisten. Mit Mühe und Not den Schatten entfliehend, rettete ich mich in mein Zimmer im Hotel Dar al-Medina, dessen Fenster eindeutig zur falschen Seite hinausging. Als nach vergeblichem Zappen durch saudische Fernsehkanäle voller Koranlesungen auch noch das Internet streikte und die einsam durchs Zimmer schwirrende Mücke sich nicht erschlagen ließ, nahm ich mir schließlich vor zu schlafen. In diesem Moment aber hörte ich die Pantoffeln.
Dann schallendes Gelächter. Ich hörte, wie eine der Frauen storchengleich einen Fuß gegen ihr Bein drückte. Ich hörte, wie ihr Pantoffel unter dem Fuß wegrutschte. Ich hörte Gesprächsfetzen. Dann griff eine der beiden nach den Jasminranken, die den Hof des Hotels überwucherten. Ich hörte, wie eine der Blüten abgerissen wurde und die Zweige zurückschlugen. So lange lauscht nur in die Nacht hinaus, wer sich davon überzeugen will, dass dort Abenteuerliches vor sich geht. Ich klemmte mir also den Whisky unter den Arm, den ich unterwegs am Flughafen gekauft hatte, und griff mir drei Gläser.
Als sie meine Schritte hörten, verstummten sie. Zwei Frauen, beide an die niedrige weiße Mauer gelehnt, die die Terrasse einfasste. Anlässlich dieser ersten Begegnung hatten wir alle jenes dümmliche Grinsen aufgesetzt, mit dem Touristen sich für ihr Fremdsein entschuldigen.
Ihre Nachthemden waren weiß. Und tatsächlich, die lässigere, kokettere der beiden, die mit den breiteren Hüften, hielt wie ein Storch einen Fuß gegen ihr Bein gedrückt. »Bei dem Lärm da unten kriegt man ja kein Auge zu«, sagte ich auf Englisch. »Wegen der Hochzeit, nicht wahr? Tafaddal – bitte, komm doch zu uns«, sagte die mit den Hüften. »Tafaddali«, echote die andere. Beide auf Arabisch. Dieses eine Wort reichte aus, mir ihre Herkunft zu verraten. Die kleine Fröhliche mit den breiten Hüften: Tunesierin. Die andere, mit dem härteren Akzent: Ägypterin. Die Ägypterin war maskulin, flachbrüstig wie ein Junge, groß, geheimnisvoll, ja, fast ein wenig zwielichtig. Die Tunesierin dagegen viel femininer, viel fraulicher. Dann explodierte eine Feuerwerksrakete und machte alle weiteren Floskeln fürs Erste überflüssig. Um besser sehen zu können, trat ich näher und stellte die Gläser auf die niedrige weiße Mauer. Mein Blick wanderte von einer zur anderen. Ja, wir würden alle Whisky trinken.
»Die Hochzeit ist von hier aus gar nicht richtig zu sehen«, meinte die maskuline Ägypterin.
»Dann schau doch mal da rüber«, erwiderte die fröhliche Tunesierin.
Und ich, die ich noch immer nichts entdecken konnte, stellte fest: »Das ist in Tunis wohl so üblich, dass keine Terrasse von einer anderen aus zu sehen ist, was?«
»Stimmt«, bestätigte die Tunesierin. »Die Architektur hier ist schlichtweg genial. Irgendwie schaffen wir es, alle auf einem Fleck zu wohnen und uns dennoch voreinander zu verstecken.«
Wieder versuchte ich, einen Blick auf die Hochzeit zu erhaschen, und schaute dabei an den beiden vorbei, die mich ausgiebig musterten. Doch erst als ich mich weit über die Brüstung lehnte, war auf einer der vielen rechteckigen Terrassen, auf die wir von oben herabblickten, das Fest zu sehen. In dem von Stromkabeln mit bunten Glühbirnen asymmetrisch durchschnittenen Karree tanzten erwachsene Frauen, während junge Mädchen Freudenschreie ausstießen und sich hinterher jedes Mal verschämt kichernd die mit Henna verzierten Hände vors Gesicht hielten. Die Braut sah mit ihrem ausladenden Satinkleid aus wie ein Fallschirmspringer, nach der Landung von feindlichen Truppen gestellt. Die Tänzerinnen dagegen glichen euphorischen Eingeborenen, denen ein Tier in die Falle gegangen war, das ein Festmahl abzugeben versprach.
»Glücklich wirkt die Braut ja nicht gerade. Wahrscheinlich hat sie Angst vor der Hochzeitsnacht«, sagte ich.
Die Tunesierin brach auf diese Plattitüde hin in schallendes Gelächter aus. Es war das gleiche Lachen, das ich schon von meinem Zimmer aus gehört hatte. »Genau das habe ich vorhin auch gesagt«, erklärte sie. »Sie wird ihr blaues Wunder erleben heute Nacht. Schocktherapie!«
Die Ägypterin lächelte gezwungen. »Möglicherweise dient ja die unter tunesischen Juden verbreitete Tradition, der Braut zwanzig Tage vor der Hochzeitsnacht jegliche Bewegung zu verbieten und sie ordentlich zu mästen, genau diesem Zweck. Um sie für die Strapazen der ersten Nacht zu wappnen.« Und um klarzustellen, dass sie mit der Tunesierin noch lange nicht so vertraut war, wie diese angedeutet hatte, fügte sie hinzu: »Wir haben uns übrigens auch gerade erst kennengelernt.« Anschließend fragte sie ernst: »Und woher kommst du?«
»Stimmt schon«, fiel ihr die andere ins Wort, »wir sind uns gerade erst begegnet, aber gefühlt kennen wir einander schon seit Ewigkeiten.«
Die Ägypterin ließ sich nicht beirren und fragte weiter: »Du bist Journalistin, nehme ich an?«
»Kann man das an meinem Nachthemd ablesen?«, wollte ich wissen.
»Nein, das Einzige, was man daran ablesen kann, ist dein Unterwäschegeschmack«, prustete die Tunesierin.
Ich schwieg. Leicht pikiert. Anzügliche Vertraulichkeiten waren nicht mein Fall. In der Hoffnung auf ein niveauvolleres Gespräch wandte ich mich wieder der Ägypterin zu.
»Ich war Journalistin. Zurzeit bin ich arbeitslos. Vielleicht werde ich ein Buch über den Arabischen Frühling schreiben, deshalb bin ich hier. Und du bist nicht zufälligerweise Wissenschaftlerin?«
In dem Moment schien die Frau mir gegenüber sich in ein kleines Mädchen zu verwandeln, das auf dem Nachhauseweg irgendetwas Lustiges erlebt und darüber kichern muss. Dann sachliches Nicken. »Ich heiße Maryam«, stellte sie sich vor. »Und yes, Ma’am, Amerikanische Universität Kairo, Historische Fakultät.«
Zwar war mein Ärger über die plumpe Vertraulichkeit der Tunesierin noch nicht ganz verflogen, doch beschloss ich, auch ihr noch eine Chance zu geben: »Und was machst du?«
»Ich bin erst heute Nacht hier angekommen«, erwiderte sie schlicht. »Aus New York.« Sie presste ihre Lippen ans Whiskyglas, lächelte und kostete mein gespanntes Schweigen noch eine Weile aus. Anschließend ließ sie blitzlichtartig und in Neonschrift ihren Namen aufflackern: »Ich heiße Amira.«
Am Himmel explodierte eine weitere Rakete. Wir folgten ihrer Bahn. Von dort oben musste die Stadt einem riesigen Kreuzworträtsel gleichen, zusammengesetzt aus hellen und dunklen Terrassenquadraten. In einem der hellen Quadrate war das H von Hochzeit bereits zu lesen, doch hätten, um das Wort zu vollenden, erst noch andere Terrassen beleuchtet werden müssen. Wir drei Frauen befanden uns in einem jener dunklen Quadrate, über die sich niemand je den Kopf zerbricht. In diesem Quadrat, in dem es mittlerweile feuchtfröhlich herging, sahen wir unsere Gesichter immer nur in jenem kurzen Moment aufblitzen, wenn die Raketen ihre größte Strahlkraft erreichten, und während sie wieder zur Erde stürzten und ihr Licht an unseren Gesichtern hinab zu unseren Bäuchen glitt, machten wir uns nach und nach mit den Schultern, Brüsten, Armen und Handgelenken der anderen bekannt. Maryam hätte man tatsächlich, wäre ihr Nachthemd nicht gewesen, für einen Jungen halten können. Mit ihrer tiefen Stimme hinterließ sie in mir den Eindruck von Stärke. Amira dagegen zappelte in ihrem Nachthemd wie ein Fisch im Netz. Bei jedem Windstoß erschauerte sie, als wäre sie geküsst worden. Zwischen den beiden hatte sich, noch bevor ich dazugestoßen war, bereits eine klare Rollenverteilung ergeben: Maryam war der Mann und Amira die Frau. Ihre Gegensätzlichkeit ließ die jeweiligen Charaktereigenschaften umso stärker hervortreten. So standen wir draußen auf dem dunklen Dach und beobachteten unsere Umgebung, ohne selbst gesehen zu werden, versteckt im schwarzen Quadrat eines riesigen Kreuzworträtsels.
Als das Feuerwerk zu Ende war, fragte ich Amira neugierig: »Sag mal, warum übernachtest du eigentlich im Hotel, bist du nicht aus Tunis?«
Sie lächelte bitter und wandte ihren Blick der Hochzeit zu. Nach einer Weile sagte sie mit tonloser Stimme, die nicht mehr jener Frau zu gehören schien, die kurz zuvor noch so herzlich gelacht hatte: »Mein Vater ist gestorben, und es gab eine Revolution. Ich habe einfach keine Lust, nach Hause zu gehen.«
»Mein herzliches Beileid«, sagte Maryam auf Arabisch. Ich sagte nichts. Amira hob das Kinn, um sich für die Anteilnahme zu bedanken. Dann aber nahm sie das betretene Schweigen auf wie einen Kreisel und setzte einen Wirbelwind an Beredsamkeit in Gang.
»Komisch ist es schon. Ich fühle mich wie eine Touristin. Man wird zu einer anderen Person, wenn man ins Hotel geht statt nach Hause. Als würde man das eigene Leben durch die Hintertür betreten. Aber es ist schon besser so …« Sie nickte einige Male vor sich hin. »Ja, es ist besser so.« Und während sie ein paar hastige Schlucke von ihrem Whisky nahm, sagte Maryam: »Als wäre man in einem Film gelandet: The Purple Rose of Tunis!«
Oh, dachte ich mir, die Nacht scheint unterhaltsam zu werden. Denn während es mir immer Angst einjagt, interessante Männer kennenzulernen, weil ich mich dann fühle wie in Paris kurz vor einem Bombenangriff, erfüllen Begegnungen mit interessanten Frauen mich stets mit einem Gefühl der Dankbarkeit, wie wenn sich in der Mailänder Scala der Vorhang hebt.
»Und was treibt dich hierher?«, wandte Amira sich an Maryam, in deren Augen eine Miniaturhochzeit aus farbigen Glühbirnen funkelte.
»Ich forsche über Königin Dido, die Gründerin Karthagos. Aber ehrlich gesagt, musste ich auch nur irgendwie meinem eigenen Film in Kairo entfliehen.«
Ich weiß ja nicht, ob Araberinnen sich das bei Scheherazade abschauen, aber beide hatten es hinbekommen, ihre Erzählung ausgerechnet dann zu unterbrechen, als es spannend wurde.
So zogen wir uns also an den schmiedeeisernen Tisch zurück, der an der dunkelsten Stelle des dunklen Quadrats stand. Wir lachten, dass die Träger unserer weißen Nachthemden auf und ab hüpften, und jedes Mal beleuchtete das Licht des Mondes andere Bereiche unserer Gesichter. Wir klagten über Orangenhaut und wurden zusehends betrunkener. Wir lachten über das Mädchen am Empfang, über die zellenartigen Hotelzimmer und über die Tänzerinnen unten auf der Hochzeit. Amira ahmte tunesische Männer nach, und auch darüber lachten wir. Später kamen dann Ägypter und Türken an die Reihe. Hätte sich jemand die Mühe gemacht, unser süßes Stimmengewirr zu dechiffrieren und zu Papier zu bringen, es hätte eine amüsante kleine Enzyklopädie des nahöstlichen Mannes dabei herauskommen können. Dann schwiegen wir eine Weile. Amira hatte während der ganzen Zeit noch kein Wort über sich selbst verloren. Ich wurde zusehends neugieriger.
»Jetzt sag doch mal«, wandte Amira sich an Maryam, »warum bist du aus Kairo abgehauen?« Und mit einem Mal schien Maryam entschlossen zu erzählen. Darum bemüht, sich Amiras lässigem Ton anzupassen, nestelte sie unbeholfen an Wörtern herum, die sie erst vor kurzem kennengelernt zu haben schien: »Ich hab was ausgefressen, Süße. Hab mit einem Typen gevögelt. Deshalb bin ich abgehauen!«
»Respekt!« Amira gackerte wie eine Legehenne.
Während Maryam sprach, schien sich ihr Körper mal in den eines Mannes, mal in den einer Frau zu verwandeln, mitunter ging es wie beim Schluckauf zwischen beiden hin und her. Wenn Amira ihre Brüste auf den Tisch legte, beugte auch Maryam sich vor, lehnte Amira sich wieder zurück, tat sie dasselbe. Dieses Wechselspiel schien Maryam Kraft zu geben, und sie wurde immer gesprächiger.
»Bis vor kurzem habe ich ja noch streng über meine Unschuld gewacht. Hat lange gedauert, bis irgendein Glückspilz den Jackpot endlich geknackt hatte, wenn ihr versteht, was ich meine! Ha, ha, ha …«
Doch der flapsige Ton, mit dem sie ihren Kummer zu überspielen versuchte, wollte nicht so recht zu ihr passen und löste eher Unbehagen aus. Amira vertrieb den schalen Nachgeschmack. »Oha! Wir haben also auch eine Braut!«
Und während sie mit einer Hand ihren Mundwinkel hochzog bis ans Ohr, erhob sie mit der anderen ihr Glas. Wir stießen geräuschvoll an, und so verflüchtigte sich Maryams Kummer, den sie, weil sie ihn nicht in Worte zu fassen vermochte, ins Lächerliche zu ziehen versucht hatte. Offensichtlich stand sie zwar mit beiden Beinen im Leben, war in Herzensangelegenheiten jedoch womöglich überfordert.
»Ich bin sechsunddreißig, Schätzchen! Studium in Cambridge, Master und Promotion in Princeton. Und ich bin Muslima. Eine von der betenden Fraktion. Was ich dir damit sagen will, Süße: Ich hatte einfach keine Zeit für solche Sachen. Und außerdem … Ägypten ist ziemlich konservativ, wie du sicher weißt. Nicht wie Tunesien.«
Amira lachte. »Jetzt komm mir nicht damit!«, sagte sie. Doch ihr Lachen klang künstlich. Ihr Spielchen, alles auf die leichte Schulter zu nehmen, schien schwieriger zu werden. Mit einem Mal rückte Maryam vom Tisch ab und setzte eine ernste Miene auf. »Und dann, auf dem Tahrir-Platz …« Sie zog eine Zigarettenschachtel aus der Nachthemdtasche und fuhr fort: »Auf dem Tahrir-Platz … wie soll ich das sagen? Irgendwas war anders. Es lag so ein Zauber in der Luft.«
Auch Amira hatte sich zurückgelehnt, als wolle sie lieber nicht hören, was Maryam über den Zauber des Tahrir-Platzes zu erzählen hatte. Ich aber, die ich seit jeher Angst habe, dass Menschen, denen man keine Beachtung schenkt, wenn sie zum ersten Mal ihre Geschichte erzählen, plötzlich sterben könnten, fragte: »Meinst du dieses Gemeinschaftsgefühl?«
»Ja, genau. Wir wurden eins miteinander. Gingen aus uns selbst hinaus. Frauen und Männer, alle zusammen, wie beim gemeinsamen Gebet. Ich fühlte mich so geborgen.« Während Maryam sprach, wölbte sich über ihrem Kopf eine magische Glocke der Verklärung. »Niemand hatte mehr Angst oder Schuldgefühle. Und so kam es eben, dass ich eines Nachts auf dem Tahrir-Platz …«
»Nein, oder?«, rief Amira, die sofort wieder Feuer gefangen hatte, nun, da es schlüpfrig zu werden versprach.
»Oh doch«, sagte Maryam und nickte einige Male versonnen.
»Im Zelt, oder was?«, entfuhr es mir, als hätte ich selbst bereits einschlägige Erfahrungen in dieser Hinsicht gesammelt. So eine Verrücktheit hätte ich Maryam niemals zugetraut – ihr, die selbst splitternackt noch aussehen musste wie ein Junge.
Amira gab sich betont ahnungslos. »Und, war’s gut?«
So viel Indiskretion ging Maryam nun doch zu weit, und sie antwortete mit einem gequälten Lachen.
Diesmal schwang ich mich zur Florence Nightingale auf. »Wisst ihr, was? Vor ein paar Jahren habe ich mal für einige Zeit in Beirut gelebt. Meine Mutter macht sich immer alle möglichen Sorgen, und neugierig ist sie auch. Irgendwann besuche ich sie, und wir unterhalten uns in der Küche. Da stellt sie mir Fragen wie: ›Was machst du eigentlich bei denen? Ich meine, wie sind die Araber so? Sind die nicht furchtbar religiös?‹ Wenn es um Araber geht, denken Türken nämlich immer gleich an Saudis oder Schwarzafrikaner.«
»Wieso denn das?«, wunderte sich Maryam.
»Ist halt so. Na ja, jedenfalls sage ich zu meiner Mutter: ›Weißt du, Mama, in Beirut ist es eigentlich ganz ähnlich wie hier. Die Araber sind gar nicht so. Auf Arabisch betet man nicht nur, man liebt sich auch, macht Politik und so weiter.‹ Ich schildere ihr die politische Lage, umreiße die Geschichte der Arabischen Linken seit den Sechzigerjahren et cetera, da kommt mein Vater rein, Sonnenblumenkerne knabbernd, und sagt: ›Klar, Schatz, es gibt auch moderne Araber!‹«
Da fingen sie an zu lachen. Und als ich hinzufügte: »Ihr seid mir auch zwei ziemlich moderne Araberinnen!«, lachten beide noch mehr. Trotz aller aufgesetzten Härte und Lässigkeit sehnten sich die beiden im Grunde genommen wohl doch nach Harmonie.
Plötzlich streckte Amira ihren Kopf in die Luft wie ein in Habtachtstellung gehendes Erdmännchen. »He! Wartet mal! Was ist denn das?!«
Wir hielten den Atem an. Die Hochzeit war zu Ende, und alles schien still, da lauschte Amira, als habe sie ein Geräusch vernommen. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, woher es kam, trugen ihre Schlappen sie jedoch nicht etwa zu der Seite, wo die Hochzeit stattgefunden hatte, sondern in genau die entgegengesetzte Richtung. Wir auf Pantoffelspitzen hinterher. Sie beugte sich über die Brüstung zur Terrasse eines Hauses hinab, das links an das Hotel angrenzte. »Ja, da ist es.«
Wir sahen die Hand einer alten Frau, einen schweren Rubinring am Finger, wie sie nach einem Glas Wein griff. Daneben spielte ein Grammophon Sirat al Hob von der ägyptischen Sängerin Umm Kulthum. Nach jedem Schluck ließ die Hand das Glas langsam und zitternd auf die Tischplatte zurücksinken, wo sie es umklammert hielt und mit dem Ring schwerfällig den Rhythmus gegen das Glas klopfte.
Amira übersetzte den Liedtext ins Englische, als zergingen ihr die Worte wie Marzipan auf der Zunge.
»Ich habe viele Liebende gesehen … Sie klagten und litten Qualen … Sie taten mir leid … Ich fürchtete die Liebe, wollte mein Herz vor ihren Qualen schützen … Doch dann kamst du …«
Durch den Spalt war allein diese Hand zu sehen, einschließlich der rot lackierten Fingernägel. Bei jedem »Doch dann kamst du« verharrte der rubingeschmückte Finger am Glas. So schauten wir von einem schwarzen Quadrat des Altstadtkreuzworträtsels ins andere, während Amira weiter übersetzte:
»Viele Augen flirteten mit mir, doch sie ließen mich kalt … Nur deine Augen, nur sie hielten mich fest … Und ich liebte zum ersten Mal …«
Mit einem Mal unterbrach sich Amira und seufzte aus tiefstem Herzen. »Ach ja, Umm Kulthum … Wen hat die Frau nicht alles zugrunde gerichtet. Am meisten Mitleid habe ich mit Asmahan. Was für eine Frau! Zu schön, um respektiert zu werden. Zu zerbrechlich, um gegen dieses Mannweib von Umm Kulthum anzukommen.«
Maryam beobachtete die Hochzeitsgäste, die nun allmählich auseinandergingen. Während sie den Frauen dabei zuschaute, wie sie theatralisch voneinander Abschied nahmen und wie die Hühner durcheinander wuselten, entgegnete sie: »Umm Kulthum hatte doch keine andere Wahl. Sie wurde ja fast dazu gezwungen, sich wie ein Mann zu benehmen.«
»Ich hasse Umm Kulthum!«, stieß Amira hervor, doch irgendwie hatte ich den Eindruck, dass sie eigentlich jemand ganz anderen meinte.
Maryam aber nahm keinerlei Rücksicht darauf, dass Amira so plötzlich ihr Herz geöffnet hatte, und lachte: »In Ägypten gab es mal einen Imam, der Umm Kulthum allen Ernstes dafür verantwortlich machen wollte, dass Ägypten den Sechstagekrieg verloren hatte. ›Wie soll man einen Krieg gewinnen, wenn sie mit ihren Liedern unsere Männer verweichlicht!‹ Als könnte Umm Kulthums tiefe Stimme irgendjemanden verweichlichen!«
Jetzt lachte auch ich, und Amiras Stimme wechselte die Tonlage – an die Stelle der vom Schicksal gebeutelten Frau trat das missachtete Kleinkind. »Also ich bin auf der Seite von Asmahan … ich meine, ich finde sie toll. Wieso sollten immer alle für die Gewinnerin sein?«
Maryam setzte ein gezwungenes Lächeln auf. »Glaubst du etwa, Mannweiber wären die Gewinnerinnen, Süße?«
Das Lied und unsere Unterhaltung waren verklungen, und wir hörten die Wolken am Mond vorüberziehen. So hätte die Nacht enden können, denn auch der Whisky war alle. Da fasste sich Maryam plötzlich ein Herz und rief über die Mauer hinweg: »He, Madame! Ich wünsche einen guten Abend! Wohl bekomm’s!«
Die Hand griff irritiert nach dem Glas. Sie dachte nach, die Hand, wunderte sich, sah sich um. Dann neigte sich das Gesicht zur Hand hinab, um nachzusehen, was das für eine Stimme war, die die Hand von weitem gehört hatte. Und endlich sah sie uns. Die Oberkörper dreier Frauen in weißen Nachthemden, in den Händen drei leere Gläser. Sie richtete sich auf, so langsam, als hätte sie noch drei Leben. Möglich, dass sie lächelte, aber ihr Gesicht war so voller Runzeln, dass man es nicht mit Bestimmtheit sagen konnte. Sie erhob ihr Glas in unsere Richtung. Wir prosteten zurück. Winkend grüßten wir die alte Frau mit der ganzen Herzlichkeit betrunkener Menschen. Auf La Strada-Art. Dann bedeutete sie uns mit zitternder Hand: »Einen Moment. Einen Moment bitte …«, und legte eine Platte auf. Wir ahnten, worauf sie hinauswollte. Wir ahnten, dass ihr der Gedanke zu einem ebenso schwermütigen wie subtilen Scherz gekommen war, den nur Eingeweihte würden verstehen können. Das Lied begann, und wir hörten Warda singen:
Ach ja, die Zeit … So lang ist die Liebe schon fort!
Wir lachten. Um ihr klarzumachen, dass wir ihren Scherz verstanden hatten, lachten wir aus vollem Halse.
So also fing alles an. Vier Frauen waren wir. Vier Frauen, die sich langsam aneinander herantasteten und die nirgendwo Zuflucht suchen konnten als in dieser Geschichte. Vier Frauen, die sich für drei Frauen hielten. Wir wussten weder, dass wir die Lösung für unsere Probleme in uns selbst trugen, noch, dass wir gemeinsam jenes Heilmittel entdecken sollten, mit dem sich die Menschheit vom Bösen kurieren ließe. Die seltsamen Ereignisse, von denen im Folgenden berichtet werden soll, liefen genau so ab, wie ich sie schildern werde. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich manchmal sogar selbst Mühe habe, das alles zu glauben.