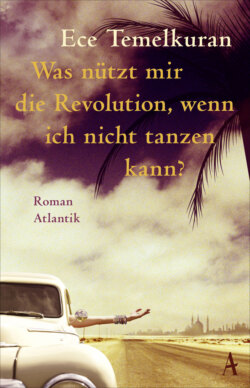Читать книгу Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann - Ece Temelkuran - Страница 8
3. Kapitel
Оглавление»Es ist Nacht. Überall Bäume, ein Wald oder so. Man sieht die Füße einer rennenden Frau. Einer Frau in den besten Jahren – meine Füße also. Die Frau flieht. Man hört ihren keuchenden Atem. Neben ihr läuft jemand anderes, ohne dass man wüsste, wer es ist. Gemeinsam sind sie auf der Flucht. Ab und zu blickt die Frau sich um. Hinter ihr johlendes Geschrei. Eine Menschenmenge ist ihr auf den Fersen. Die Frau rennt weiter. Sie rennt und rennt. Dann – wieder ihre Füße – bleibt sie plötzlich stehen. Keuchen. Die Kamera fährt ein wenig zurück … eine Mauer! Die Kamera gleitet langsam höher. Die Frau sitzt in der Falle. Es gibt kein Entkommen. Man sieht, wie sie sich langsam zu ihren Verfolgern umdreht. Die Kamera ist jetzt hoch über ihr. Sie zeigt die Frau von hinten. Die Menschen kommen näher und immer näher. Dann bleiben sie stehen. Während die Kamera hochfährt: metallische Geräusche. Klack, klack, klack … Die Menschen haben die Frau eingekreist und entsichern ihre Waffen. Sie zielen. Langsam fährt die Kamera weiter nach oben. Immer noch sieht man die Frau von hinten, jetzt aber kommen auch ihre beiden Begleiter ins Bild: ein Bärenjunges und ein Pelikan!
Man sieht das Gesicht der Frau. Sie schwitzt, keucht, blickt gehetzt um sich. Während sie langsam die Hände in die Luft nimmt, hört man eine Stimme aus dem Off:
›Ich bin mir sicher: Ihre Geschichte ist interessanter als meine. Aber jetzt bin ich dran mit Erzählen!‹«
Madame Lilla hält kurz inne, reißt die Augen auf, als wäre sie mindestens fünfzig Jahre jünger, und fragt: »Und? Spannend?«
Maryam, Amira und ich sitzen mit weit aufgesperrten Mündern um den Tisch herum, und unsere schockierten Gesichter könnten noch stundenlang im gleichen Zustand verharren.
Madame Lilla bricht in schepperndes Gelächter aus. Sie lacht, solange uns die Münder offen stehen, und die stehen offen, solange sie lacht. So ist das, als wir – Amira, Maryam und ich – die grandiose und unvergleichliche Madame Lilla kennenlernen.
Die Besitzerin jener Hand, die in der Nacht zuvor alleine Wein getrunken und Umm Kulthum gehört hat – jene geschätzte Madame Lilla eben –, hat uns dermaßen verblüfft, dass wir der irrigen Vorstellung erliegen, sie könnte uns nicht noch mehr in Erstaunen versetzen. Zwar haben die nach Jasmin duftenden Einladungskarten, die wir alle drei in unseren Hotelzimmern vorfanden, unser Interesse geweckt, aber dass wir es mit einem so schillernden Wunderland in Menschengestalt zu tun bekämen, damit hat keine von uns gerechnet.
*
»Ich gehe nirgendwohin«, sagte Amira, die Einladung in der Hand. Wir hatten uns gegen Abend auf der Terrasse, auf der wir uns eine Nacht zuvor erstmals begegnet waren, wiedergetroffen und zusammengesetzt. Amiras Augen waren verquollen, angeblich von der hohen Luftfeuchtigkeit. Ich hakte nicht weiter nach. Irgendwann würde sie schon von sich aus erzählen. »Was ist das eigentlich für eine Einladung?«, fragte ich. »Kapierst du das?«
Ich wäre überglücklich, wenn die reizenden Damen mich heute Abend in meiner Residenz beehrten.
Menü:
In Jasminextrakt marinierter Minztruthahn
In Mandarinenjus gegartes Mandelrisotto mit Pflaumen
Thymiansalat mit Äpfeln und Sumach
Als Dessert Grießhalva mit Harz und Korinthen
Zum Essen wird hausgemachter Rosenwein gereicht.
»Vor allem frage ich mich, wie in Mandarinenjus gegartes Risotto schmeckt.«
»Ja, das ist auch so ziemlich das Einzige, worauf ich gespannt bin«, feixte Amira.
Da sie wieder lachen konnte, meinte ich einwerfen zu dürfen: »Du warst nicht zufälligerweise zu Hause?«
Sogleich vergrub sie ihr Gesicht in ihren Händen.
»Soll ich uns ein Bier bestellen?«, fragte ich. Ihr Gesicht war nicht zu sehen, aber ihre Haare nickten. Bis das Bier kam, war die Sonne noch ein wenig tiefer gesunken. Der Himmel spielte ins Neonfarbene. Das Weiß der Terrasse, das den ganzen Tag über in die Sonne geblinzelt hatte, schlug langsam die Augen auf. Mit schwankendem Tablett und gut gelauntem Grinsen erschien Kamal, eine Art Mädchen für alles im Hotel, doch als er die melancholische Stimmung spürte, verschwand er wieder von der Bildfläche. Während ich uns einschenkte, war Amira offenbar gerade am wichtigsten Punkt eines inneren Monologs angekommen.
»Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann!«
»Ah! Emma Goldman!«
»Hä?«
»Das ist doch ein Zitat von Emma Goldman. Amerikanische Anarchistin. Zwanziger Jahre …«
»Die kenne ich nicht. Ich rede mit dir. Ich meine, ich sage das! Ich spreche von Respekt. Verstehst du? Ich werde nicht respektiert. Dabei dachte ich, dass …«
»Dass sich nach der Revolution etwas ändert?«
»Ach was, Revolution! Als mein Vater starb … na ja, da dachte ich eben, es ist endlich Schluss mit dem Familienterror.«
Sie war wütend. Auch auf mich. Ich verstand zwar nicht, wieso, aber sie platzte geradezu vor Wut, und es war ihr bitterernst. Jetzt fing sie auch noch an zu weinen. Als sie sich wieder im Griff hatte, fuhr sie fort: »Ich konnte es euch gestern noch nicht sagen, aber ich bin Tänzerin.«
»Echt? Das ist doch toll!«
»Von wegen toll! Außerdem bin ich Journalistin. So eine Art jedenfalls. Bloggerin eben.«
»Ist das dein Ernst?«
»Bis unser Diktator Ben Ali endlich zurückgetreten ist, zu einer Zeit, als überall noch Zensur herrschte und so, haben ein paar Tunesier im Ausland jede Menge Arbeit geleistet. Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen. Wir haben halt staatliche Websites gehackt, und was weiß ich. Und dann …«
»He, Moment mal! Ihr habt was getan?«
Sie warf mir einen unwilligen Blick zu.
»Ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, darüber zu sprechen. Weil nach der Revolution plötzlich alle Revolutionäre waren. Als wären wir ein Volk von lauter Helden. Dabei waren wir nur eine Handvoll Leute, und jetzt sind auf einmal sämtliche Plätze von Revoluzzern bevölkert! Ich habe lange gewartet und viel Geduld gehabt … Aber dann ist mein Vater gestorben, bevor ich mit ihm sprechen konnte. Ich hatte ihm extra nicht geschrieben, weil ich es ihm ins Gesicht sagen wollte. Mitten ins Gesicht. ›Ich, deine eigene Tochter‹, wollte ich ihm sagen, ›die Hure, die sexbesessene Tänzerin hat diese Revolution mit ausgelöst, du Schwein!‹ Und dann stirbt der Mistkerl einfach …«
»Ben Ali hattest du also schon überdribbelt, da hat dein Vater den Ball ins Aus geschossen.«
Meine tiefsinnige Analyse schien sie nicht zu interessieren.
»Und gestern hat mir meine Mutter …« Wieder kamen ihr die Tränen. Sie wischte sie fort und sprach weiter. »Ich fühle mich so hintergangen, weißt du? Da denkst du jahrelang, dein Vater ist der Böse und deine Mutter nur ein armes Opfer. Dabei hatten die beiden so etwas wie eine geheime Absprache. Du reißt dir ein Bein aus, um deiner Mutter beizustehen. Du leidest für sie. Behandelst sie, als wäre sie deine Tochter. Und dann … dann, als dein Vater endlich weg ist, zeigt deine Mutter plötzlich ihr wahres Gesicht und hält dir vor: ›Dein Verhalten ziemt sich nicht für unsere Familie!‹ Man könnte wirklich meinen, wir wären der Trabelsi-Clan.«
»Der was?«
Amira warf mir einen geringschätzigen Blick zu. »Und du willst Journalistin sein? Das ist die Familie von Ben Alis Ehefrau. Vor der Revolution gehörte ihnen mehr als das halbe Land. So eine Art Mafiafamilie. Du bist doch nicht hierhergekommen, ohne jemals von ihnen gehört zu haben?«
»Doch, ich fürchte schon. Es war mehr so eine Art Bruchlandung hier. Ich meine, eigentlich wurde ich ja entlassen …«
»Ach so …«, sagte sie gleichgültig. Als wäre eine Entlassung das Normalste auf der Welt. Irgendwie tat mir das gut.
Sie fuhr fort: »Da sagt sie doch tatsächlich: ›Wenn wir uns nicht völlig zum Gespött machen wollen, müssen wir dich unter die Haube bringen.‹ In dem Moment habe ich mir die Briefe geschnappt und bin raus.«
»Was für Briefe?«
»Das ist ja die eigentliche Story. Der Grund dafür, warum ich vorhin geheult habe, meine ich.«
In diesem Moment wurden auf den Stufen, die zur Terrasse führten, Schritte laut. Ein junger Mann erschien im Dämmerlicht. Mit den Händen in den Taschen kam er auf uns zugeschlendert und sagte laut: »Warum habt ihr mir nicht auch ein Bier bestellt?«
»O mein Gott!«, entfuhr es mir, während Amira nur ein »Was hast du bloß getan?« herausbrachte. Der junge Mann war Maryam, lachend und mit kurz geschorenen Haaren. Sie trat an die Brüstung und rief gut gelaunt in den Hof hinunter: »Schicken Sie uns bitte noch ein Bier hoch?« Dann setzte sie sich zu uns. Fläzte sich hin. Sie zauberte ein verführerisches Lächeln auf ihre Lippen und wippte mit einem Bein. »Wegen der Hitze. Es soll noch heißer werden, haben sie gesagt. Da hab ich sie mir einfach abgeschnitten.« Sie strich sich über die Stoppeln. »Und? Sieht gut aus, was?«
»Und wie«, sagte ich mit einem Gesichtsausdruck, der irgendwo zwischen Staunen und Lächeln angesiedelt war, während Amira erneut in Tränen ausbrach.
»Na, na! Was ist denn mit dir los?«, fragte Maryam und griff nach Amiras Hand.
»Keine Ahnung«, schniefte Amira und zog die Nase hoch.
»Du wirst mich doch nicht mit jemandem verwechselt haben? Mit deinem Lover vielleicht?«, lachte Maryam und warf mir einen Blick zu, als wollte sie sagen: »Was hat sie denn?« Worauf ich eine Augenbraue hob, um ihr zu signalisieren: »Das erzähle ich dir später.« Während sie Amiras Hand hielt, fiel Maryams Blick auf die Einladungskarten, die auf dem Tisch lagen. »Ihr habt die Dinger also auch bekommen. Wir sollten da auf jeden Fall hingehen. Besonders gespannt bin ich auf das Mandarinenrisotto.«
Wir warfen uns also in Schale und standen wenig später vor der blauen, von Jasmin umrankten Tür direkt neben dem Eingang unseres Hotels. Während wir darauf warteten, dass man uns öffnete, flüsterte ich Maryam zu: »Jetzt mal im Ernst: Warum hast du dir die Haare abrasiert?«
»Das habe ich doch schon gesagt«, erwiderte sie. »Wegen der Hitze.«
Mir schien, als wäre mit den Haaren auch das peinliche Gefühl von ihr abgefallen, eine Schauspielerin zu sein, die man im falschen Kostüm auf die Bühne geschickt hatte. In diesem Moment tat sich die Tür auf, und ein alter Mann, dessen eines Auge blind war, empfing uns mit den Worten: »Herzlich willkommen, meine Damen.«
Er war sehr hager, hatte tiefdunkle Haut, trug einen gepflegten Anzug und glänzende Lackschuhe. Kurz: ein vollendeter afrikanischer Gentleman. Beim Sprechen reihten seine Worte sich aneinander wie die Perlen einer Gebetskette. »Herzlich willkommen, meine Damen. Ich bin Ayyub, Madame Lillas Assistent. Madame Lilla erwartet Sie bereits auf der Terrasse.«
Während wir die Treppen emporstiegen, drangen die ersten Takte von Umm Kulthums Fakarouni, Sie erinnerten mich an ihn, an unser Ohr. Das ganze Haus war voller Spiegel, größtenteils blind. Unmöglich, sich in irgendeinem richtig zu betrachten. Für eine alte Frau, die ihr Gesicht so in Erinnerung behalten wollte, wie es einst gewesen ist, eine verständliche Wahl. Mitten im Haus ein Jasminbaum, dessen Zweige sich die Treppe hoch zur Terrasse rankten. Zur Tür hin ein alter, mit dunkelgrünem Samt bezogener Sessel. Außerdem eine hässliche Katze mit langen, staksigen Beinen, in einem riesigen Käfig inmitten des Raums bunte Vögel, Dutzende farbige Glaslaternen und eine Peitsche. Nanu? Ja, auf einer Anrichte lag tatsächlich eine Peitsche. Dazu Gemälde, alles Originale, und ein Berg von Schwarz-Weiß-Fotos auf der kleinen Kommode neben dem Sessel …
Ich hatte mich noch lang nicht sattgesehen, da sagte eine heitere Frauenstimme: »Bitteschön! Treten Sie doch näher!«
So kamen wir bei Madame Lilla an, deren Stimme wie eine Glasmurmel die Treppen hinunterkullerte. Mit ausgebreiteten Armen stand sie auf der Terrasse. Sie war klein, wirkte jedoch deutlich größer. Sie sah aus wie Ende sechzig, war aber sicherlich zehn Jahre älter. Ihre weißen Haare schien sie vor langer Zeit mit einer einzigen schnellen Bewegung zu einem Dutt aufgesteckt und danach nie wieder angerührt zu haben. Eine Lady, die definitiv die Hauptrolle spielen könnte, sollte jemals eine Fortsetzung der Kameliendame gedreht werden. Ihr violett gemustertes Seidenkleid wurde von einem antiken goldenen Gürtel zusammengehalten. Ihre Bewegungen wirkten träge, aber es war wohl eher so, dass sie jene überflüssigen Bewegungen vermied, mit denen junge Menschen nur irgendwelche Lücken schließen. Sie glich einem alten, behutsam modernisierten Gedicht. An ihrem Hals eine Fatimahand, wie ich noch keine gesehen hatte: zart und silbern, voller Armbänder und Ringe, mit Smaragden und Rubinen besetzt. Wir standen ihr gegenüber, die eine kahl geschoren, die zweite mit verheulten Augen, ich leicht angetrunken. Im Vergleich zu dieser Dame mussten wir aussehen wie drei kleine Jungs, die gerade vom Ballspielen kommen.
»Bitteschön, meine Damen«, sagte sie. »Machen Sie es sich bequem. Das Essen wird gleich aufgetragen. Ein Glas Rosenwein gefällig?«
Maryam, ganz Gentleman, zauberte einen Mechmoum aus ihrer Tasche.
»Ah!«, sagte Madame Lilla erfreut. »Wie aufmerksam von Ihnen!« Sie lächelte mit einer Anmut, die sie schon als Dreißigjährige besessen haben musste. »Aber wissen Sie denn auch, warum die Knospen für einen solchen Strauß so früh am Morgen gepflückt werden, dass sie alle noch geschlossen sind?« In ihrer Stimme flammte mit jedem Wort ein Streichholz auf. »Damit sie ihre Träume nicht vergessen. Nimmt man sie mit nach Hause und legt sie auf ein silbernes Tablett, dann öffnen sie sich langsam, denken zurück an die Nacht und säuseln einem ihre weißen Träume zu.«
Verdammt! Warum hatte ich meinen Notizblock nicht mitgenommen? So vergaß ich solche Sätze doch gleich wieder.
»Ach, da fällt mir auf, ich habe Englisch gesprochen. Aber ich dachte mir, unsere lingua franca sollte das Englische sein«, bemerkte sie und riss damit ebenso dezent wie bestimmt die Hauptrolle an sich. Mit feierlicher Rückenhaltung nahmen wir auf unseren Stühlen Platz. Offensichtlich hielt sie uns trotz unserer zweitklassigen Garderobe für Frauen, die den gesellschaftlichen Umgang wert waren. Oder sie hatte einfach nur die Mathematik des Lebens durchschaut. Hatte die ständige Sorge des Misstrauens eingetauscht gegen das vorübergehende Leid der Enttäuschung.
»Kamal hat es Ihnen sicher schon gesagt: Man kennt mich hier als Madame Lilla. Auch Sie dürfen mich so nennen«, sagte sie, und wir glaubten natürlich, dass sie nun auch unsere Namen in Erfahrung bringen wollte, jedoch …
»Als Sie mir gestern Abend von der Terrasse aus zuprosteten – wie Sie sich vorstellen können, sind derartige Gesten in Tunis nicht gerade gang und gäbe –, da musste ich Sie einfach kennenlernen. Ich hoffe, Sie fanden meine Einladungskarte nicht allzu mysteriös. Aber das war einfacher, als dem neugierigen Kamal die Zubereitung von Mandarinenrisotto auseinanderzusetzen …«
Immer noch ein wenig verlegen, stießen wir ein unförmiges Lachen aus.
»An Jasmin mangelt es Ihnen ja nicht gerade, wir hätten vielleicht doch lieber etwas anderes mitbringen sollen«, sagte Maryam, und Amira, die sich vom Spiel ausgeschlossen fühlte, fügte mit Schmollmund hinzu: »Bitte nehmen Sie es uns nicht übel, aber uns ist einfach nichts Besseres eingefallen.«
»Sehr schön haben Sie es hier«, bemerkte ich, um auch etwas gesagt zu haben.
Madame Lilla pickte sich von unseren Sätzen denjenigen heraus, der sich am besten für eine Replik eignete, und während sie mit rheumatisch-arthritischer Zittrigkeit unseren Wein in antike Kristallgläser goss, erwiderte sie: »Ach ja, der Jasmin! Besonders mag ich den vor meiner Tür. Er ist von ganz alleine dort gewachsen.«
Amira sperrte ihren Mund auf, um etwas zu entgegnen, doch Madame Lilla ließ sie nicht zu Wort kommen. »Ach! Da ist schon unser Essen. Den Service übernehme ich, Ayyub. Sie dürfen sich vorerst zurückziehen.«
Ayyub sah seine Herrin an – ein gefallenes Blatt, das zum Baum emporblickt – und entschwand. Madame Lilla kredenzte uns einen Phönix, den sie im Morgengrauen auf dem Berge Kaf erlegt haben musste, dazu Reis, Korn für Korn von den Reisterrassen Chinas herbeigetragen. So jedenfalls kam es uns vor. Der Geruch gerösteter Mandeln und der ferne Duft von Mandarinen kräuselten sich über dem weichen Dunst des Reises. Pfefferminze beschrieb eine scharfe Kurve um sie herum und blieb neben ihnen stehen. Während sich das Aroma von Pflaumen in unseren Nasenhöhlen sammelte, sauste der Jasmin davon wie ein weißer Papierflieger. Ein Geruchsreigen, dem man mit bloßer Nase nicht mehr zu folgen vermochte. Und der Geschmack erst!
»Als würde man die Mandarinen nicht essen, sondern mit geschlossenen Augen durch einen Mandarinengarten spazieren«, sagte ich.
Madame Lilla amüsierte sich königlich. »Wie schön Sie das gesagt haben! Sind Sie Schriftstellerin?«
»Nicht ganz, aber das ist der Plan.« Das war alles, was ich an Humor zusammenkratzen konnte. »Und Sie?«
»Schauspielerin! Habe ich recht?«, fiel Amira mir aufgeregt ins Wort.
»Ach«, antwortete die alte Dame mit enttäuschtem Gesicht und fuhr, nachdem sie uns mit einer wohl bemessenen Kunstpause auf die Folter gespannt hatte, fort: »So habe ich mir unser erstes Gespräch aber nicht vorgestellt.«
Ja, wie denn dann?
»Ich meine, wo wir uns doch auf so außergewöhnliche Weise kennengelernt haben. Es ist ein bisschen … wie soll ich sagen? Lassen Sie uns nicht sein wie alle anderen. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich mir bereits ein paar Gedanken über unser erstes Treffen gemacht habe.«
Das konnte man wohl sagen!
»Ich schlage vor, dass jede von uns eine Szene aus einem Film erzählt. Nehmen wir an, unser Leben wäre ein Film und wir wollten mit der spannendsten Szene beginnen – welche wäre das dann?« Sie ließ ihren Blick über unsere Gesichter wandern. Dann begann sie zu erzählen.
»Es ist Nacht. Überall Bäume, ein Wald oder so …«
Als wir unsere Münder wieder zubekamen, schauten wir einander an, ob nicht eine von uns etwas Scharfsinniges zu sagen hätte. »War das die Wahrheit?«, fragte ich.
»Nicht ganz! Aber das ist der Plan!«, lachte sie heiser.
»Der Tahrir-Platz!«, sagte Maryam mit einer Stimme, die tief vom Meeresgrund an die Wasseroberfläche aufzusteigen schien. »Der Tahrir-Platz! Er ist in gelbes Licht getaucht. Es ist der Tag, an dem Mubarak gestürzt worden ist. Der Abend dämmert bereits. Die Kamera zeigt ein Auto. Darin, neben mir, ein Mann. Ein guter Freund … Wir fahren. Wir haben getrunken, sind leicht beschwipst. Aber wir wollen unbedingt zum Tahrir-Platz. Als wären wir Süchtige. Wir haben es eilig. Solange wir nicht dort sind, haben wir Angst, in den Weltraum zu fallen. Nur auf dem Tahrir-Platz können wir uns an der Erdoberfläche festhalten. Inzwischen kommen alle aus diesem Grund dorthin. Eigentlich ist die Revolution ja beendet, aber das wollen wir uns nicht eingestehen. Ich trage ein Geheimnis mit mir herum. Keiner weiß davon. Auf dem Tahrir-Platz wiegt mein Geheimnis weniger schwer, das kann man meinem Gesicht ablesen. Nahaufnahme. Wir kommen am Platz an. Wir sind überglücklich. Wir fliegen. Wir singen. Die Kamera zeigt in schneller Folge, wie alle einander umarmen. Ich umarme niemanden. Mir ist zum Weinen zumute. Vor Glück, aber auch vor Trauer. Es ist beides zugleich. Dann ein Schnitt, wir stehen am Anfang einer der Straßen, die auf den Platz münden. Jetzt ist ein Straßenhund im Bild. Immer noch das gelbe Licht. Der Hund begreift nicht, was los ist. Er ist verstört. Alle sind glücklich, aber niemand sagt ihm, wieso. Er ist einsam. Ich gehe los. Die Kamera zeigt mich von oben, ich arbeite mich durch die Menge zu ihm vor. Meine Lunge weitet sich. Luft strömt in mich hinein. Ich laufe schneller. Endlich habe ich den Hund erreicht und bleibe stehen. Er schaut mich an, so ruhig, als würde Ägypten nicht gerade in sich zusammenfallen. Er starrt vor Schmutz, ist ausgemergelt, hat räudiges Fell. Er wedelt zögernd mit dem Schwanz. Ich fange an zu weinen. Setze mich aufs Pflaster. Der Hund bleibt, wo er ist. Ich schließe ihn in meine Arme. Der Hund lehnt seinen Kopf an meinen. Da kommt ein Mann. Als würde er über Wasser laufen. Ein alter, armer Mann in grauem Umhang. An seinem schmutzigen Turban ein Ölzweig. Um seinen Hals ein Schild mit der Aufschrift ›Gerechtigkeit‹. Er legt mir eine Hand auf den Kopf, die andere dem Hund. Ich schaue ihn an. Er schließt die Augen. ›Es ist Zeit zu gehen‹, sagt er. ›Dein Geheimnis ist zu groß für dieses Land.‹ Als ich am nächsten Tag ein Ticket in den Libanon kaufe, ist der Film zu Ende.«
»Ist das die Wahrheit?«, fragte ich wieder. Maryam lächelte nur und nahm wieder ihre gewohnt lässige Sitzhaltung ein.
Während Amira die Reiskörner auf ihrem Teller hin und her schob, begann sie mit ihrer Szene. »Sie schlagen auf mich ein. Die Kamera zeigt ihre Gesichter nicht. Ich aber will und will nicht sterben. Ich bin so erstaunt darüber, dass ich noch immer nicht tot bin, dass ich nicht einmal Schmerzen verspüre. Sie schlagen mir mit voller Kraft in den Bauch. Wahrscheinlich weil sie denken, dass ich schwanger bin. Schließlich bin ich Tänzerin … Rückblende: Tanzszenen, ich werde von der Bühne gezerrt und in ein Zimmer eingeschlossen. Dabei bin ich gar nicht schwanger. Jetzt sieht man auch ihre Gesichter. Mein Vater und meine beiden Onkel. Die Kamera schwenkt auf meine Mutter. ›Hört auf!‹, schreit meine Mutter durch die verschlossene Tür. Ich zähle mit. Man sieht es daran, wie ich die Lippen bewege. Viermal schreit sie. Wieso nicht fünfmal, geht es mir durch den Kopf. Weshalb versucht sie nicht die Tür aufzubrechen? Das denke ich. Ich weine nicht, ich schreie nicht. Meine Hand in Nahaufnahme. Ich halte meine Hose fest. Aus Angst, sie könnten meinen Stringtanga entdecken. Wenn man geschlagen wird, dann wächst man. Anstatt zusammenzuschrumpfen, wird der Körper größer und größer. Dass mein Körper so viele Stellen hat, die man schlagen kann … Dann lassen sie von mir ab. Das lang gezogene Quietschen einer Tür. Die Tür bleibt offen stehen. Einige Zeit vergeht. Wie viel, das weiß ich nicht. Mein Atem hört sich an wie der eines Tieres. Ich stehe auf. Das Gesicht meiner Mutter in Nahaufnahme, sie ist vor der Tür zusammengebrochen und weint. Ich streichele ihr über den Kopf und gehe an ihr vorbei. Nach draußen. Schnitt. Ich auf einer Fähre nach Italien. Sie wollen mich töten, ich fliehe. Schnitt. Ich in Frankreich. Schnitt. Ich in England. Ich habe Sehnsucht. Ich habe solche Sehnsucht. Da kommt eine SMS. ›Es ist Revolution‹, steht da. ›Das ist die Gelegenheit. Ich gehe von hier fort. Ich lasse Briefe für dich da.‹ Dann ein letzter Schnitt, und ich bin wieder in Tunis. Ich frage überall herum. Doch er ist weg. Er ist mit anderen aufs Meer hinausgefahren und seitdem verschollen … Das war’s.«
»Das ist die Wahrheit«, flüsterte ich Maryam zu. Damit sie verstand, warum Amira abends auf der Terrasse geweint hatte.
Madame Lilla seufzte tief. »Meine Damen«, sagte sie, so wie sie uns von nun an stets ansprechen würde, »meine Damen … man sieht sich im Leben nur einmal in der Totale. Den Rest des Lebens verbringt man entweder damit, zu dieser einen Szene zurückzufinden, oder vor ihr davonzulaufen. Sie alle scheinen mir ihre große Szene bereits erlebt zu haben. Ich denke, Sie verstehen, wovon ich spreche.«
Sie wandte sich mir zu und lächelte mit spitzen Lippen. Sicher wollte sie jetzt nach meiner Szene fragen. Mit einer geschickt platzierten Gegenfrage kam ich ihr zuvor. »Und Sie, Madame Lilla? Laufen Sie davon, oder versuchen Sie zurückzufinden?«
Anstelle einer Antwort hob Madame Lilla mit nur einem Blick Amiras gesenktes Haupt. Für sie schien sie sich, warum auch immer, am meisten zu interessieren.
»Liebe Amira, ich glaube, ich werde mich gut mit Ihnen verstehen. Mit Ihnen beiden natürlich auch … Aber Amira ist nun einmal Tänzerin!«
Wie jung Amira doch war. Das Leben würde sie noch oft zum Tanz auffordern. Es würde sie immer wieder von sich wegstoßen und dann wieder lockend »Komm« flüstern, und sie würde wieder lächelnd »Okay« sagen. Maryam schien es gar nicht zu gefallen, dass Madame Lilla Amira so viel Aufmerksamkeit entgegenbrachte. Sie wirkte angespannt wie ein eifersüchtiger Ehemann.
»Nun, wie es aussieht, muss ich Ihnen doch noch einige Dinge erzählen«, sagte Madame Lilla. Sie reichte uns drei Briefumschläge. Eine neue Speisekarte.
Menü:
Fliederdornenbörek – Kohlkuchen mit Nüssen
Als Dessert in Chilischokolade gegarte Birne
Fliederdornen?!
»Allerdings werden wir das natürlich nicht alles noch heute Abend besprechen können. Ich hoffe, Fliederdornen sind nach Ihrem Geschmack?«
So zog Madame Lilla, die wir bisher nur für eine ebenso elegante wie außergewöhnliche Romanfigur gehalten hatten, uns in ein Spiel hinein, das von vorneherein nichts Gutes verhieß. Der Rest des Essens gestaltete sich eher hektisch. Madame Lilla warf uns regelrecht hinaus, sodass uns der Abend im Halse stecken blieb.
Ayyub begleitete uns zur Eingangstür. Sein Blick gefiel mir ganz und gar nicht, obwohl – oder gerade weil – ich ihn beim besten Willen nicht deuten konnte. Er glich einem Galeerensträfling, der zwar aus freien Stücken bei Madame Lilla angeheuert hatte, vom alleinigen Rudern aber völlig entkräftet war. »Bis übermorgen«, sagte er, als er die Tür hinter uns schloss. Ayyub hatte die geduldige Eleganz von Männern, die alles wissen, und das Selbstvertrauen des Butlers, der hinterher immer der Mörder ist.
Als wir das Hotel betraten, blieb Amira noch einmal stehen, als habe sie uns eine wichtige Mitteilung zu machen. »Jasmin wächst gar nicht einfach von allein, wie Madame Lilla behauptet hat.« Als wäre dies das einzig Sonderbare, das sich an diesem Abend ereignet hatte, sagte sie ernst: »Man nimmt einen Jasminzweig, ohne ihn abzubrechen, bedeckt ihn mit Erde und lässt die Spitze herausschauen …« Sie bog ihren Arm, um uns zu demonstrieren, wie die entsprechende Krümmung auszusehen hatte. »Erst wenn der Zweig Wurzeln zu schlagen beginnt, wird er von der Mutterpflanze abgetrennt. Jasmin wächst nicht einfach so. Das ist ein Mutter-Tochter-Verhältnis.« Den letzten Satzteil flüsterte sie noch einmal vor sich hin: »Ein Mutter-Tochter-Verhältnis …«
In dem sicheren Wissen, was wir am übernächsten Abend essen würden, doch vollkommen ahnungslos, was uns sonst noch bevorstand, zogen wir uns in unsere Zimmer zurück. Wir waren wie drei auf den Rücken gefallene Kellerasseln. Noch wussten wir nicht, dass wir den Schlag, der uns wieder auf die Füße bringen sollte, schon bald einstecken würden.