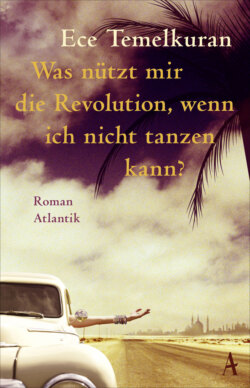Читать книгу Was nützt mir die Revolution, wenn ich nicht tanzen kann - Ece Temelkuran - Страница 9
4. Kapitel
ОглавлениеKrach! Bumm! Zack! Rumms!
Als ein blauer Peugeot 406 plötzlich scharf bremst, fährt der Mercedes hinter ihm auf und wird seinerseits von einem Renault gerammt. Das Motorrad, das zuletzt herangeschlingert kommt, prallt gegen die hintere Stoßstange des Renaults, verliert das Gleichgewicht und kippt zur Seite. Während der Motorradfahrer sich aufrappelt, springen die anderen Fahrer aus ihren Autos. Ganz vorne ein junger, nur aus Sonnenbrille bestehender Don Juan, hinter ihm eine Dame aus der High Society, ganz hinten ein Mann mittleren Alters in geschniegeltem Anzug und mit Gebetskäppchen. Der Motorradfahrer trägt das lange Gewand eines Salafisten. So beginnt das Tohuwabohu, über dessen Verschulden die gesamte Straße noch den ganzen Tag lang debattieren wird. Die Polizei lässt auf sich warten, sodass das Militär sich der Sache annimmt. Und weil sich auf dem Boulevard Bab Benet auch das Justizministerium und diverse Gerichte befinden, sind gleich jede Menge Anwälte zur Stelle, die mit ihren zerknitterten Krawatten aussehen wie Schuljungen, die gerade vom Fußballspiel kommen. Die Cafébesitzer finden sich zu einer Untersuchungskommission zusammen. Wir dagegen machen uns mit Unschuldsmiene klammheimlich davon, als hätten wir mit alldem nicht das Geringste zu tun. Dabei hatte der Tag so friedlich angefangen.
*
Als ich morgens in den Hof herunterkam, saßen Amira und Maryam schon beim Frühstück. Amira schien es eilig zu haben, Maryam dagegen stocherte auf ihrem Teller in einem Berg von Zeit herum. Amira hatte sich mit Halskette, Lippenstift und dezentem Dekolleté offenbar für einen wichtigen Tag gerüstet.
»Und, was habt ihr heute vor?«, fragte Maryam.
Während ich tief in meine Kaffeetasse schaute, sprudelte es aus Amira heraus: Sie wolle zu den Leuten von Nawaat, die mit ihrem Blog viel für die Revolution getan hätten. Möglicherweise würden die ihr einen Job anbieten. Aber sie müsse dort sowieso etwas abholen. Danach wolle sie ins Hamam. Nein, nicht um sich abschrubben zu lassen, sondern aus beruflichen Gründen. Vielleicht könne sie da ja vor Touristen als Bauchtänzerin auftreten – und, und, und … Als sie dann fragte: »Was sind denn eure Pläne?«, drucksten wir herum wie zwei stotternde Tattergreise, die abends auf dem Sklavenmarkt noch keinen Abnehmer gefunden haben. »Kommt doch einfach mit«, sagte sie, und so machten wir uns auf den Weg.
Am Kasbah-Platz beschlossen wir, uns noch einen Kaffee zu holen. Von den zahlreichen Cafés, die sich am Straßenrand aneinanderreihten, hatte Amira sich ausgerechnet das ausgesucht, in dem nur Männer saßen. Kaum waren wir eingetreten, breitete sich Schweigen aus.
Amira ging hinter ihrem Dekolleté in Deckung und rief dem Cafébesitzer zu: »Drei Espressi!«
Während Maryam die Hände in die Hosentaschen steckte und sich in einen Mann verwandelte, schaute Amira sich, einer Venusstatue gleich, seelenruhig um. Ich suchte mir einen sicheren Ort, auf den ich meinen Blick richten konnte: die Weltzeituhren an der Wand. Was hatten solche Uhren in diesem altmodischen Café zu suchen? Wozu brauchten Männer, die so aussahen, als würden sie alle Zeit der Welt damit verbringen, im Café zu hocken, Weltzeituhren? Außerdem waren die Uhren längst stehengeblieben. Die männlichen Angehörigen einer Nation, die einst den Blick nach Westen gerichtet hatte, kehrten der Kolonialgeschichte nun undankbar den Rücken und taxierten stattdessen uns. Da kam ein Mann mittleren Alters in traditionellem Kapuzengewand raschen Schrittes auf uns zu. Einen Augenblick lang blieb er unschlüssig vor uns stehen. Er wusste wohl nicht recht, wen er ansprechen sollte. Schließlich entschied er sich für mich.
»Meine Dame, das hier ist ein Männercafé.«
Noch bevor ich den Mund aufmachen konnte, reagierte Amira auf diese doch reichlich vorhersehbare Attacke. »Was soll das heißen, Männercafé? Für wen hältst du dich? So etwas gibt es bei uns in Tunesien nicht! Höchstens in eurer Phantasie! Wir sind ein laizistischer Staat!«
Während sich die anderen Gäste nach und nach erhoben und sich die statische Spannung in kinetische Energie umwandelte, stellte der Cafébesitzer hastig die Espressi auf den Tresen. Maryam trat zwischen Amira und den Angreifer – schließlich war sie der Mann unter uns, und außerdem trug sie als Einzige ein Kopftuch.
Aber Amira richtete noch immer ihren geballten Zorn auf den Mann, der fast schon gewillt schien, die weiße Fahne zu hissen. »Wir haben einen Diktator in die Wüste geschickt! Und jetzt kommst du daher! Was glaubst du eigentlich, wer du bist?«
Der Mann war drauf und dran, sich zu entschuldigen, aber Amira war nicht zu bremsen.
»Sind wir hier im Iran? Was soll das heißen, Männercafé! Noch dazu in der Kasbah! Hier, wo Leute wie ich für euch ihr Blut vergossen haben. Wir haben eine Revolution für euch gemacht. Und jetzt werden wir von dir …«
Endlich bekam Maryam sie so weit in den Griff, dass wir uns zur Tür wenden konnten. Sie selbst blieb zurück und drückte dem Mann entschuldigend etwas in die Hand. Das befremdete mich. Gut, Amira hatte den Bogen vielleicht etwas überspannt, aber Maryams plötzliche Kollaboration mit dem Patriarchat …
»Was hast du ihm gegeben?«, fragte ich, doch sie lächelte nur.
Der Mann trat mit uns hinaus auf die Straße, schaute sich die Praline an, die er in der Hand hielt, und wickelte grummelnd das Papierchen ab. Kaum aber hatte er sie in den Mund gesteckt, da schleuderte er sie auch schon wieder in hohem Bogen von sich. »Ihr Huren! Da ist ja Alkohol drin!«
Währenddessen blieb das Schokoladenpapierchen auf der Scheibe eines Peugeot 406 kleben, der Peugeot bremste scharf … und den Rest kennen Sie ja schon.
»Du bist ja die reinste Ritterin«, attestierte ich Maryam. Sie verbeugte sich.
»Stets zu Diensten, mylady.«
Während wir uns in dem engen Treppenhaus auf dem Weg zum Büro von Nawaat gegenseitig knufften und miteinander lachten, geschah etwas, das sich nicht in Worte fassen lässt. Eine Entwicklung, auf die man nicht mit dem Finger zeigen kann. Kristallene Spinnen umwoben uns mit einem Netz, rasch und voller Begeisterung. Es gelangte etwas zur Reife in diesem Treppenhaus – etwas, das im Entstehen begriffen war, während wir das Hotel verließen, nebeneinander herliefen, uns auf dem Kasbah-Platz gegenseitig unterstützten, ins Café gingen, uns dort, in dieser unsichtbaren Arena, füreinander einsetzten, unsere Kaffeebecher nahmen, tranken, merkten, was wir angerichtet hatten, uns aus dem Staub machten und schließlich in dem Treppenhaus landeten. Als wir das Büro von Nawaat betraten, waren wir drei längst Freundinnen.
»Wir haben dich am Lachen erkannt«, sagte ein mittelblonder, verschlossen wirkender Mann, der, obwohl Araber, wie ein Ire aussah. Zusammen mit einem blutjungen, schlanken Mädchen mit Kopftuch und einem jungen Mann, den eine Alkoholfahne umwehte, waren sie zu dritt in dem Büro. Wir wurden einander vorgestellt, doch ich hörte mir nicht einmal ihre Namen an. Ich hatte mir vorgenommen, in Zukunft weder Aufmerksamkeit zu erregen, noch selbst aufmerksam zu sein. Schließlich war ich arbeitslos und darum bemüht, meinen Kontakt zur Außenwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken. Amira und Maryam dagegen beteiligten sich sogleich eifrig am Gespräch. Es ging um Ägypten, die Demonstrationen in Bahrain, die Internetaktivisten, die beim Aufstand gegen Assad in Syrien inhaftiert worden waren, die Wahl in Tunesien und neue Publikationen aus Beirut. Es war, als hielten sie die Welt wie Knetmasse in ihren Händen, als formten sie mit ihren Fingern das Gebiet des Nahen Ostens. Sie waren ernst, aber nicht schlecht gelaunt. Zigaretten wurden angezündet, Zigaretten erloschen. Ich verstand nichts – nur Namen und Stichwörter, die immer wieder fallengelassen wurden. Alle nannten einander bei ihren Twitter-Nicknames. Sie sprachen von einer erdumspannenden digitalen Membran, bestehend aus Daten, die von Weltraumsatelliten überallhin geschickt wurden. Eine elektronische Hülle für den Planeten, auf der jeder Mensch nur einen Pixel darstellte. In ihrer Welt war jeder ein Codename, jeder Codename eine politische Aktivität, jede politische Aktivität – die im Klappern auf Computertastaturen und dem Tippen auf Telefondisplays bestand – eine blinkende Existenz. Sämtliche Namen, Pixel und elektronische Identitäten waren über das Wörtchen al-Thawra, Revolution, miteinander verbunden. Es war eine neue Welt, in der sie selbst die Helden waren.
Ich ließ mich von ihrem Gespräch berieseln, da wandte der Ire sich plötzlich an mich: »Und wie sieht man das in der Türkei?«
Ich rappelte mich aus meiner in die Waagerechte abgeglittenen Sitzhaltung hoch und sagte: »Na ja, besonders viel sieht man da nicht. Auch wenn ihr die ganze Zeit von Revolution und so redet …« Mein spöttisches Lächeln blieb in der Luft hängen. Ich riss mich also zusammen und setzte widerstrebend zu einer Erklärung an: »In der Türkei glaubt man nicht daran, dass die Araber etwas ändern können. Die meisten denken, dass die CIA dahintersteckt. Aber wenn man euch reden hört, dann macht ihr einen so hoffnungsvollen Eindruck. In der Türkei ist das anders. Bei uns sind komplizierte Dinge passiert … schwer zu erklären.« Alle hörten mir wie gebannt zu. »Die Türkei ist nicht so, wie es von außen den Anschein hat. Journalisten, Gewerkschafter, Studenten – alle sitzen im Gefängnis. Es findet ein Prozess nach dem anderen statt. Vor lauter eigenen Problemen haben wir den Rest der Welt vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren.« Ich ging mir selbst auf die Nerven, aber die Sache wurde immer ernster.
»Könnte die Türkei denn deiner Meinung nach als Modell herhalten, so wie die gemäßigten Islamisten es immer wieder fordern?«, fragte der Ire.
Zum Glück hielt Amira es nicht mehr länger aus. »Übrigens, Leute, ich brauche einen Job.«
Das Mädchen mit dem Kopftuch lächelte bedauernd. Der Ire sagte: »Wie ärgerlich. Wir haben gerade erst jemanden eingestellt. Aber wer weiß? Momentan schießen doch überall ausländische NGOs wie Pilze aus dem Boden.« Und mit einem spöttischen Seitenblick auf Maryam fügte er hinzu: »Als einziges erfolgreiches Beispiel für den Arabischen Frühling wird Tunesien richtig aufpoliert.«
Maryam revanchierte sich postwendend. »Danke, ist angekommen. Aber Ägypten ist nicht Tunesien. Und ist eure Revolution überhaupt eine?«
»Eure Arroganz wird euch noch teuer zu stehen kommen«, erwiderte der Ire.
»Das ist doch keine Arroganz«, fuhr ihn Maryam an: »Hat man jemals eine so gesittete Revolution wie eure gesehen? Nach nur zwei Wochen war Ben Ali abgetreten. ›Bitte, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich eben.‹ Das wäre bei Husni Mubarak unvorstellbar gewesen.«
»Das Problem ist nicht Mubarak«, stichelte der Ire weiter. »Ihr hättet erst mal nachdenken sollen, anstatt mit dem Militär zu kooperieren und die Revolution der ägyptischen Armee zu überlassen.«
»Wir haben Mubarak in die Wüste geschickt, wir werden auch noch die Militärs davonjagen!«
»Das schafft ihr nicht. Die werden von den USA unterstützt. Sobald die Wahlen beginnen, verschwinden die internationalen Fernsehsender vom Tahrir-Platz. Dann steht ihr mutterseelenalleine da. Ihr seid eben naiv und habt keine klaren Forderungen. Da musste es ja so weit kommen.«
Maryam erhob ihre Stimme, brüllte jetzt fast. »Wir haben sehr wohl klare Forderungen! Freiheit und Menschenwürde!«
»Was bedeutet schon Menschenwürde?«, fuhr der Ire, der offenbar irgendwo gelernt hatte, dass man wütende Frauen durch Senken der Stimme erst recht auf die Palme bringen kann, seelenruhig fort. »Wer soll sie euch geben? Von wem erwartet ihr sie? Ihr habt euch doch vom Westen immer nur gängeln lassen.«
Maryam war vor Wut dunkelrot angelaufen. »Du tust uns unrecht!«, schrie sie. »Und das weißt du auch!«
Jetzt hatte der Ire offenbar sein Ziel erreicht, also sagte er mit freundlichem Lächeln: »Ich gehe uns erst mal einen Kaffee machen.«
So glätteten sich die Wogen wieder – bis er Amira, schon auf dem Weg in die Küche, zurief: »Es hat sich also ausgetanzt, was?« Doch Amira biss sich nur auf die Zunge und schwieg.
*
Ich sah Maryam an. Etwas nagte an ihr. Amira saß da wie eine Verbrecherin. Versuchte, sich aus ihrem Loch herauszuarbeiten.
»Nein, ich meine, das weiß er doch«, redete Maryam ins Blaue hinein. »Er hat die ganzen Aktionen ja selbst organisiert. Er war es doch, der Websites lahmgelegt und Wikileaks-Dokumente veröffentlicht hat. Der will mich bloß provozieren. Die Revolution ist in den Menschen. Das weiß er doch auch. Nichts wird mehr so sein wie früher.«
Als der Ire mit dem Kaffeetablett wiederkam – er balancierte es mit Todesverachtung, um klarzustellen, dass er da gerade Frauenarbeit verrichtete –, rief er Maryam zu: »Sagten Sie etwas, wertes Fräulein?«
»Allerdings«, feuerte Maryam zurück. »Eure Revolution, sagte ich, hat erst dann ihr Ziel erreicht, wenn du eines Tages in der Lage bist, mit einer Revolutionärin und Tänzerin zu sprechen, ohne irgendwelche Gemeinheiten von dir zu geben.«
Damit stand sie auf. Auch wir erhoben uns – eine dreiköpfige, disziplinierte Kommandoeinheit – und wollten gehen. Doch der Ire hielt Amira am Arm zurück und flüsterte ihr etwas zu. Dann holte er einen Stapel Briefumschläge aus einer Schublade und drückte sie ihr in die Hand. Während Amiras Augen sich mit Tränen füllten, verließen wir fluchtartig das Büro. »Ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen«, sagte Amira, wie um sich zu rechtfertigen – nicht vor mir, sondern vor ihrer Beschützerin Maryam. »Treffen wir uns in zwei Stunden im Hamam. Ihr wisst wo, gleich neben dem Hotel.«
Auf dem Rückweg sagte ich zu Maryam: »In ein paar Tagen fahre ich. Was ist mit dir? Bleibst du noch?« Sie zog ihr Kopftuch herunter und schlang es sich um den Hals. »Weiß nicht. Ich will mir noch ein paar von Didos Schrifttafeln und einige Bibliotheken anschauen. Danach muss ich wohl auch wieder zurück …« Sie stockte, wechselte abrupt das Thema. »Warum begeht eine Frau, die über unermessliche Macht verfügt, deiner Meinung nach Selbstmord?«
Ich musste sofort an Amira denken. »Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat Amira irgendwelche Sorgen, von denen sie uns nichts sagt.«
Maryam lächelte. »Eine Frau, die in einem arabischen Land als Tänzerin arbeitet und Blogs schreibt? Die noch dazu gerade erst aus dem Exil zurückgekehrt ist? Ist doch klar, dass sie Sorgen hat!«
»Nein«, entgegnete ich, »da steckt noch etwas anderes dahinter.«
»Mir hat sie heute Morgen gesagt, dass sie eine Tanzschule aufmachen will.«
»Eine Tanzschule? Hm, das ist doch gut.«
»Ja, allerdings fehlt ihr das Geld. Ihre Mutter hat zwar welches, gibt ihr aber keins. Jetzt spart sie das, was sie im Hamam verdient. Aber da … wie hat sie es ausgedrückt? … da wird sie nicht respektiert.«
»Also, was das Arbeiten angeht, habt ihr es hier wirklich nicht leicht. Eure Länder sind die reinsten Männercafés.«
Die langen Mittagsstunden vergingen so, wie sie es eben tun, wenn man sich auf einem kühlen Bett ausstreckt und sich darin herumwälzt, bis das Laken unerträglich warm geworden ist, während man die Staubkörnchen beobachtet, die im durch die Vorhänge sickernden Licht schwerfällig herumtanzen. Maryam betete so lange, wie ich noch nie jemanden hatte beten sehen, dann surfte sie im Internet. Bis wir uns mit Amira im Hamam trafen, wo sich lustige Szenen abspielen sollten, glich alles einem langweiligen Theatermonolog.