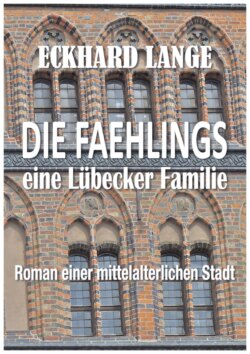Читать книгу Die Faehlings - eine Lübecker Familie - Eckhard Lange - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dreizehntes Kapitel: August 1181
ОглавлениеDer Juli war nun fast zu Ende, für Dietmar wurde es Zeit, noch einmal aufzubrechen, ehe die ersten Herbststürme über das Meer fegten. Die anderen Kaufleute waren bereits unterwegs, so kamen nur wenige Schiffe zusammen für eine gemeinsame Fahrt. Noch immer galt der Brauch der Schwurgemeinschaft, zusammenzuhalten auf der weiten Reise und darum auch zusammen zu segeln zu gemeinsamem Schutz. Wieder sollte es nach Gotland gehen. Dort hatten die deutschen Händler in Visby eine feste Niederlassung mit Kaufhaus und Kirche, und manche von ihnen lebten ständig dort. Ein Ältermann sorgte für Frieden, nicht nur unter dem Schiffsvolk, sondern auch mit den gotländischen Händlern, die oftmals die deutsche Konkurrenz argwöhnisch betrachteten. Dabei hatten sie beide ihren Vorteil, seitdem auch Kaiser Barbarossa noch einmal alle Privilegien bestätigt hatte, die einst von seinem Vetter Heinrich beiden gewährt wurden, gotländischen und deutschen Kaufleuten – wobei deutsch immer mehr mit lübisch gleichzusetzen war.
Dietmar war nun an sechs Schiffen beteiligt, die meisten gehörten ihm zusammen mit den Brüdern Jannes und Simon. Auch von den drei Schiffen, die in den nächste Tagen auslaufen sollten, waren zwei aus ihrer Flotte. Dietmar war nun viel am Hafen, um alles zu regeln. Auch diesmal trug die Knorr, auf der er reisen wollte, nicht nur seine Waren – es wäre ein viel zu großer Verlust, sollte das Schiff verlorengehen. Neben einigen Lübischen Kaufleuten hatten auch drei Händler aus Bardowieck Frachtraum gemietet. Sie gehörten zwar nicht zur Schwurgemeinschaft der Kaufleute, waren aber doch in der gemeinsamen Gilde der Gotlandfahrer und hatten so einige Rechte auch in Lubeke, obwohl sie dort nicht ansässig waren und folglich keinen Bürgereid geleistet hatten. Dietmar würde ihre Waren in Visby dem dortigen Agenten der Bardowiecker aushändigen. Ein Teil des Frachtraumes stand außerdem dem Schiffsvolk zu, falls die Schiffsknechte auf eigene Rechnung einige Waren mitnehmen und am Ziel verkaufen wollten. Dietmar hat das stets gefördert, war doch mancher einfache Seemann so zu einem Händler herangewachsen, der dann auch Mitglied der Gotlandfahrer werden konnte. Aber die meisten Matrosen hatten weder ausreichend Kapital noch den Wagemut, neben ihrem vereinbarten Lohn auf zusätzlichen Gewinn zu setzen.
An diesem Morgen überprüfte er noch einmal die eigenen Waren, mit denen er in Visby handeln wollte. Da waren zunächst die festverschnürten Ballen mit feinem flandrischen Tuch, ein im Norden ebenso begehrtes Gut wie die in hölzerne Kisten verpackten Schwerter und Lanzenspitzen, Brustpanzer und Kettenhemden, die er von Kölner Kaufleuten erworben hatte. Daneben ließ er eine ganze Reihe von Fässern mit Salz aus Lüneburg an Bord bringen, denn es diente sowohl als Gewürz als auch als Konservierungsmittel für den Fisch, den er einzukaufen gedachte. Alles musste gut verstaut werden, auch durfte die Knorr nicht überladen werden, denn sein Schiffsführer haftete für Schaden, wenn wegen zu großen Tiefgangs Fracht verloren ging. Aber letztlich wäre es auch sein Verlust, und so ließ er wie stets das beladene Schiff von einem Prüfer der Gilde freigeben.
Zufrieden kam Dietmar zurück, eine letzte Nacht würde er mit Katharina und den drei Kindern verbringen, dann würden sie die Trave abwärts fahren, teils unter Segeln, teils vom Ufer aus gezogen oder von den Schiffsknechten gerudert. Zwar hatte die Knorr längst nicht so viele Plätze für Ruderer wie die schmalen Langschiffe, aber ganz ohne ihre Hilfe kam man vor allem auf den Binnengewässern doch schlecht voran. Ein letzter Blick noch an den abendlichen Himmel, ehe er das Haus betrat: Das Abendrot verhieß einen sonnigen Tag, der Wind wehte mäßig, aber günstig aus dem Westen. Sie würden also schnell vorankommen, sobald sie die offene Bucht vor der Travemündung erreicht hatten. Katharina hatte gewürzten Brei aufgetischt, dazu ein ordentliches Stück Braten – es sollte ihm den Abschied leichter machen und, so hoffte sie insgeheim, in ihm die Sehnsucht nach Heimkehr wecken. Wie immer hatte sie eine unausgesprochene Angst, ihr Eheherr könnte, von Abenteuerlust gepackt, über Gotland hinaus das östliche Meer bis nach Livland oder noch weiter befahren und sie vielleicht für immer verlassen. Doch Dietmar hing viel zu sehr an den Kindern und an seinem Weib, und er zeigte es ihr noch einmal in der Nacht auf dem gemeinsamen Lager.
Die Sonne hatte kaum die erste Dämmerung hervorgebracht, da schritt der Kaufherr bereits eilig die Alfstraat zum Hafen hinab. Er sprang hinüber auf seine Knorr, und die drei Schiffe legten ab, die Schiffer drehten sie flussabwärts, nach und nach nahmen sie Fahrt auf, passierten die Burg und, getrieben vom Ruderschlag der Schifferknechte, glitten sie über die Trave in Richtung See. Nach einer Weile tauchte zur Linken der verfallene Wall des alten Liubice auf, dann trat das hohe Ufer zur Rechten weit zurück, Röhricht, Sumpf und kleine Wasserflächen kamen in Sicht. Endlich weitete sich der Fluß zur Förde, zu beiden Seiten die Hütten von Fischerdörfern. Nun konnten sie Segel setzen, das Tuch unter den Rahen spannte sich, der aufkommende Wind trieb die Schiffe voran. Hier und da verengte sich die Förde, schlang sich dann in einem scharfen Knick um einen vorspringenden Hügel, danach wieder weite Wasserflächen, bis die Trave sich noch einmal durch einen Strandwall zwängen musste. Die Steuerleute achteten sorgfältig darauf, die Mitte des Flusses einzuhalten, und endlich tat sich vor ihnen die weite Bucht der Ostersee auf.
Der Himmel war wolkenlos, die Schiffer konnten sich nach der Sonne richten und deshalb größeren Abstand vom Ufer halten als sonst, wenn sie nur auf wichtige Landmarken angewiesen waren. Dennoch stand einer der Matrosen am Vordersteven und ließ in regelmäßigen Abständen das Lot ins Wasser, rief dem Steuermann die gemessene Tiefe zu, denn der Grund der Bucht war tückisch, oft trieben Wind und Strömung den Sand, den sie den hohen Uferkanten raubten, irgendwo zusammen. Doch wollten die Reisenden möglichst nahe an der Küste bleiben, statt ins tiefe Wasser auszuweichen. Noch immer herrschte Westwind, so dass die drei Schiffe in großem Abstand vor dem Wind fahren konnten. Gegen Abend querten sie eine weitere Bucht, um zu einer waldreichen Insel zu gelangen, dort warfen sie dicht unter dem Steilufer Anker, um die Nacht abzuwarten.
Am nächsten Morgen hatte der Wind aufgefrischt, die Wellen warfen Schaumköpfe, auch am Himmel zogen dichte Wolken auf. Vorsichtig lenkten die Steuerleute ihre Schiffe in nördliche Richtung, die Segel knatterten unter dem Druck, aber sie machten nun gute Fahrt. Die Sonne war schon in den Westen gewandert, der Wind hatte stetig zugenommen, wehte nun fast mit Sturmstärke. Da beschloß der Schiffer der voraussegelnden Knorr, das Tuch zu reffen und in einer weiteren Förde Schutz zu suchen und dort die Nacht zu verbringen. Die beiden anderen Schiffe folgten.
Nach zwei weiteren Tagen erreichten sie die Hedinsinsel, die zum Gebiet der Ranen gehörte. Noch vor einem Jahrzehnt begann hier der gefährlichste Abschnitt der Gotlandfahrt, denn die Ranen waren bis dahin ein wildes, heidnisches Volk, erfahren in der Seefahrt und zugleich gefürchtete Piraten. So manches Schiff liegt vor der Insel auf Grund, ausgeraubt und verbrannt. Doch König Waldemar hatte sie mit einem dänischen Heer endgültig besiegt und seinem Reich einverleibt, Klöster und Kirchen gestiftet und das slawische Volk für den wahren Glauben gewonnen. Dennoch blieb die Schiffahrt hier voller Gefahren, musste man doch das hoch aufragende Kap umfahren, auf dem einst die Tempelburg des vierköpfigen Swantewitt stand, und hier sprangen Wind und Strömung umher wie junge Fohlen.
Danach ging die Fahrt hinaus aufs offene Meer, und erst die große Inseln Bornholm bot den Seefahrenden Schutz, frisches Wasser und die Möglichkeit, Nahrung zu kaufen. Bei widrigem Wind musste auch nachts gesegelt werden, und nur die Sterne konnten dann die Richtung weisen. Noch weiter war die Strecke bis zur schwedischen Küste, zwei Tage dauerte die Überfahrt zumeist, dann aber konnte man wieder unter Land segeln, an Öland vorbei und endlich auf Gotland zu.
Nach langer Fahrt, aber ohne alle Zwischenfälle, erreichte die kleine Flotte den Hafen von Visby, rechtzeitig zum großen Herbstmarkt, zu dem auch die dänischen Seefahrer der St. Knutsgilde erschienen und die gotländischen Händler von ihren Reisen zu den Esten und Russen zurückkehrten. Nachdem die Schiffe angelegt hatten, suchte Dietmar als erstes den Ältermann der Gotlandfahrer auf, um seine Ankunft zu vermelden. Er traf ihn in St. Marien, der deutschen Kaufmannskirche, wo er gerade neu eingetroffene Waren stapelte, denn das Gotteshaus diente auch zur Versammlung der Gildebrüder und als Lagerplatz. Als Kaufmann nahm er Quartier in einem der Häuser, die der Gilde gehörte, während die Besatzung an Bord blieb. Aber Dietmar war doch froh, für einige Zeit wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.
Am folgenden Tag nahm er dann die angebotenen Waren in Augenschein, verhandelte hier und dort, bot zugleich die eigene Fracht zum Kauf oder Tausch. Die Ausbeute an Pelzen war diesmal gering, vieles war bereits verkauft, außerdem hatten die russischen Jäger nur wenig angeboten, so war auch der Preis höher als sonst. Dafür konnte Dietmar einige Fässer mit Honig erwerben und vor allem Wachs, der sich an Klöster und Kirchen mit hohem Gewinn verkaufen ließ. Auch Teer fand er und mehrere Fässer mit Flachsgarn, das die Reepschläger gerne abnahmen für die Takelung der Schiffe, aber auch für andere Taue und Seile. Im großen und ganzen war er durchaus zufrieden mit seinen Geschäften, zumal ihm für seine eigenen Waren gute Preise geboten wurden. So saß er abends im Gildehaus bei einem guten Maß Bier und notierte sich gewissenhaft alle Umsätze, musste er doch dafür auch Abgaben entrichten bei seiner Heimkehr. Zugleich traf er auf so manchen guten Bekannten nicht nur aus Lubeke, sondern auch aus anderen Städten im Herzogtum Sachsen, die sich zur Mitfahrt auf den Schiffen der Gotlandfahrer entschlossen hatten, und solche Kontakte galt es sorgsam zu pflegen. Schwager Jannes und Simon waren allerdings mit ihrer Hanse, ihrer Fahrtgemeinschaft, bereits auf dem Heimweg.
Tags darauf wanderte Dietmar noch einmal zum Hafen hinunter, um mit den Schiffsführern die eigene Heimreise zu besprechen, doch plötzlich stutzte er: Dicht neben den seinen lag ein fremdes Schiff, und fremd war auch seine Bauart. Zwar war es kaum größer als eine Knorr, doch weitaus bauchiger und mit höheren Bordwänden; der Vordersteven ragte ohne jede Krümmung aus dem Wasser, der hintere war noch steiler und ebenfalls gerade. Auch lag das Schiff viel dichter am Ufer, es schien einen flachen Boden statt des üblichen Kiels zu haben. Das erklärte Dietmar auch, warum es so breit und behäbig erschien. Erstaunlich waren auch die Seitenwände: Nirgends waren die Planken geklinkert, also übereinandergelegt, ehe sie genagelt und gedichtet wurden. Mag sein, dass diese glatte Beplankung schneller durch das Wasser glitt, aber das konnte er nicht beurteilen. Auffällig war auch, das der größte Teil dieses Schiffes nach oben hin geschlossen war, ja, auf dem Heck saß sogar ein erhöhtes Podest wie eine Art flachgedeckter Schuppen.
Neugierig trat Dietmar näher an das Ufer heran. Vom Mast wehte der Wimpel einer St. Knut-Gilde, also kam das Schiff von Schonen oder von Jütland oder einer der dänischen Inseln. Dann kam der Schiffer an Deck, und Dietmar rief ihn an: „Sagt, guter Freund, was habt Ihr da für ein Schiff?“ Der Däne lachte: „Da staunt Ihr, nicht wahr? Dabei gibt es diese Koggen schon seit langem. Die Friesen fahren darauf, denn mit dem flachen Boden liegt es gut auf, wenn im Hafen Niedrigwasser ist. Das ist auch im flachen Wattenmeer ein großer Vorteil. Und wie Ihr seht, lässt sich das Schiff darum auch viel weiter an die Kaikante bringen.“ „Aber Ihr habt keine Ruderer?“ „Nein, wir fahren allein mit dem Segel. Das spart eine gute Anzahl Schiffsvolk, und Ihr wisst selber, dass damit die Frachtkosten sinken.“
„Ja, das ist wahr,“ bestätigte Dietmar, und sein Interesse an diesem Schiffstyp stieg. „Und wer hat Euch diese Kogge, wie Ihr sie nennt, gebaut?“ „Meine Schiffsherren haben sie einem Händler aus Dorestad abgekauft, die Werft kann ich Euch nicht nennen. Aber einige unserer dänischen Schiffbauer haben diese Schiffe genau studiert, und in Jütland, so hörte ich, wurden bereits die ersten gebaut. Allerdings immer noch geklinkert, diese Beplankung hier schien ihnen zu schwierig, auch glauben die meisten, dass man mit Klinkerung besser manövrieren und segeln kann.“ „Und wie viel Last könnt Ihr an Bord nehmen?“ fragte Dietmar. „Nun, mit sechzig Last sind wir vollbeladen.“ „Das hört sich gut an, unsere Knorr faßt gerade einmal die Hälfte.“ Dietmar dachte nach. „Und Ihr sagt, die Jütländer können solche Schiffe auf Kiel legen?“ Der Schiffer lachte: „Kiel ist gut. Der Koggenboden ist platt wie ein großes Brett, da dient der Kiel nur noch dazu, die Steven zu halten. Doch das kann ich Euch leider nicht zeigen, es sei denn, Ihr lasst Euch kielholen.“ Nun lachte auch Dietmar: „Vielen Dank, darauf verzichte ich gern. Dann vertraue ich lieber darauf, dass Ihr die Wahrheit sagt. Jedenfalls wünsche ich Euch eine gute Reise!“
Nachdenklich schritt der Kaufmann zur Herberge zurück. Dieses andere Schiff schien wirklich besser zu sein als die Knorr, die man von Lubeke aus fuhr. Man müsste einmal eine Fahrt nach Schleswig machen oder noch weiter in den Norden, um beim Bau zuzuschauen. „Ich muß darüber mit Jannes und Simon reden,“ dachte er.
Am nächsten Morgen wurden die letzten Waren auf die drei lübischen Schiffe gebracht, Eigner und Schiffsführer begutachteten noch einmal zusammen mit dem Ältermann, ob alles richtig verstaut und gesichert war und keines der Schiffe überladen, was der Ältermann besiegelte. Das Wetter versprach, auch in den nächsten Tagen sonnig zu sein bei kräftigem Ostwind. So wurde beschlossen, am kommenden Tag die Jungfrau Maria um sichere Fahrt zu bitten und dann Visby zu verlassen.
Die Schiffe hatten Bornholm erreicht, das Wetter hatte sich bislang gehalten, also gab es nur kurze Rast, schon am nächsten Morgen stach die kleine Flotte wieder in See Richtung Rügen. Das mochte vielleicht noch zwei Meilen entfernt sein, da zog im Nordwesten urplötzlich eine düstergraue Wolkenwand auf, der Wind sprang um und frischte auf. Es dauerte nur kurze Zeit, dann war der Himmel schwarz gefärbt, Sturm peitschte hohe Wellen gegen die Schiffe, knapp nur gelang es, die Segel einzuholen und das Tuch zu bergen. Nun prasselte auch Regen nieder, man konnte nichts tun, als die Schiffe treiben zu lassen und die Tiefe zu messen, doch auch das misslang immer öfter, der Druck der Wogen war stärker als das Gewicht des Lotes. Rasch wurde es Abend, der Schiffsführer hatte die Orientierung verloren, auch die anderen Schiffe gerieten außer Sicht. Irgendwo zur Rechten musste die Küste liegen, doch die Dunkelheit war undurchdringlich geworden. Der Steuermann versuchte, so gut es nur gelingen mochte, einen Kurs zu halten, der sie nicht gegen das Ufer trieb. Der Sturm heulte, als hätte die Hölle all ihre bösen Geister losgelassen, und viele holten ihren Rosenkranz aus dem Gürtel, um gegen die finsteren Mächte anzubeten.
Dietmar stand neben dem Mast, hielt ihn fest umklammert, seine Gedanken wanderten zu Weib und Kind, und auch er betete inbrünstig, der heilige Nikolaus, Schutzpatron der Seefahrenden, möge ihnen beistehen. Plötzlich ging ein unheimlicher Rück durch den Schiffskörper, als sei er gegen einen Felsen gestoßen. Die Knorr, vom Sturm gegen das unsichtbare Hindernis gedrückt, krängte zur Seite. Dietmar verlor den Halt an dem regennassen Mast, stolperte, stürzte, fiel gegen die Bordkante, wollte sich festhalten, doch die Kante entzog sich ihm, neigte sich immer tiefer, er griff ins Leere. Das Schiff schien ihn auszuspeien, und dann war da nur noch Wasser um ihn, er schmeckte das Salz in seinem Mund, eine Woge schleuderte ihn hoch und wieder hinab in ein Wellental, nirgendwo ein Schiff, ein rettendes Ufer, nur Wasser ringsum und das Heulen des Sturms und das Toben der Wellen und die Finsternis der Nacht. Heilige Maria, du Gottesmutter, hilf mir doch, hilf! Ungehört verklang der Schrei im Gelächter der entfesselten Geister aus dem Reich Satans, des Fürsten der Hölle.
*
Wie auch ihre beiden Brüder, war Katharina unverkennbar ein Kind des Hinrich von Soest: ebenso schlank und hochgewachsen, ebenso mit sonnenblondem Haar und grünlichen Augen. Und auch Katharina hatte dieses schmale Gesicht mit einem langen geraden Nasenrücken – ebenmäßig, wenn auch nicht gerade lieblich zu nennen. Einzig überlebende Tochter des Kaufmanns war sie; spät erst geboren nach den Brüdern und zwei Mädchen, die allerdings starben, ehe sie noch auf ihren Beinchen stehen konnten, spätes Zeugnis für die innige Liebe, die der schon reife Hinrich immer noch für sein Eheweib empfunden hatte. Und diese Liebe hatte er nach dem baldigen Tod seiner Frau auf die Tochter übertragen. Er verwöhnte sie gern, sah ihr vieles nach, was er selbst seinen Söhnen früher verboten hätte. So war sie ein rechter Wildfang, der es den großen Brüdern stets gleichtun wollte. Dabei war sie im Grunde eher unsicher und eigentlich von ängstlichem Gemüt, doch gerade deswegen mühte sie sich, das vor den anderen und sogar vor sich selbst zu verbergen.
Auch später schwankte sie häufig zwischen Härte und Milde gegenüber dem Gesinde, zwischen Strenge und Nachgiebigkeit gegenüber den eigenen Kindern. Als launisch empfanden das oft ihre Mägde und Knechte, als ungerecht vor allem die beiden Töchter, denn als nach ihnen endlich der ersehnte Sohn geboren wurde, Reinhold, da umsorgte Katharina ihn mehr, als es ihm gut tat. Jede Strafe, die sie dennoch aussprechen musste, schmerzte sie selber oft mehr als den Knaben, denn der war neugierig und unternehmungslustig, ungeachtet aller ängstlichen Mahnungen, und zweimal schon hatten die Schifferknechte ihn aus der Trave gezogen, so dass sich auch der Vater ernstlich vornahm, ihm im nächsten Sommer das Schwimmen beizubringen. Diese doch so nützliche Übung war selbst unter den Seereisenden selten, Dietmar verdankte sie dem Vater und, was er nicht wusste, im Grunde der Mutter.
Katharinas Ängste galten auch ihrem Ehemann, stets litt sie unter der Zeit, die Dietmar auf Handelsreisen war, stets war sie in Sorge, es könnte ihm in der Fremde etwas zustoßen, ohne dass sie ihm helfen, ihn pflegen, vielleicht sogar aus der Gefahr erretten könnte. Das war schon als Kind so, wenn der Vater wochenlang fort war, und die gleiche Besorgnis galt nun auch dem Ehemann. So wartete sie auch diesmal von Woche zu Woche sehnlicher auf seine Rückkehr, manchmal schickte sie einen Knecht zum Hafen, der die aus Visby Heimkommenden befragten sollte, ob er noch auf Gotland wäre und ob es ihm dort gut gehe.
Doch dann kamen die drei Schiffe zurück, mit denen er aufgebrochen war, und mit ihnen kam die schmerzliche Nachricht, man sei vor Arkona in einen furchtbaren Sturm geraten, Dietmars Schiff sei dort auf Grund gelaufen, zwar dennoch unbeschädigt wieder freigekommen, der Kaufmann jedoch bei dem Aufprall über Bord gestürzt und verschollen. Nacht sei es gewesen, heftiger Seegang und tobender Wind, niemand habe ihn noch entdecken können in der aufgewühlten See, die ihn verschlungen habe. Man werde jetzt wohl für Dietmar Faehling Seelenmessen lesen müssen, ein schreckliches Unglück sei es und ein schneller und böser Tod ohne den Trost der heiligen Sakramente. Der Schiffsführer nahm es auf sich, der Witwe diese Nachricht zu überbringen, doch zuvor wandte er sich an Jannes, den Schwager und väterlichen Freund des Verschollenen, damit er Katharina Faehling beistehen möge in dieser schweren Stunde.
Katharina vernahm den Bericht, mit starrem Gesicht und trockenen Augen, als würde sie nicht begreifen, was da geschehen war. Nein, sie wollte es auch nicht begreifen; was in ihren Ängsten oft so deutlich vor ihrem Auge stand, jetzt ließ sie es nicht zu, Wahrheit zu werden. Nein, sie würde keine Seelenmesse lesen lassen, sondern nur tausend Gebete um Bewahrung und Rettung, denn Dietmar würde zurückkehren zu ihr und den Kindern. Besorgt betrachtete Jannes die Schwester. Sie würde sich abfinden müssen mit dem Schicksal, das doch so vielen Frauen auferlegt war, damit sie für die Kinder, das Haus und das Gesinde, die Abwicklung der Geschäfte Kraft fand. Sicher, der Rat würde einen Vormund bestellen, wie es üblich war bei einer Witwe, und er würde sich anbieten für dieses Amt, doch er würde sie zwingen, all das mit zu entscheiden, denn sie war klug genug, wenn sie nur stark genug wäre.
„Wir wollen ihr Zeit geben,“ sagte er draußen zu dem Schiffer, „noch ist das alles zu pötzlich über sie hereingebrochen. Ich bitte dich, die Schiffe zu entladen und alle Waren, die Dietmar gehören, zu stapeln. Ein Sekretarius soll es überprüfen, die Abgaben festsetzen und den Verkauf freigeben. Ich werde mich dann darum kümmern. Gerade jetzt ist es wichtig, hohen Gewinn zu erzielen, damit seine Familie sich nicht einschränken muß. Ich bin Pate für Reinhold, und ihm soll das Geschäft des Vaters einmal ungeschmälert übergeben werden, dafür verbürge ich mich. Und ich werde Anna, Dietmars Muhme, darum bitten, Katharina zur Seite zu stehen, die beiden sind gleichen Alters, und auch Anna hat den Verlust ihres Mannes zu tragen gehabt.“ Aber weder Jannes noch Anna gelang es, Katharina zur Trauer zu bewegen. Sie vergoß keine einzige Träne, sie betete ununterbrochen um die Rückkehr ihres Mannes, sie weigerte sich, von den anderen Kaufleuten und deren Frauen getröstet zu werden. Selbst ihr Beichtvater vermochte nicht, sie zu einer Seelenmesse zu bewegen. Ihr Herz war wie versteinert, sie hatte ihm verboten, Dietmars Tod auch nur zu denken.
*
Dietmar Faehling trieb auf dem Wasser, wurde von den Wellen überspült, nur deren Druck verhinderte noch, dass er endgültig in die Tiefe sank. Da war er plötzlich, der Gedanke: Sein Vater hatte ihn doch schwimmen gelehrt, damals, als sie einmal Großmutter Vesna besuchten und das Wasser der Wochenitze angenehm warm war. Vor unendlich langer Zeit war das, nie hatte er wieder geübt, vergessen schien das alles. Doch als er noch einmal aus dem Wellental hinaufgeschleudert wurde, begannen Arme und Beine sich zu bewegen, Todesangst brachte die Erinnerung zurück, er ließ sich von der nächsten Wogen treiben, streckte nun die Beine lang aus, schob mit offenen Händen das Wasser zur Seite, führte sie über dem Kopf zusammen und spreizte sie wieder, die Beine folgten dem Rhythmus, er schwamm nun bewußt mit dem Zug der Wellen in der Hoffnung, sie würden dem Ufer zustreben, schob sich voran, schluckte Wasser, keuchte vor Anstrengung, aber er ging nicht unter, kämpfte um sein Leben.
Plötzlich stießen seine Beine gegen etwas Hartes, Festes, er wollte sich aufrichten, doch ein Sog von vorn riß seine Beine wieder nach oben, aber die nächste Welle trieb ihn weiter voran, nun fühlten seine Hände Sand zwischen den Fingern, für einen Augenblick wich das Wasser zurück, holte Atem, er kam auf festen Boden zu liegen, eine neue Welle überspülte ihn, er warf sich noch einmal mit aller Kraft vorwärts, die nächste Welle kam, doch zog sie ihn nicht mehr zurück. Mühsam kroch er vorwärts, fühlte Geröll und Sand; erschöpft blieb er liegen. Für einen Augenblick riß die Wolkendecke auf, und da sah er sie vor sich, diese gewaltige Wand, höher aufragend als daheim die Türme von Dom und St. Marien, strahlend hell im Licht des Mondes. Dietmar meinte, die Mauern des himmlischen Jerusalem zu schauen. Bin ich schon dort, dachte er. Aber warum öffnen sich mir nicht die Tore? Bleiben sie ohne Beichte und Absolution verschlossen, dachte er, bin ich ausgestoßen aus der Stadt der Seligen, wo ich ihr doch so nahe bin? Bin ich verdammt in meinen ungesühnten Sünden, bestraft damit, das Heil zu schauen und es doch nicht zu empfangen?
Doch da versank die Mauer, kehrte die Dunkelheit der Nacht zurück, und dunkel wurde es auch in ihm, nachtschwarz auch vor seinen Augen. Seine Sinne schwanden, und zitternd vor Kälte lag da nur noch sein lebloser Körper am Strand.
Am nächsten Morgen kamen zwei halbwüchsige Knaben den Strand unter den Kreidefelsen entlanggelaufen; barfuß und ohne Beinlinge hüpften sie zwischen Sand und Wasser hin und her, doch das war kein Spiel, denn immer wieder bückten sie sich und sammelten etwas in einen Korb. Wie alle, die auf der Insel Rügen am Rand des Meeres wohnen, wussten sie, dass die aufgewühlte See den kostbaren Bernstein an den Strand spülen würde. Meist waren es nur kleine milchige Splitter, aber der Vater wusste sie zu polieren, die scharfen Kanten zu glätten und dann jedes Stück zu durchbohren, um sie als Kette aufzufädeln. Auf den Märkten gab es genug junge Burschen, die ihm für ein paar Münzen solch eine Kette abnahmen, um sie der Liebsten zu schenken. Doch immer wieder fanden sie auch schöne große, goldfarbene und fast durchsichtige Steine. Die sammelte er dann sorgfältig in einem Lederbeutel, denn mehrmals im Jahr kam ein Händler ins Dorf auf der Suche nach solchen Steinen, um sie den Paternostermakern weiterzuverkaufen für ihre Rosenkränze, und die zahlten andere Preise.
Die beiden Jungen blickten aufmerksam auf den Boden, um zwischen all den gelbbraunen Kieseln die echten, oft ebenso unscheinbaren Bernsteinstücke zu finden, und so stolperte sie fast über den Mann, der da auf dem Strand lag, durchnässt und leblos. Der Ältere beugte sich über ihn, hielt prüfend die Hand vor die Nasenlöcher, beobachtete die Brust, ob sie sich hob und senkte. „Er lebt,“ flüsterte er dann, „komm, wir ziehen ihn ein wenig höher auf den Strand.“ Dann liefen sie ins Dorf zurück, berichteten dem Vater, der kam mit einigen Nachbarn, und gemeinsam trugen sie den Fremden in eine der Hütten, zogen ihm das nasse Wams und das Hemd aus und hüllten ihn in eine trockene Decke. Der Unbekannte hatte immer noch die Augen geschlossen, und er öffnete sie tagelang nicht, und wenn er es tat, so schien er niemanden zu erkennen. Fieber hatte ihn gepackt und schüttelte ihn, man kühlte die Stirn, rieb ihn immer wieder trocken, und als er wieder fähig war zu schlucken, flößten die Leute ihm heilenden Tee ein.
Irgendwann, unerwartet, schlug er die Augen auf, schaute mit klarem, erstauntem Blick um sich, sah fremde Gesichter, hörte eine fremde Sprache, und die Erinnerung an Brana, die Kinderfrau seiner ersten Jahre, kam zurück, er verstand das eine oder andere Wort, und dann, plötzlich, sagte er einen jener slawischen Sprüche auf, die die alte Magd ihn damals gelehrt hatte und deren Sinn er nicht wusste. Die Leute erschraken, denn es war ein heidnischer Zauber, dem sie doch abgeschworen hatten. Aber er konnte sprechen, und so fragten sie: „Wer bist du?“ – erst in ihrer eigenen, dann in der deutschen Sprache, die einige von ihnen beherrschten.
Dietmar nannte seinen Namen und den Ort, aus dem er kam, und fragte dann: „Wo bin ich?“ „Unser Dorf heißt Wissowe und wir sind Ranen. Wir haben dich am Strand gefunden nach dem großen Sturm. Ist dein Schiff untergegangen?“ Dietmar blickte ins Leere, er brauchte einige Zeit, um das Erlebte zurückzuholen in sein Gedächtnis: „Ich weiß es nicht,“ sagte er zögernd. „Es ist auf Grund gelaufen, und ich bin ins Wasser gestürzt, aber ich konnte ans Ufer schwimmen. Was dann geschah, daran erinnere ich mich nicht mehr.“ „Die Heiligen haben dich vor dem Tod bewahrt, Fremder,“ sagte der Dorfälteste. „Doch woher wußtest du diesen... Spruch in unserer Sprache?“ „Ich hatte eine Kinderfrau, die hat ihn manchmal vorgesprochen. Ihr müsst wissen, auch meine Mutter sprach eure Sprache, sie stammte aus dem Stamm der Wagrier. Aber was er bedeutet, weiß ich nicht, er kam nur so in die Erinnerung zurück, als ich eure Sprache hörte.“
Der Älteste nickte. Der Fremde schien also keine heidnischen Bräuche zu üben, das wäre übel gewesen für das Dorf. Es war erst ein Dutzend Jahre her, dass die Dänen den Tempel des Swantewitt zerstörten und dafür Kirchen bauten auf ihrer Insel. Man hatte sie alle getauft und allen Aberglauben verboten. „Du musst dich erholen, Deutscher. Du bist unser Gast, solange du willst, aber du darfst erst gehen, wenn du wieder kräftig genug bist.“ Dietmar tastete nach seinem Wams, das sie neben das Lager gelegt hatten. Dort hatte Katharina an drei Stellen Münzen eingenäht für den Notfall. Nun würde er sie brauchen können. „Ich will euch bezahlen, wenn ich fortgehe,“ sagte er, aber der Älteste blickte ihn ernst an: „Du bist unser Gast, und kein Gast wird je etwas zahlen im Land der Ranen. Sprich nie wieder davon.“
Eine Frau trat in die Hütte, sie brachte einen Kräutertrunk und süßen Brei. „Stärke dich,“ sagte der Slawe. „Morgen bekommst du auch Brot und etwas Braten, wenn dein Magen es wieder verträgt. Du hast viele Tage im Fieber gelegen.“ Dietmar musste an Katharina denken. Sie wird sich sicher Sorgen machen. Ob die anderen Schiffe unversehrt zurückgekehrt sind? Dann wird sie glauben, ich sei mit meiner Knorr untergegangen. Doch ich kann ihr die Trauer nicht ersparen, es wird einige Tage dauern, bis ich zurückkehren kann. „Ankern hier bei euch Schiffe, mit denen ich meinem Weib Nachricht senden kann?“ „Wir haben nur unsere Fischerboote. Aber wir werden dich zu einem Hafen bringen, wo die Schiffe der Händler anlegen, sobald du gesund genug bist für eine Reise.“ Der Älteste blickte auf das Wams. Du bist kein Schifferknecht, denke ich, sondern der Schiffsführer oder ein Kaufmann, nicht wahr?“ Dietmar nickte. Er aß und trank, doch dann überkam ihn die Müdigkeit, und er schloß die Augen. Da schickte der Älteste die Männer hinaus, bis auf einen, der sollte am Lager des Fremden wachen.
*
Reinhold, Dietmars Sohn, war bei aller Trauer um den Vater eifrig damit beschäftigt, das Treiben am Hafen zu beobachten. Jannes sah es durchaus wohlwollend, wenn sein junger Neffe so in die Aufgabe eines Kaufmanns hineinwuchs, und dieser hielt es mit nun fast acht Jahren für kindisch, noch mit einem hölzernen Steckenpferd herumzutoben. Daß ihm die Mutter seit längerem Lesen, Schreiben und Rechnen beibrachte, war doch ein Zeichen dafür, dass er bald auch als Handlungsgehilfe tätig sein würde. Doch seitdem die Nachricht, Dietmar sei auf See geblieben, Lubeke erreicht hatte, war Katharina nicht mehr in der Lage, den Sohn zu unterrichten. Bei jeder Aufgabe stieg die Angst in ihr auf, auch Reinhold könnte eines Tages ein Schiff besteigen und sie verlassen.
An diesem Tag ging Reinhold wieder in aller Frühe die Alfstraat hinunter, die inzwischen mit einem Bohlenweg befestigt war, trat durch das Tor der dicken Backsteinmauer, die Herzog Heinrich erst kürzlich zum Schutz der Stadt hatte errichten lassen, und warf zunächst einen Blick über das Hafengelände. Das mit dicken Bohlen abgestützte Ufer war von den Kaufleuten aufgeschüttet worden als Schutz vor den Hochwassern und um das Hafengelände zu erweitern, die Trave war damit tief genug, so dass eine Knorr oder ein Langschiff mühelos am Kai anlegen konnte. Rund achtzig Schritt waren es vom Tor bis zum Ufer, das weite Hafengelände zeigte sich an diesem noch kühlen Morgen bereits voller Leben und Geschäftigkeit. Überall lagen Tonnen und Ballen, sorgfältig gezeichnet mit den Eigentumsmarken der einzelnen Händler; Kaufleute aus Bardowieck und Lüneburg, Brunswik und den westfälischen Städten gingen umher, prüften die Ware und verhandelten um den Preis. In mehreren Städten würden in wenigen Wochen die herbstlichen Messen beginnen, da galt es, günstig einzukaufen und rechtzeitig auf den Märkten zu sein.
Noch immer entluden Schifferknechte auch tags zuvor hereingekommene Schiffe, die Zeit der Fernfahrten über See neigte sich dem Ende zu, denn niemand wagte sich dann noch in die Winterstürme aufs Meer hinaus. Andere Schiffsleute lagerten in Zelten auf dem Hafengelände, sie hatten das Gut der Eigentümer zu bewachen. Manche vertrieben sich die Zeit mit Würfelspielen, man hatte ihnen den Lohn ausgezahlt, und nun hofften sie, ihn durch etwas Glück zu vergrößern auf Kosten der anderen. Hier und da brachten Träger auch Ballen, Kisten und Fässer durchs Tor in die Stadt zu den Speichern der Kaufleute. Nicht alles wurde sofort im Hafen verhandelt, manche Ware gewann an Wert, wenn man sie zurückhielt und erst im Winter verkaufte, wenn das Angebot gering und die Nachfrage größer wurde. Und inmitten all des bunten Treibens gingen mit gewichtiger Miene die secretarii des Rats umher, um die vorgeschriebenen Abgaben zu erheben oder auch die Qualität mancher Waren zu schätzen.
Reinhold liebte diesen Anblick, diese geschäftige Welt des Handels, diesen Geruch fremder Länder, der aus den vielen Tonnen und Ballen in seine Nase drang. Er fand einen Platz, auf dem Waren mit der Marke seines Vaters lagerten, Oheim Jannes hatte sie von den drei Schiffen zusammentragen lassen und einen Handlungsgehilfen beauftragt, sie fremden Händlern anzubieten. Der Junge wollte dabei zuschauen, er empfand Verantwortung für alles, was der Vater im fernen Gotland erworben hatte. Doch noch war der Gehilfe nicht erschienen, nur zwei Knechte bewachten das Handelsgut, und sie nickten dem Jungen freundlich und ein wenig wehmütig zu.
Da erregte etwas anderes seine Aufmerksamkeit: Über das Röhricht hinweg, das den Hafen nach Norden hin begrenzte, sah er die Masten mehrerer Schiffe, die die Trave heraufkamen. Wegen des günstigen und nur leichten Windes hatten sie noch Segel gesetzt und glitten nun wie stolze Schwäne über den Fluß, dann refften die Schifferknechte das Tuch, der Steuermann drehte bei, Seile flogen ans Ufer, wurden dort ergriffen, und einige Männer zogen Schiff um Schiff an die Kaikante. Auf jedem stand der Schiffsführer, um die nötigen Kommandos zu geben, und neben ihm ein oder zwei Kaufleute, die zu dieser Hanse gehörten.
Reinhold war ans Ufer gelaufen, um alles genau beobachten zu können, doch plötzlich schrie er laut auf: Auf der zweiten Knorr, die eben an die Bohleneinfassung gezogen wurden, stand ein Mann, und er glich seinem Vater – nein, das ist nicht wahr, er ist es selbst, ganz gewiß ist er es! „Vater!“ rief der Junge, und er weinte dabei vor Freude, „Vater!“ Und der Mann dort auf dem Schiff winkte, sprang an Land, noch ehe es festgezurrt war, lief mit weiten Schritten auf den Jungen zu, umschlang ihn, drückte ihn an sich, und auch ihm kamen die Tränen. „Reinhold, mein Junge!“
Die Umstehenden waren aufmerksam geworden, viele kannten Dietmar und erkannten ihn nun, den Verschollenen, den Totgesagten, den von der Stadt Betrauerten. Sie drängten sich heran, um den Kaufmann zu begrüßen, Hände wurden geschüttelt, Fragen wurden laut, doch Dietmar wehrte ab: „Habt Geduld, Freunde, ihr werdet alles erfahren. Laßt mir Zeit, zunächst mein Weib zu begrüßen.“ Und auch Reinhold zog ihn am Arm, auch er wollte der Mutter die Nachricht bringen – den Vater bringen.
Katharina stand gerade an der Feuerstelle, als ihr Sohn Dietmar hereinführte. Sie drehte sich dem Jungen zu, sah den Mann daneben stehen, sah ihren Ehemann, und einen langen Augenblick standen sich die beiden schweigend gegenüber, als müssten sie sich erst Gewissheit verschaffen, dass dies wirklich geschah. Dann schrie Katharina, lang und anhaltend, als müsste sie allen Schmerz, alle Last, die sich in ihrem Herzen angesammelt hatten, hinausschreien. Sie taumelte, Dietmar musste sie auffangen, und erst in seinen Armen begann sie zu weinen – all die Tränen, die sie so lange zurückgehalten hatte, Tränen der Trauer, die doch jetzt Tränen der Freude waren.