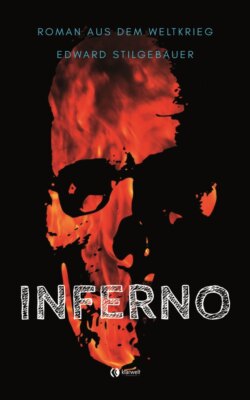Читать книгу Inferno - Edward Stilgebauer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII.
ОглавлениеAls gälte es schon Feste zu feiern, flattern Fahnen aus allen Fenstern, als sei der Sieg schon errungen, setzen die Glocken des Doms und der anderen Kirchen mit ehernen Stimmen ein. Und doch ist es erst ein Auszug!
Melanie ist verwirrt. Die ganze Nacht, seitdem Adolf von ihr gegangen, kam kein Schlaf auf ihre Lider. Ruhelos hat sie sich in den Kissen gewälzt, den Morgen erwartend, der nimmer kommen wollte und den sie doch fürchtete. Den qualvollen Morgen! Und nun ist er da.
Schon lange teilt sie nicht mehr das Schlafgemach mit dem Major. Das war nur im ersten Jahre ihrer Ehe der Fall. da ihn noch so etwas wie sinnliche Lust an sie band. Jetzt ist das anders geworden. Sie erinnert sich kaum mehr an eine Berührung mit ihm. Sie war eine Laune in seinem Leben, sonst nichts, ein Sport, den er sich leisten konnte und von dem er längst genug zu haben schien. Ein Sport wie jeder andere, der Sport eines Mannes, der seine Liebhabereien bezahlen kann. Du reste, was war es denn auch anderes, wenn sie an den Revolver auf dem Schreibtisch ihres Vaters und an die fälligen Wechsel dachte!
Und endlich kam der Tag! Drüben auf der rechten Seite des Rheines erhob sich der Sonnenball aus einem Meere von Nebel und Dunst. Er sandte seine Strahlen fragend, forschend, suchend in ihr einsames Schlafgemach, er mahnte, dass die Stunde des Abschieds nunmehr auch für sie geschlagen hatte. Sie denkt, dass dieser Tag noch sie selbst entführen wird, zuerst nach Berlin und dann nach Falkenstein in der Nähe von Wirballen dicht an der russischen Grenze.
Wie ein dichter Schleier aus Blut hat heute Morgen im Glanze des aufsteigenden Sonnenballs das Meer aus Dunst und Nebel unter den erglühenden Strahlen über dem Rhein und den Gauen Deutschlands gelegen, als Melanie fröstelnd im Nachtgewande an dem Fenster ihres Zimmers stand.
Seltsam war dieser Himmel im Osten über Deutschland, merkwürdig diese Wolkenbildung unter dem Einfluss des aufsteigenden Tagesgestirns, die aussah wie ein blutiges Fanal.
Der Major ist gegangen. Kurz und gemessen wie immer war auch heute sein Abschied gewesen, nicht anders, wie an jedem Tage, wenn er den Rappen bestieg und in die Kaserne ritt. Der Sendomir, den er mit Vorliebe reitet, ist pechschwarz. Schwarz wie seine Seele, wie oft hat Melanie das gedacht.
Gehab dich wohl, mein Kind, und halte dich gut, so hat er heute Morgen beim letzten Abschied gesagt. Und ihr war es gewesen, als stehe sie an einem Abgrund, als versänke eine Welt unter ihren Füßen, und dennoch, als schwebe leise, fast unhörbaren Flügelschlages die goldene Hoffnung auf eine bessere Zukunft schon aus diesem Abgrund empor.
Und so sehr sie sich in diesem Momente zwingt, an Adolf zu denken und nur an ihn, ihre Gedanken fliegen seltsamerweise immer wieder zu dem Major, zu dem Bilde, das sich einst unvergesslich von ihm in ihr Innerstes eingekrampft hat, da sie ihn zum ersten- und einzigen Male an der Spitze seines Bataillons von einer Übung auf dem Großen Sand in das Manövergelände reiten sah. Es bleibt Melanie ewig unvergesslich, dieses Bild! Er saß auf dem Sendomir wie immer, das Tier mit der pechschwarzen Farbe und dem slawischen Namen, das sie nicht leiden kann, weil es sein Lieblingspferd ist, das er auch heute wieder reitet. Den Säbel hatte er damals gezückt und, verderbenbringend wollte es ihr erscheinen, starrte sein kaltes, blaues Auge in die Ferne, aus deren Schoße am Morgen damals wie heute ein Nebelmeer aus Dunst und Tränen des Himmels quoll.
So würde sie ihn auch heute wieder sehen, auf dem Rücken des Sendomir, wie zusammengegossen mit seinem Pferde, Reiter und Pferd zusammengewachsen zu einer einzigen, ehernen Gestalt. Denn die Stunde des Auszugs ist nicht mehr fern und sein Regiment, das ja auch das Regiment Adolfs ist, wird den Weg durch die Rheinallee vorbei an ihrem Hause nach dem Bahnhof nehmen. In dem dünnen, mit einem blauen Bande geschmückten Battisthemde, das sie als einziges Kleidungsstück trägt, friert sie. Sie schauert zusammen, denn der kühle Wind des werdenden Morgens fährt über den Rhein. Sie hat das Fenster, das sie die Nacht über offen gelassen, geschlossen. Da nimmt sie den Vorhang aus purpurfarbenem Damast, der das Fenster umkleidet, und hüllt sich in dessen schwere Falten. Der wallt jetzt wie die Purpurtoga eines römischen Cäsar um ihre schlanke Gestalt.
Trommeln und Pfeifen aus der Ferne. Das Regiment — das Regiment. Die Mägde in der nebenan gelegenen Villa, die sie von dem Fenster aus beobachten kann, recken die Hälse. Blumen flattern aus ihren Händen auf die Straße, die schwarz-weiß-rote Fahne, die auf dem First der Villa weht, bauscht sich, als wolle sie zerreißen vor eitel Glück und Freude. . Das Regiment naht! Ist es ein Sieg, den man heute schon feiert, oder nur ein Auszug in ungewisses Schicksal, denkt Melanie. Sie ist verwirrt, geistesabwesend, wie aller Gegenwart entrückt, kaum mehr dazu imstande, zu denken, nur den Erz gegossenen Major auf dem pechschwarzen Sendomir, den gezückten Säbel in der Hand, schaut das Auge ihre Phantasie.
Und näher und näher kommen die Trommeln und Pfeifen. Das Regiment naht. Brausende Rufe werden drunten auf der Straße laut. Sie tritt näher an das Fenster, stellt den Versuch an, hinab auf die Straße zu blicken, auf den Zehen stehend gelingt ihr das. Und sie sieht die Straße, schwarz von Menschen, die ganze Stadt hat es nicht mehr in den Federn gelassen, da bekannt geworden, dass die Regimenter, ein Strom, der sich ins Frankreich ergießen soll, um diese Stunde ausrücken, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Jungens und Mädels zu Hunderten und Aberhunderten füllen drunten die Straße. Sie blickt hinab auf ein Meer von wogenden Menschenleibern. Es erscheint ihr ein Gigant. Wie der Rhein im Frühling will es ihr scheinen, der mit unbesieglichem Nacken die Decke des Eises hebt und der dann mit herkulischen Armen die Schollen auf die Mauer des Kais schiebt, damit er voran kann, nur voran! Alles verwüstend, was sich ihm in den Weg stellen will, Gärten und Acker, Bäume und Häuser, nichts, nichts mehr achtend! So erscheint ihr das, was sie da drunten sieht, in diesem furchtbaren Augenblicke.
Und darüber die leuchtende Sonne, darüber des Domes eherne Stimme und aus den Wogen da drunten rauschend und brandend ein Lied, ein einziges Lied, gesungen von tausend und tausend Kehlen, gesungen von der Männer rauer Stimme, von der Greise versagender Zunge, in des Mädchens glockenhellen Tönen und der Jungen wild aufbrausendem Laut! So trifft dieses Lied Melanies Ohr:
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt,
Wenn es fest zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält!
Und nun kommt das Regiment! In Schritt und Tritt!
Tritt gefasst durch die Straßen der Stadt! Durch die Rheinallee! Wie auf dem Paradefeld!
Die Trommeln und Pfeifen brechen ab. Das Hohelied von Deutschlands Einigkeit und Größe verhallt. Zinken und Trompeten an seiner Stelle. Die Regimentskapelle setzt ein. Gerade vor Melanies Hause. Eine Aufmerksamkeit des Obersten von Trautmann, der in den Tagen des fernen Friedens so gern mit ihr geplaudert hat. Ein Marsch, ein preußischer Marsch, der in die Beine fährt.
Und sie dort oben in den Purpurfalten des Vorhangs, die wie die Toga eines Cäsar ihren Leib umfluten. Sie beugt sich weit aus dem Fenster und grüßt das Regiment.
Der Oberst an der Spitze erkennt sie. Er senkt den gezückten Säbel und sie lächelt, lächelt wie auf den Kasinobällen, lächelt wie bei den Diners, als ob es heute nicht den Todesritt gälte. Er reitet die Fuchsstute, die Freya, um die sie ihn immer beneidet, englisches Halbblut, das in der ganzen Garnison seinesgleichen sucht. Ein Tier, das mit zierlichen Füßen in die Schlacht tänzelt, als ob es zur hohen Schule ginge. Und da fällt es ihr ein. Sehen die da drunten nicht alle aus, als ob es zu einem Feste, als ob es zum Tanze ginge. Blumen in den Mündungen ihrer Gewehre, Eichenlaub auf den Helmen, Rosen in der freien Hand! So sehen sie aus. Und alles jubelt bei diesem Auszug, als ginge es in der Tat zu einem Tanze.
Nur sie jubelt nicht.
Sie nimmt die Purpurfalten fester um ihre Gestalt, als ob sie sich in diese verkriechen könnte und grüßt noch einmal: Ave Caesar, imperator, morituri te salutant . . . . zieht es da seltsam feierlich durch ihren Sinn.
Ave Caesar, imperator, ave, ave!
Und drunten zieht es vorbei mit dröhnenden Schritten, so dass der Straße harter Boden hallt. Zug um Zug, Kompagnie um Kompagnie, Bataillon um Bataillon. Und die Kraft scheint auch ihr in dieser Stunde unerschöpflich. Kolonnen, die aus Erz und Eisen gegossen zu sein scheinen, unwiderstehliche, unbesiegliche Kolonnen. So sagt sich Melanie.
Ein Gefühl unsäglicher Größe schwellt in diesem Anblick für einen Moment Melanies Herz. Für einen Moment verhallt der fürchterliche Gruss: Ave Caesar imperator, der Gruss der morituri. Nur das Bewusstsein der Kraft lebt für einen armen Moment auch in ihrem Herzen. Raschen Schrittes eilt sie in das Innere des Zimmers, wo sie Adolfs Rosen in dieser Nacht auf ihre Toilette gestellt hat, und entnimmt dem Strauße eine blutig rote, eine purpurfarbene Lady Rothschild. Jetzt steht sie schon wieder im Rahmen des Fensters, umwallt von den Purpurfalten und harrt des Momentes, da er an der Spitze seiner achten Kompagnie auf dem schneeweißen Rustan vorüberreiten soll. Sie kennt seinen Rustan, wie sie die Fuchsstute des Obersten kennt. Es ist ein Pferd mit arabischem Einschlag, das er selbst einmal im Ausland gekauft hat und auf das er sehr stolz ist. Bislang hat sie dieses Tier geliebt, weil es das seine war, nun fürchtet sie es wegen seiner lichten Farbe, von der sie meint, dass sie ihn im Felde dem Feind verraten könne, denn obwohl Frau eines Majors, hat sie ja doch keine Ahnung, wie es in modernen Schlachten herzugehen pflegt. Am Ende haben sie alle jetzt noch keine Ahnung davon, muss sie da denken. Und so schwärmt sie denn trotz allem auch heute noch für diesen Rustan, auf dem er ihr als ihr Siegfried und ihr Schwanenritter in einer Gestalt erscheint, und diesen Anblick erwartend, die blutig rote Rose in der Hand, eingehüllt in die wallenden Purpurfalten, steht sie nun wieder am Fenster.
Suchend gleitet ihr Auge hinab auf die Straße, durch die endlosen Reihen der vorbeimarschierenden Soldaten und späht nach dem Freund. Aber nicht ihn erblickt es. Ihr Auge verschleiert sich vor dem andern auf dem pechschwarzen Sendomir. Ist er da, muss der Freund auch erscheinen, denn die achte Kompagnie gehört ja zu dem Bataillon ihres Mannes, fährt es da blitzschnell durch ihren Kopf. Und deshalb zwingt sie sich dazu, auch den Anblick des Majors in dieser letzten Abschiedsstunde zu ertragen, da die Beiden Seite an Seite hinaus ins Feld gegen den Feind nach Frankreich ziehen. Die zu Fleisch und Blut gewordene Idee der Vernichtung gleitet der Major auf dem pechschwarzen Rosse an ihren Blicken vorüber und des Freundes lichtfarbenes Bild taucht da wie ein Wunder des Himmels im Glanze der strahlenden Morgensonne vor ihr auf.
Plötzlich macht die Kolonne halt. Gerade vor ihrem Hause. Und er senkt den Säbel und blickt zu ihr empor.
Da wirft sie die purpurfarbene Rose in weitem Bogen zum Fenster hinaus.
Das lichtfarbene Pferd scheut, da die Blume zu seinen Füßen nieder in den Schmutz der Straße fällt. Es bäumt sich hoch empor und steht einen Moment auf den Hinterbeinen. Aber er hält es in fester Hand und grüßt mit dem Säbel. Dann nimmt er die Rose mit dessen Spitze auf und trägt sie wie eine blutige Trophäe an seiner Waffe.
Bataillon marsch!
Das Abschiedswort, dieses letzte, das sie hörte, kam aus seinem Munde . . . Die Riesenkolonne setzt sich wieder in Bewegung. Nach zehn Minuten sind die Letzten ihren Augen entschwunden.
Melanie ist allein.