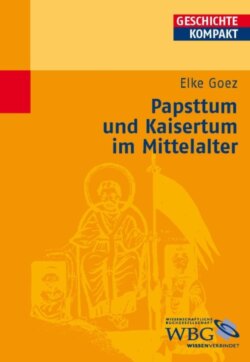Читать книгу Papsttum und Kaisertum im Mittelalter - Elke Goez - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Ausbildung des Primatsanspruchs des Papstes in Rom
ОглавлениеWährend zur Zeit des Paulus ohne jeden Zweifel Jerusalem den wichtigsten Vorort der Christenheit darstellte, stieg nach dessen Zerstörung Rom auf, das Zentrum des Kaiserreiches. Der römischen Gemeinde kam daher eine besondere Bedeutung zu, ohne dass sie bereits Antiochia, Alexandria oder Karthago eindeutig überstrahlt hätte. An eine klare Führungsposition Roms war noch nicht zu denken.
Ausbildung des römischen Vorrangs
Einen besonders wichtigen Baustein auf dem Weg zur Herausbildung des römischen Vorrangs sowie des päpstlichen Primats bildete die Idee der apostolischen Sukzession. In der Frühzeit des 3. Jahrhunderts bedeutete dies allerdings noch nicht, dass alle römischen Bischöfe in bruchloser Folge Nachfolger Petri gewesen wären, sondern betonte lediglich die Tradition Roms bis in apostolische Zeit, wobei noch immer Petrus und Paulus als die für Rom entscheidenden Apostel galten. Je mehr sich die Lehre von der apostolischen Sukzession verfestigte, desto stärker traten die Begriffe cathedra und sedes apostolica in den Vordergrund, die zunächst jedoch nur hervorhoben, dass der Inhaber einer bestimmten cathedra in einer damit verbundenen Lehrtradition stand. Ab etwa 250 verknüpft sich der cathedra-Begriff zunehmend mit Petrus, vor allem aus nichtrömischer Sicht, beispielsweise in den Briefen des Bischofs Cyprian von Karthago. Dieser stützte seine These vom Vorrang Roms durch das berühmte Christuswort aus dem Matthäus-Evangelium: „Du bist Petrus der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen“ (Matth. 16, 18). Begründete Cyprian damit noch kein alleiniges Vorrecht der Ewigen Stadt und ihres Bischofs, so schuf er doch die Grundlagen für den sich langsam herauskristallisierenden Primatsanspruch des Papstes.
Haltung Kaiser Konstantins zum Christentum
Konstantin der Große stellte den Bischöfen von Rom keine Hindernisse in den Weg. Seine Toleranz gegenüber dem Christentum basierte auf nüchternem politischen Kalkül. Er wollte die bereits sehr weit verbreitete und gut strukturierte Kirche als Klammer für sein gesamtes Reich instrumentalisieren und sie auf diese Weise als Baustein seiner Reichseinheitsidee nutzen. Eher unfreiwillig trug er zur Aufwertung des entstehenden Papsttums bei, als er 324 mit dem Ausbau Konstantinopels zum neuen Rom und zur neuen Hauptresidenz begann. Damit läutete er den Niedergang der alten Kapitale und deren politischen Einflusses ein; zugleich entstand durch die Herrscherferne am Tiber ein Vakuum, das die römischen Oberhirten auszufüllen trachteten. Sie intensivierten die Christianisierung, was keineswegs überall friedlich vonstatten ging; vielmehr benötigten die römischen Oberhirten hierbei die massive Unterstützung des Kaisertums. Gleichzeitig begünstigte das sich entwickelnde Papsttum im engsten Schulterschluss mit Konstantin und anderen Mitgliedern der kaiserlichen Familie die Errichtung repräsentativer Kultbauten (beispielsweise S. Croce in Gerusalemme, S. Agnese, S. Lorenzo, S. Peter, S. Sebastiano), die sich aus einfachen Zömeterien langsam zu Kirchen entwickelten, und erwarb sich große Verdienste im karitativen Bereich, nachdem die kaiserliche Fürsorge für die Bevölkerung weitgehend ausgefallen war.
Allerdings war der im Laterankomplex außerhalb des alten Siedlungsgebietes residierende Papst keineswegs unabhängig vom Kaiser. Vielmehr blieb er lange Zeit von den großzügigen Schenkungen des Imperators und der kaiserlichen Familie abhängig. Unter den herrscherlichen Privilegien waren vor allem die vielfältigen Abgabenbefreiungen für kirchliche Besitzungen sowie die Herauslösung des Klerus aus der staatlichen Gerichtsbarkeit von nachhaltiger Wichtigkeit. Aber Konstantin handelte vorwiegend aus politischen Gründen. Sein Ziel war die Einheit der Kirche; Abspaltungen und Sonderentwicklungen sollten unter Verweis auf das Ideal der Stabilität des Reiches unterbunden werden. Wie der Donatistenstreit deutlich macht, scheute sich der Kaiser nicht, in innerkirchliche Fragen einzugreifen. Das erste aus dem gesamten konstantinischen Machtbereich beschickte Reichskonzil im Jahr 314 in Arles offenbarte die Gefahren, welche das kaiserliche Engagement für die Autonomie der Kirche barg, denn niemand wagte ernsthaft Konstantin Widerstand entgegenzusetzen, zumal er die katholische Linie unterstützte. Der neue römische Bischof, Silvester I., reiste nicht nach Arles, da es seinem gerade entstehenden Amtsverständnis abträglich gewesen wäre, an einer Synode teilzunehmen, die nicht von ihm selbst einberufen worden war. Seine kluge Entschuldigung, er könne Rom nicht verlassen, wo die Apostel ständig residierten und durch ihr Blut Zeugnis ablegten, verhinderte einen Bruch mit Konstantin.
Einen ernsten Konflikt mit dem Imperator hätten sich die Bischöfe von Rom nicht leisten können, auch wenn die Petrusverehrung seit dem 4. Jahrhundert immer stärker wurde und der Petruskult alle anderen Kulte in der Ewigen Stadt in den Schatten stellte. Besonders wichtig wurde neben dem Todestag des Apostelfürsten (29. Juni) das Fest Cathedra Petri (22. Februar), das auf den alten Totengedenktag gelegt wurde und Petrus – zumindest in der Auffassung der römischen Bischöfe – zum Begründer der römischen Gemeinde werden ließ. Parallel dazu finden sich immer häufiger ikonographische Vergleiche Petri mit Moses, wobei die Übergabe der Gesetze (traditio legis) mit der Übergabe der Schlüssel (traditio clavis) in einem Bildzusammenhang gebracht wurde.
Vorbildfunktion der römischen Gemeinde
Als im Jahr 380 die westlichen Kaiser Gratian und Valentinian II. anerkannten, dass die römische Gemeinde in Glaubensfragen allen anderen Gemeinden als Vorbild dienen sollte, und dies vom Kaiser des Ostreiches Theodosius bestätigt wurde, stärkte dies die Position des römischen Bischofs immens. Unabdingbar für die Untermauerung der Ansprüche der Bischöfe von Rom war aber ihre ununterbrochene Sukzession in der Nachfolge Petri. Zur Absicherung der Sukzession wurden mehrere Faktoren bedeutend. Zum einen die Bischofsgrablege im Calixtus-Zömeterium, die seit der Mitte des 3. Jahrhunderts bestand und von Damasus ausgeschmückt wurde. Zum anderen eine Bischofsliste von Rom, welche ganz genaue, wenn auch fiktive Amtszeiten der römischen Oberhirten nennt. Als erster Bischof wird Petrus angeführt, der seit dem Tod Christi amtiert haben soll. Hinzu kamen die sogenannten Pseudo-Klementinen – ein legendenhafter Lebensbericht Clemens’ I. mit romanartigen Zügen – die gegen Ende des 4. Jahrhunderts durch Rufinus von Aquileja ins Lateinische übertragen wurden. Darin ist zu lesen, wie Petrus angeblich die Binde- und Lösegewalt auf seinen Nachfolger Clemens übertragen hat. Da man den Brief für echt hielt, konnte man ihm leicht entnehmen, dass die Übertragung nicht nur von Petrus auf Clemens, sondern auch auf alle weiteren Nachfolger Petri erfolgte. Diese einzelnen Komponenten mündeten in die Lehre von der sedes apostolica, aus der hervorgeht, dass alle römischen Bischöfe Nachfolger Petri sind und als solche im Vollbesitz dessen gesamter Amtsvollmacht. Diese sei nicht Petrus allein übertragen worden, sondern sei transpersonal zu verstehen und stamme unmittelbar von Gott.
Zudem profitierte die sich immer stärker ausformende Primatsidee des römischen Bischofs von der sukzessiven Aufwertung des Paulus, der seit dem ausgehenden 4. Jahrhundert neben Petrus trat. Dank kaiserlicher Munifizenz konnte über seinem Grab eine gewaltige Kirche gebaut werden, gleichsam ein Parallelstück zu St. Peter. Seit dieser Zeit häufen sich Darstellungen der beiden Apostel nebeneinander, beispielsweise in den Böden der Goldgrund-Gläser oder in großen Mosaiken wie in S. Pudenziana. Im Verständnis der Zeit wurden nach und nach beide Apostel zu „Ahnen des römischen Bischofs“ (Bernhard Schimmelpfennig), der von Petrus die Binde- und Lösegewalt, von Paulus aber die Lehrgewalt erhalten habe. Niemals jedoch wurde in Frage gestellt, dass Petrus der Wichtigere von beiden war, um der Primatsidee des römischen Pontifex nicht zu schaden.