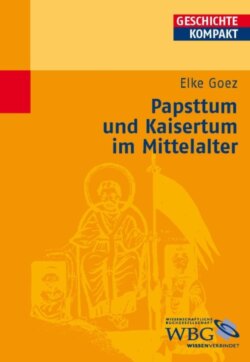Читать книгу Papsttum und Kaisertum im Mittelalter - Elke Goez - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Gregor I.: Mönchspapst, doctor ecclesiae und consul Dei. Das Papsttum im Ringen mit den Langobarden
ОглавлениеLangobarden-einfall 568
Waren die Ostgoten als Föderaten gekommen, die sich bemühten, römische Traditionen im Wesentlichen zu wahren und mit den bereits existierenden Eliten zusammenzuarbeiten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, so drangen die Langobarden 568 eindeutig als Eroberer in Norditalien ein. Auch wenn der Geschichtsschreiber Paulus Diaconus die brutale Gewalt ihres Einmarsches auf der Apenninenhalbinsel zu beschönigen trachtete, so kann doch nichts über die Auslöschung der alten tragenden Schichten und Eliten hinwegtäuschen. König Alboin hatte an der Seite des byzantinischen Feldherrn Narses in den Gotenkriegen gekämpft und die neuere Forschung geht davon aus, dass möglicherweise eben jener Narses die Langobarden gegen den politischen Willen Kaiser Justins II. (565–578) nach Italien geholt hat, um sie als Puffer gegen die Franken am Po anzusiedeln (Verena Postel). Aber niemand hatte mit der Gewalt ihres Erscheinens gerechnet. Während der mehrjährigen Belagerung Pavias, der zukünftigen Hauptstadt des Langobardenreiches, eroberten die Langobarden in erschreckender Geschwindigkeit weite Teile der heutigen Regionen Emilia und Toskana und gründeten in Süditalien die Herzogtümer Spoleto und Benevent. Die mühevollen Restaurationen Justins II. waren mit einem Schlag hinweggewischt. Während sich die Erzbischöfe von Aquileja und Mailand nach Grado und Genua flüchteten, arrangierten sich die meisten anderen Bischöfe mit den Langobarden, um sie als Schutz vor Kaiser und Papst im tobenden Dreikapitelstreit zu instrumentalisieren. Bei diesem Streit ging es um eine als nestorianische Häresie vor allem der drei Theologen Ibas von Edessa († 457), Theodoret von Kyrrhos († 466) und Theodor von Mopsuestia († 428) gebrandmarkte Lehre zur Natur Christi. Von Kaiser Justinian I. (527–565) gezwungen, hatte Papst Vigilius (537–555) 553/54 widerwillig dem Dreikapitelverbot zugestimmt, doch wollten die Bischöfe im Norden Italiens keine Einmischungen des Kaisers in innerkirchliche Angelegenheiten dulden. Trotz der bischöflichen Annäherungspolitik zeitigte der Langobardeneinfall erhebliche Wirkungen auf die Bistumsstruktur Norditaliens; nahezu überall kam es zu einer teilweise empfindlichen Dezimierung der Bistümer, vor allem im Sprengel des Erzbistums Mailand, in der Emilia sowie in Benevent. Byzantinische Rückeroberungsversuche scheiterten; ein byzantinisch-fränkisches Bündnis gegen die Langobarden kam 590 wegen logistischer Probleme nicht zum Tragen. 584 organisierten sich die Langobarden wieder unter königlicher Herrschaft; ihr neuer König wurde Authari (584–590), der durch die Herzöge in großzügigster Weise materiell ausgestattet wurde und von Anfang an einen radikalen Bruch mit der römischen Herrschaft anstrebte. Sein Nachfolger wurde Agilulf, der Autharis Witwe, die katholische Bayernprinzessin Theudelinde, geheiratet hatte. 590 ging jener Agilulf mit Hilfe der Herzöge von Spoleto und Benevent erfolgreich gegen die kaiserlichen Bastionen auf italienischem Boden vor und bald belagerten die Langobarden Rom.
Papst Gregor I.
Dort war 590 Papst Gregor I., der Große (590–604), soeben von Kaiser Maurikios (582–602) bestätigt worden. Dieses Bestätigungsrecht war neu. Kaiser Justinian I. (527–565) hatte es sich gewünscht – und wer hätte es ihm abschlagen können? In seiner berühmten Rechtssammlung, dem Corpus Iuris Civilis, beschrieb er die kaiserlichen Aufgaben in der Kirche: Während die Priester dem Seelenheil dienten, oblag dem Kaiser die Sorge für die zivile Wohlfahrt. Der Imperator war oberster Hüter des Glaubens, wahrte die Einhaltung der kirchlichen Disziplin und hatte damit de facto die Kontrolle über die Kirche inne. Daher beanspruchte er in diesem Zusammenhang auch das Recht zur Approbation des neuen Bischofs von Rom, den er im Rang dem Patriarchen von Konstantinopel gleichstellte.
Unverzüglich übernahm Gregor I. die Sorge für die notleidende Bevölkerung. Wie sein Epitaph würdigend erwähnt, verband er als consul Dei Seelsorge, Mission und den Kampf gegen Häretiker – allen voran die Donatisten in Afrika, die Dreikapitel-Anhänger in Istrien und die Arianer bei den Langobarden – mit politischem Engagement und monastischem Lebensideal, war er doch der erste Mönch auf dem Stuhl Petri. Zudem gelang dem um 540 geborenen Spross einer sehr wohlhabenden römischen Senatorenfamilie die Behauptung des römischen Primats gegenüber dem Patriarchen von Konstantinopel. Zunächst jedoch musste er sich als Vermittler und Diplomat bewähren, denn vom Bosporus war keine Unterstützung gegen die andrängenden Langobarden zu erwarten. Schließlich gelang ihm 598 mit Hilfe der katholischen Königin Theudelinde ein Friedensschluss Agilulfs mit Byzanz, der es dem Papst gestattete, die Missionierung der arianischen Langobarden voranzutreiben. Zwar trat Agilulf nicht selbst über, aber er ließ seinen Sohn Adaloald katholisch taufen und förderte den irischen Missionar Colomban, dessen Kloster Bobbio (gegründet 612) sich rasch zur katholischen Speerspitze im Herzen des Langobardenreiches entwickeln sollte. Die durch Gregor I. initiierte Annäherung Agilulfs an den Katholizismus ermöglichte auch eine politische Weichenstellung, die sonst kaum vorstellbar gewesen wäre: die Verlobung seines Sohnes mit der Tochter des austrasischen Herrschers Theudebald II., die den Frieden mit den Franken garantieren sollte. Auch für den Papst stellte dies einen wichtigen Anknüpfungspunkt dar, waren doch die Kontakte zu den Franken praktisch abgerissen und war beispielsweise die Taufe Chlodwigs (wohl um 498) anscheinend spurlos und unkommentiert an Rom vorübergegangen.
Das gute Verhältnis zu den Langobarden ermöglichte es Gregor I., die Verwaltung im kirchlichen, aber auch im weltlichen Bereich weiter auszubauen, um den ständig steigenden politischen und administrativen Anforderungen strukturell und personell gewachsen zu sein. Trotz seiner vielfältigen Aufgaben intensivierte er die Mission, indem er als erster Papst aus eigenem Antrieb Glaubensboten in bislang allzu entlegene Gebiete schickte, namentlich zu den Angelsachsen, wo indessen bereits Iroschotten den Boden bereitet hatten.
Zugleich war es Gregor der Große, der dem Papsttitel die Worte servus servorum Dei (Knecht der Knechte Gottes) hinzufügte, die alle seine Nachfolger übernehmen sollten. Zwar ist es richtig, den Demutsgestus dieses Titels zu unterstreichen, doch hat zuletzt Bernhard Schimmelpfennig zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser Titel auch vor dem Hintergrund des Konfliktes mit dem Patriarchen von Konstantinopel und der Primatsfrage zu lesen ist und wohl auf Markus 10, 44 basiert: „Wer unter euch der erste sein will, der soll aller Knecht sein.“ Im Hinblick auf das päpstliche Verhältnis zum Kaisertum sind auch Gregors theoretische Überlegungen zum Wesen weltlicher Herrschaft bedeutsam. Er betrachtete weltliche Herrscher immer als Instrumente Gottes zur Rettung der Menschen, die ohne Leitung die gottgewollte Ordnung nicht einzuhalten vermochten. Allen Mächtigen riet der Papst, sich vor der superbia zu hüten und ihre Untertanen zu Gott zurückzuführen. Das Verhältnis der beiden Universalgewalten zueinander wird bei Gregor nicht unmissverständlich deutlich. Sicher trat er für eine Trennung der Kompetenzbereiche ein, ging aber von einem engen Miteinander in Schutz und Fürsorge aus.