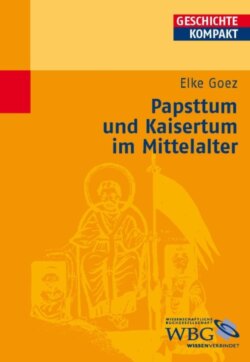Читать книгу Papsttum und Kaisertum im Mittelalter - Elke Goez - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. Das Ende der Karolingerzeit
ОглавлениеDie Regierungen Lothars I. und Ludwigs II. markieren den endgültigen Verzicht auf die Weitergabe des Kaisertums ohne päpstliche Beteiligung. 850 krönte Lothar I. seinen Sohn eben nicht in Aachen zum Mitkaiser, sondern Leo IV. (847–855) setzte ihm in Rom die Kaiserkrone aufs Haupt. Solange sie herrschten und aktiv in Italien Politik betrieben, konnte sich das Papsttum auf den kaiserlichen Schutz verlassen, der an die persönliche Präsenz der Herrscher in der Ewigen Stadt geknüpft war. Nach dem Tod Ludwigs II. änderte sich die Situation jedoch und die Zerstrittenheit der Karolinger gab den Päpsten Gelegenheit, ihre eigene Position auszubauen. 875 bevorzugte Johannes VIII. (872–882) Karl den Kahlen (843–877, Kaiser 875–877) und 881 Karl III. (876–888) vor anderen Bewerbern und machte damit unmissverständlich deutlich, dass der Papst nicht nur allein die Kaiserwürde vergab, sondern dass er auch das Recht hatte, nach Gutdünken über den künftigen Imperator zu entscheiden.
Verfall des Ansehens des Kaisertums
Allerdings sank das Ansehen des Kaisertums in den Wirren des zerbrechenden Karolingerreiches außerhalb Italiens sehr stark. Bald war die einst universale Würde Karls des Großen auf die bloße defensio ecclesiae Romanae und die Herrschaft über die Ewige Stadt reduziert. Bis zum Tod Berengars I. (924) existierte das Kaisertum als seines Ansehens beraubtes Phantom fort, bevor es 924 endgültig erlosch.
Die Verfallszeit ist nur wegen eines einschneidenden Ereignisses in der Geschichte der beiden Universalgewalten überhaupt der Erwähnung wert: Als sich 830 die Söhne Ludwigs des Frommen gegen ihren Vater erhoben, reiste Gregor IV. (827–844) ins Reich, um die Interessen Lothars I. gegenüber Ludwig zu vertreten. Dabei erließ er eine Dekretale, die durch die Pseudo-Isidorischen Dekretalen, eine große Rechtsfälschung aus der Mitte des 9. Jahrhunderts, enorme Verbreitung fand. Gregor IV. legte fest, dass ausschließlich der Papst die plenitudo potestatis besitze, während Christus den Bischöfen nur einen Teil der Verantwortung (pars sollicitudinis) übertragen habe. Diese Grundüberzeugung von der Stellung des Papsttums in der Welt und der Kirche blieb auch in den dunklen Zeiten lebendig, als von der Suprematie der Nachfolger Petri nichts mehr zu spüren war und das Papsttum zum Spielball römischer Adelscliquen erniedrigt wurde, um dann im 11. Jahrhundert immense Sprengkraft zu erlangen.