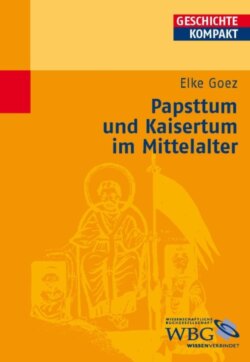Читать книгу Papsttum und Kaisertum im Mittelalter - Elke Goez - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Papsttum und Machtwechsel: Die Pippinische Schenkung
ОглавлениеMachtwechsel im Frankenreich
Nach der deutlichen Absage Karl Martells 739 an Gregor III. hatte es keine Kontakte der Hausmeier zum Papsttum mehr gegeben, obwohl sie sich der Christianisierung als Mittel zur politischen Expansion und Integration vor allem östlich des Rheins eifrig bedienten. Da der angelsächsische Missionar Bonifatius aber nicht nur die Rückendeckung des Hausmeiers, sondern immer auch des Papstes suchte und sowohl auf eine organisatorische Konsolidierung seines Missionswerkes als auch auf eine Reform der bereits bestehenden Strukturen und eine Ausmerzung unkanonischer Missstände hinarbeitete, war sein Verhältnis zu Karl Martell eher kühl. Dies änderte sich erst, als dessen Söhne, Karlmann und Pippin, die Macht übernahmen, wobei Karlmann den Bestrebungen des Bonifatius wesentlich aufgeschlossener gegenübergestanden zu haben scheint als sein Bruder, was sich an den Bistumsgründungen in Erfurt, Würzburg und Büraburg auf Fiskalgut ablesen lässt. Allerdings setzte sich Pippin nach dem Rücktritt Karlmanns und der Überwindung seines Halbbruders Grifo im karolingischen Familienzwist durch und betrieb nachdrücklich die Entmachtung der merowingischen Könige im Frankenreich. Die karolingerfreundlichen Quellen betonten auffällig die Rechtmäßigkeit des „Staatsstreiches“, begründeten ihn mit der völligen Machtlosigkeit der Merowinger und karikierten deren Zeremoniell. Dennoch konnten sie nur schlecht von den Schwierigkeiten ablenken, denen Pippin bei der Ablösung der durch ein angestammtes Charisma getragenen Nachfolger des sagenumwobenen Merowech begegnete. Um seinem Vorhaben das Anrüchige zu nehmen und gleichzeitig Legitimität zu verschaffen, sandte Pippin (741/751–768) zwei persönliche Vertraute – Bischof Burchard von Würzburg und Fulrad – nach Rom, um nach angelsächsischem Vorbild beim Papst handlungsleitende Richtlinien zu erhalten. Gemäß dem Bericht der Reichsannalen ließ Pippin die Frage stellen „nach den Königen im Frankenreich, die damals keine königliche Gewalt hatten, ob das gut sei oder nicht“ (Annales regni Francorum, ed. F. Kurze, Monumenta Germaniae Historica Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Hannover 1895, S. 9).
Königserhebung Pippins 751
Der von den Langobarden bedrängte Papst Zacharias gab, möglicherweise sogar schriftlich, die gewünschte Antwort, dass es nämlich besser sei, wenn diejenigen Könige wären, die auch die Macht besäßen, und nicht diejenigen, die keine Macht innehätten, damit die Ordnung nicht gestört würde. Daher befahl er kraft apostolischer Autorität, Pippin zum König zu machen. Das auf den Herrschafts- und Ordnungsvorstellungen Augustins fußende Responsum verschaffte den Karolingern die „erwünschte autoritative Grundlage, um die Diskrepanz zwischen Titel und Inhalt der königlichen Würde zu überwinden“ (Rudolf Schieffer). Rechtsverbindlich wurde der Dynastiewechsel indessen erst im November 751 durch die Wahl der Franken in Soissons mittels Akklamation und Thronsetzung. Als neues Element der Königserhebung kam die bischöfliche Salbung hinzu, welche die Legitimität stärken und die göttliche Erwähltheit des neuen Herrschers augenfällig machen sollte. Dass der berühmte Missionsbischof Bonifatius selbst die Salbung vollzogen habe, dürfte eine legendenhafte Ausschmückung der Reichsannalen sein, worin sich allerdings die richtige Erkenntnis spiegelt, dass die Angelsachsen den Franken den Weg nach Rom und damit zu einem neuartigen Königtum gewiesen haben.
Die Pippinische Schenkung
Dass Pippin den politischen Aufstieg seiner Familie mit der Hilfe des Papsttums vollendete, hatte tiefgreifende Bedeutung für das gesamte Mittelalter und erschloss den Karolingern neue Dimensionen, deren Tragweite sie 751 wohl kaum abzuschätzen vermochten. Stephan II. (752–757), der Nachfolger Zacharias’, bat in bedrängter Lage um eine Einladung ins Frankenreich und am 6. Januar 754 bereitete Pippin ihm in der Pfalz Ponthion in der Champagne einen eines Kaisers würdigen Empfang, nachdem er dem Papst zuvor schon seinen damals siebenjährigen Sohn Karl entgegengesandt hatte. Die Bitte Stephans um Waffenhilfe gegen die Langobarden fand bei den Parteigängern Pippins offenbar nur geteilte Begeisterung, richtete sich das Ansinnen doch gegen die alten Verbündeten der Franken. Obwohl sein eigener Bruder Karlmann, der sich als Mönch ins Kloster Montecassino zurückgezogen hatte, dagegen intervenierte, beschloss Pippin zu Ostern (14. April) in Quierzy den Kriegszug und versprach dem Papst für den Fall seines Sieges in der sogenannten „Pippinischen Schenkung“ beträchtliche Gebiete, vor allem den römischen Dukat, Teile des byzantinischen Besitzes auf der Appenninenhalbinsel, den Hafen von Luni, Gebiete um Ravenna und in der Pentapolis sowie eine Verbindungsstraße zwischen den Liegenschaften sowie weite Teile Venetiens und Benevents.
E
Pippinische Schenkung
Unter dem Begriff versteht man die Gebiete, die Pippin nach seinem Sieg über den Langobarden Aistulf 756 Papst Stephan II. übertragen hat. Sie bilden die Grundlage für die weltliche Herrschaft des Papstes und den späteren Kirchenstaat.
Zudem schloss Pippin mit dem Papst ein Freundschaftsbündnis, das in den Augen der Franken den Rang einer Schwureinung unter Gleichrangigen hatte. Zuletzt salbte der Papst am 28. Juli 754 in Saint-Denis Pippin zum König und verlieh ihm den Titel eines patricius Romanorum, um die Verantwortung des Herrschers für Rom und die Kirche des heiligen Petrus hervorzuheben; eine verpflichtende Würde, auf die Pippin indessen niemals Bezug nahm. Gleichzeitig salbte Stephan II. auch die Söhne Pippins, Karl und Karlmann, und segnete feierlich Königin Bertrada, wodurch er geschickt die neue Verbindung des Papsttums mit den Franken auf Pippins ganze Familie und präsumptive Nachfolger ausdehnte und diese dadurch zeremoniell erheblich aufwertete. Wahrscheinlich spendete er bei dieser Gelegenheit den Königssöhnen das Firmsakrament, worauf die Bezeichnung compater hindeutet, die Paul I. (757–767) als Zeichen dauerhafter geistlicher Verwandtschaft wieder aufgriff, als er das Tauftuch der Pippin-Tochter Gisela empfing. Möglicherweise drohte Stephan II. sogar allen Großen mit dem Bann, sollten sie jemals einen Nichtkarolingerzum König erheben.
Die vielfältigen Bande mit dem Papsttum wurden „zur Triebfeder der karolingischen Italienpolitik“ (Rudolf Schieffer). 754 scheiterten letzte Verhandlungen mit Aistulf und nur wenig später gelang es Pippin völlig überraschend, den Langobarden in seiner Residenz in Pavia einzuschließen. Der rasch ausgehandelte Friede war indessen nicht von Dauer; im Winter 755/56 stand Aistulf wieder vor Rom und Stephan II. rief erneut um Hilfe, wobei er sich als Sprachrohr Petri darzustellen wusste, der selbst seine Adoptivsöhne zum Eingreifen mahne. 756 belagerte Pippin zum zweiten Mal Pavia und erzwang einen wesentlich schärfer formulierten Friedensvertrag, der auch Gebietsabtretungen im Exarchat von Ravenna zugunsten des Papstes beinhaltete, allerdings keineswegs in den Dimensionen der Pippinischen Schenkung. Dennoch bildeten diese Liegenschaften den Grundstock für das eigene, unabhängige Herrschaftsgebiet des Papstes in Mittelitalien. Auch wenn sich Pippin fortan kaum mehr um Italien kümmerte, hatte er die entscheidenden Weichen für die politische Westwendung des Papstes und damit auch für dessen Abkehr vom byzantinischen Osten gestellt. Zugleich ist mit Pippins Namen der Beginn des Prozesses der politischen Gewinnung des antiken Kernlandes Italiens verknüpft, dessen Bedeutung für das Werden der abendländischen Einheit nicht überschätzt werden kann.
Papstwahlrecht
Zeitgleich mit der definitiven Westorientierung des Papsttums änderte sich auch dessen Selbstbewusstsein. 769 verkündete Stephan III. (768–772) ein neues Papstwahlrecht, das eine Beteiligung der Laien ausschloss und den Wählerkreis auf den römischen Klerus einengte. Allerdings konnte der Einfluss der Adelsfamilien entgegen den ursprünglichen Intentionen durch die neue Verordnung nicht eingeschränkt werden. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass nur noch Kardinalpriester und Diakone wählbar waren. In diesem Dekret begegnet erstmals der Begriff cardinales, der eine Gruppe von Presbytern umschreibt, die besonders eng mit dem Papst vertraut waren; der erste Schritt zur Ausprägung des Kardinalats.
Neues päpstliches Selbstbewusstsein
Sichtbarer Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins war die Konstantinische Schenkung, die wohl in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts entstand. Der erste Teil der wohl berühmtesten mittelalterlichen Fälschung erzählt die aus dem späten 5. Jahrhundert stammende Silvesterlegende mit der Bekehrung Kaiser Konstantins des Großen zum Christentum durch den Apostelfürsten Petrus und Papst Silvester I. Der zweite Teil begründet die Verlegung des Regierungssitzes nach Konstantinopel, da kein irdischer Kaiser dort residieren solle, wo der Stellvertreter des himmlischen Kaisers seinen Sitz habe, also in Rom. Dann werden die angeblichen Schenkungen Konstantins an das Papsttum aufgelistet. Zunächst die Ehrenrechte: Der Papst besitze als Oberhaupt der Kirche kaiserlichen Rang, weshalb ihm der Kaiser den Stratordienst leiste und ihm die Papstkrone (später Tiara genannt) schenke. Dem Papst gebühre die kaiserliche Ehre, auf einem weißen Schimmel zu reiten, der päpstliche Klerus sei ranggleich mit dem kaiserlichen Senat; der Papst residiere im Lateran, den die Fälschung irrig als alten Kaiserpalast bezeichnet. Dann die Besitzrechte: Der Kaiser übertrage dem Papst die Hoheit über die westlichen Länder und Inseln, die allerdings auffälligerweise nicht genauer definiert werden.
Wahrscheinlich sollte die Konstantinische Schenkung ursprünglich die Emanzipation des Papsttums vom byzantinischen Reichsverband legitimieren, blieb aber bis ins 10. Jahrhundert nahezu unbekannt. Erst im sogenannten Investiturstreit wurde sie massiv zur Begründung päpstlicher Ansprüche eingesetzt.