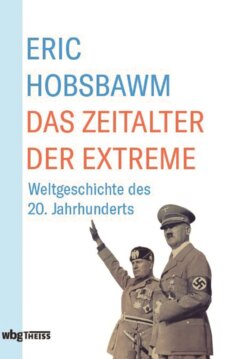Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 12
2
ОглавлениеWie können wir dem »Kurzen 20. Jahrhundert« einen Sinn abgewinnen, also den Jahren vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion, die, wie wir heute im Rückblick erkennen können, eine kohärente historische Periode bildeten, welche nun beendet ist? Wir wissen nicht, was als nächstes kommt und wie das dritte Jahrtausend aussehen wird, aber wir können sicher sein, daß es vom Kurzen 20. Jahrhundert geprägt sein wird. Zweifellos ist in den späten achtziger und frühen neunziger Jahren eine Ära der Weltgeschichte zu Ende gegangen und hat eine neue begonnen. Dies ist die entscheidende Information für die Historiker dieses Jahrhunderts, denn auch wenn sie über die Zukunft im Lichte ihres Vergangenheitsverständnisses spekulieren können, so betreiben sie noch lange nicht das Geschäft eines Buchmachers. Die einzigen Pferderennen, von denen sie berichten und die sie beurteilen können, sind jene, die bereits gewonnen oder verloren wurden. Jedenfalls waren die Vorhersagen der Auguren aus den vergangenen dreißig oder vierzig Jahren – wie auch immer ihre individuelle Qualität als professionelle Propheten gewesen sein mag – derart spektakulär schlecht, daß wahrscheinlich nur noch Regierungen und Wirtschaftsforschungsinstitute Vertrauen in sie haben oder zu haben vorgeben.
In diesem Buch erscheint die Struktur des Kurzen 20. Jahrhunderts wie eine Art Triptychon oder historischer Sandwich. Dem Katastrophenzeitalter von 1914 bis zu den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs folgten etwa fünfundzwanzig bis dreißig Jahre eines außergewöhnlichen Wirtschaftswachstums und einer sozialen Transformation, die die menschliche Gesellschaft wahrscheinlich grundlegender verändert haben als jede andere Periode vergleichbarer Kürze. Retrospektiv kann diese Periode als eine Art von Goldenem Zeitalter betrachtet werden, und sie wurde auch beinahe sofort, nachdem sie in den frühen siebziger Jahren zu Ende gegangen war, als solche empfunden. Im letzten Teil des Jahrhunderts begann dann eine neue Ära des Verfalls, der Unsicherheit und Krise – und für große Teile der Welt, wie für Afrika, die ehemalige Sowjetunion und den ehemals sozialistischen Teil Europas, in der Tat eine Ära der Katastrophe. Als die achtziger Jahre in die neunziger übergingen, hatte sich die Gemütsverfassung der meisten, die über Vergangenheit und Zukunft dieses Jahrhunderts nachdachten, in wachsende Fin-de-siècle-Trübsal verwandelt. In der Perspektive der neunziger Jahre erschien das Kurze 20. Jahrhundert auf dem Weg von einer Krise durch ein kurzes Goldenes Zeitalter in eine andere, mit Ausblick auf eine unbekannte und problematische, aber nicht notwendigerweise apokalyptische Zukunft – und ich möchte, wie vielleicht so manch anderer Historiker auch, die metaphysischen Propheten von einem »Ende der Geschichte« daran erinnern, daß es mit Sicherheit eine Zukunft geben wird. Denn die einzige wirklich sichere Allgemeinaussage über Geschichte ist die, daß sie, solange es die Menschheit gibt, weitergehen wird.
Die Argumentation dieses Buches ist dieser Struktur entsprechend aufgebaut. Sie beginnt mit dem Ersten Weltkrieg, der den Zusammenbruch der (westlichen) Zivilisation des 19. Jahrhunderts markiert. Diese Zivilisation war kapitalistisch in ihrem wirtschaftlichen Aufbau, liberal in ihren rechtlichen und konstitutionellen Strukturen, bürgerlich in der Erscheinungsform ihrer charakteristischen tonangebenden oder herrschenden Klasse, stolz in ihrem Glauben an Wissenschaft, Ausbildung, Erziehung und den materiellen wie moralischen Fortschritt, und fundamental von Europa als Zentrum überzeugt – als der Geburtsstätte von Revolutionen und Wissenschaften, Künsten, politischen und industriellen Entwicklungen. Und diese Zivilisation hatte ein Wirtschaftssystem hervorgebracht, das in die meisten Teile der Welt eingedrungen war; Soldaten, die die größten Teile der Welt erobert und sich untertan gemacht hatten; Populationen (den reißenden Strom europäischer Emigranten und ihre Nachkommen eingeschlossen), die so anwuchsen, bis sie schließlich ein Drittel der Menschheit bildeten; und Großmächte, die das weltpolitische System bildeten.*
Die Jahrzehnte vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs bis zu den Nachwirkungen des Zweiten waren ein Zeitalter der Katastrophe für diese Gesellschaft. Über vierzig Jahre stolperte sie von einer Kalamität in die andere. Es gab Zeiten, in denen nicht einmal intelligente Konservative noch auf ihr Überleben gewettet hätten. Sie wurde von zwei Weltkriegen erschüttert, denen zwei Wellen einer weltweiten Rebellion und Revolution folgten, welche schließlich ein System an die Macht brachten, das für sich in Anspruch nahm, die historisch prädestinierte Alternative zur bürgerlichen und kapitalistischen Gesellschaft zu sein, und das zuerst über ein Sechstel der Landmasse dieser Welt und nach dem Zweiten Weltkrieg dann über ein Drittel der Weltbevölkerung herrschte. Die riesigen Kolonialreiche, die vor und während des imperialen Zeitalters aufgebaut worden waren, brachen zusammen und zerfielen zu Staub. Die gesamte Geschichte des modernen Imperialismus, der beim Tod von Königin Viktoria von England noch so fest und selbstsicher im Sattel gesessen hatte, sollte nur eine einzige Lebensspanne währen – etwa so lange, wie das Leben von Winston Churchill (1874–1965) währte.
Aber mehr noch: Eine Weltwirtschaftskrise von bis dahin ungekanntem Ausmaß zwang selbst die stärksten kapitalistischen Wirtschaftssysteme in die Knie und schien die Schaffung einer einzigen universalen Weltwirtschaft zunichte zu machen, die eine so bemerkenswerte Errungenschaft des liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts gewesen war. Selbst die Vereinigten Staaten, von Krieg und Revolution verschont, schienen dem Kollaps nahe. Und während die Wirtschaft taumelte, verschwanden zwischen 1917 und 1942 (außer in ein paar Ecken von Europa und in einigen Gebieten von Nordamerika und Ozeanien) tatsächlich alle liberalen demokratischen Institutionen, wohingegen der Faschismus und seine autoritären Satelliten und Regime auf dem Vormarsch waren.
Nur die temporäre und bizarre Allianz von liberalem Kapitalismus und Kommunismus, zur Selbstverteidigung gegen den faschistischen Herausforderer, rettete die Demokratie; denn Hitlers Deutschland wurde und konnte im wesentlichen nur durch die Rote Armee besiegt werden. In vielerlei Hinsicht war diese Periode der kapitalistisch-kommunistischen Allianz gegen den Faschismus – vor allem in den dreißiger und vierziger Jahren – der Dreh- und Angelpunkt und das entscheidende Moment in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Aber in vielerlei Hinsicht war dieses Moment auch ein historisches Paradox in den Beziehungen zwischen Kapitalismus und Kommunismus, die fast während des gesamten Jahrhunderts (außer in der kurzen Zeitspanne des Antifaschismus) in einem unversöhnlichen Antagonismus eingebettet waren. Der Sieg der Sowjetunion über Hitler war die Leistung jenes Regimes, das mit der Oktoberrevolution etabliert worden war (was auch eine vergleichende Studie über die russisch-zaristische Wirtschaftsleistung im Ersten Weltkrieg und die sowjetische Wirtschaft im Zweiten Weltkrieg zeigt; Gatrell/Harrison, 1993). Ohne die Oktoberrevolution bestünde die Welt (außerhalb der USA) heute wahrscheinlich eher aus einer Reihe von autoritären und faschistischen Varianten als aus einem Ensemble unterschiedlicher liberaler, parlamentarischer Demokratien. Eine der Ironien dieses denkwürdigen Jahrhunderts ist, daß das dauerhafteste Resultat der Oktoberrevolution – deren Ziel es ja war, den Kapitalismus weltweit umzustürzen – ausgerechnet die Rettung ihres Antagonisten im Krieg wie im Frieden war: Sie spornte ihn an (indem sie angst machte), sich nach dem Zweiten Weltkrieg selbst zu reformieren; und sie machte wirtschaftliche Planung in einer Weise gemeinverständlich, daß schließlich sogar einige ihrer Aspekte zum Prozedere dieser Reform gehören sollten.
Doch sogar nachdem der liberale Kapitalismus gerade noch die dreifache Herausforderung von Zusammenbruch, Faschismus und Krieg überstanden hatte, schien er noch immer einem weltweiten Vormarsch der Revolution ausgesetzt, die sich nun um die aus dem Zweiten Weltkrieg als Supermacht hervorgegangene Sowjetunion sammeln konnte.
Im Rückblick können wir nun erkennen, daß die globale sozialistische Herausforderung des Kapitalismus auf der Schwäche ihres Gegners beruhte. Ohne den Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts im Zeitalter der Katastrophe hätte es keine Oktoberrevolution und keine Sowjetunion gegeben. Das Wirtschaftssystem, das auf der ruinierten eurasischen Landmasse des einstigen Zarenreichs unter dem Namen Sozialismus improvisiert wurde, hätte anderenfalls weder im eigenen Land noch andernorts als realistische globale Alternative zur kapitalistischen Wirtschaft gelten können, und seine eigentlichen Errungenschaften ließen sich erst erkennen, als im Kapitalismus schon das Goldene Zeitalter herrschte. Wie effektiv diese rivalisierenden Strategien waren oder wie bewußt sie eingesetzt wurden, um die Welt unserer Vorväter zu begraben, braucht hier nicht erwogen zu werden. Doch wir werden sehen, daß es bis in die frühen sechziger Jahre durchaus den Anschein hatte, als seien sie sich zumindest ebenbürtig gewesen. Heute jedoch, im Lichte des Zusammenbruchs des sowjetischen Sozialismus, wirkt diese Annahme lächerlich – auch wenn ein britischer Premierminister im Gespräch mit einem amerikanischen Präsidenten die Sowjetunion damals (1960) noch immer als einen Staat beschrieb, dessen »aufwärtsstrebende Wirtschaft … die kapitalistische Gesellschaft bald schon im Wettlauf nach materiellem Wohlstand überholt haben wird« (Horne, 1989, S. 303). Trotzdem müssen wir festhalten, daß das sozialistische Bulgarien und das nichtsozialistische Ecuador in den achtziger Jahren mehr Gemeinsamkeiten hatten als beide jeweils mit sich selbst zur Zeit von 1939.
Auch wenn der Zusammenbruch des sowjetischen Sozialismus und seine enormen und noch immer nicht vollständig abschätzbaren – aber im wesentlichen negativen – Konsequenzen das dramatischste Ereignis während der Krisenjahrzehnte nach dem Goldenen Zeitalter waren, so waren sie doch nur Teil einer universalen oder globalen Krise. Ihre Auswirkungen auf die einzelnen Regionen der Welt waren unterschiedlich ausgeprägt und auch verschieden stark, aber ausgewirkt hat sie sich auf alle, unabhängig von politischen, sozialen oder ökonomischen Konfigurationen. Denn zum erstenmal in der Geschichte hatte das Goldene Zeitalter eine gemeinsame, zunehmend integrativ und universal operierende Weltwirtschaft geschaffen, die raumgreifend über Staatsgrenzen (»transnational«) und daher auch immer stärker über die Grenzen von Staatsideologien hinweg funktionierte. Damit waren natürlich auch die geltenden Vorstellungen der Institutionen aller Regime und Systeme unterminiert worden. Anfänglich hatte man die Schwierigkeiten der siebziger Jahre noch hoffnungsvoll für eine temporäre Unterbrechung des großen Vorwärtssprungs der Weltwirtschaft gehalten, und Länder jeglichen ökonomischen wie politischen Zuschnitts hatten dementsprechend auch nur nach temporären Lösungen gesucht. Doch es war immer ersichtlicher geworden, daß eine Ära der langfristigen Schwierigkeiten angebrochen war. Nun begannen die kapitalistischen Staaten nach Radikallösungen zu suchen und folgten dabei häufig den profanen Theologen des ungebremsten freien Marktes, welche die Art von Politik ablehnten, die der Weltwirtschaft im Goldenen Zeitalter so gut gedient hatte und nun zu versagen schien. Die Extremisten des Laisser-faire waren aber auch nicht erfolgreicher als andere. In den achtziger und frühen neunziger Jahren wurde die kapitalistische Welt von Problemen erschüttert, die es bislang nur in den Zwischenkriegsjahren gegeben und von denen man angenommen hatte, daß sie vom Goldenen Zeitalter endgültig überwunden worden wären: Massenarbeitslosigkeit, bedrohliche zyklische Konjunkturkrisen, spektakuläre Konfrontationen von Obdachlosigkeit und luxuriösem Überfluß, von begrenzten Staatseinnahmen und grenzenlosen Staatsausgaben. Die erlahmenden und verwundbaren Wirtschaften der sozialistischen Staaten wurden zu einem ebensolchen, wenn nicht sogar noch radikaleren Bruch mit ihrer Vergangenheit getrieben und begannen, wie wir heute wissen, auf ihren Zusammenbruch zuzusteuern. Diesen Zusammenbruch kann man den Beginn vom Ende des Kurzen 20. Jahrhunderts nennen, so wie der Erste Weltkrieg den Beginn seines Anfangs markiert hat. An dieser Stelle endet meine Geschichte.
Sie endet – wie alle Bücher, die in den frühen neunziger Jahren abgeschlossen wurden – mit einem Blick ins Dunkle. Der Zusammenbruch des einen Teils der Welt enthüllte die Malaise des anderen. Als die achtziger Jahre in die neunziger übergingen, wurde deutlich, daß die Weltkrise nicht nur überall zur ökonomischen Krise, sondern auch zur allgemein politischen geraten war. Der Zusammenbruch der kommunistischen Regime zwischen Istrien und Wladiwostok hat nicht nur ein riesiges Gebiet mit politischer Unsicherheit, Instabilität, Chaos und Bürgerkrieg geschaffen, sondern auch jenes internationale System zerstört, das die internationalen Beziehungen über vierzig Jahre lang stabil gehalten hatte. Und er enthüllte schließlich auch die Ungesichertheit der innenpolitischen Systeme, die im wesentlichen auf dieser internationalen Stabilität beruht hatten. Denn die Spannungen, die auf den bedrängten Volkswirtschaften lasteten, haben auch die politischen Systeme der liberalen parlamentarischen oder präsidialen Demokratien, die in den fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten seit dem Zweiten Weltkrieg so gut funktioniert hatten, und nicht zuletzt auch die verschiedenen politischen Systeme in der Dritten Welt unterminiert. Die Basiseinheiten der Politik selbst, die territorialen, souveränen und unabhängigen »Nationalstaaten« – sogar die ältesten und stabilsten unter ihnen –, wurden von den Kräften einer supranationalen und transnationalen Wirtschaft und von infranationalen sezessionistischen Kräften und ethnischen Gruppierungen herausgefordert, von denen einige (auch das eine Ironie der Geschichte) den überholten und irrealen Status eines souveränen Miniatur-»Nationalstaates« einforderten. Die Zukunft der gesamten Politik lag im dunkeln, aber ihre Krise am Ende des Kurzen 20. Jahrhunderts war offensichtlich.
Noch offensichtlicher als die Unsicherheiten der Weltwirtschaft und der Weltpolitik aber war die soziale und moralische Krise, die die Umwälzungen im menschlichen Leben nach den fünfziger Jahren reflektierte und in diesem Krisenjahrzehnt schließlich äußerst konfus zum Ausdruck kam: die Krise der verschiedenen Glaubensrichtungen und Postulate, auf die sich die moderne Gesellschaft gründete, seit die Modernen im frühen 18. Jahrhundert ihre berühmte Schlacht gegen die Alten gewonnen hatten, bei der es um jene rationalen und humanistischen Grundsätze ging, die der liberale Kapitalismus und der Kommunismus miteinander teilten und die schließlich auch deren kurze, aber entscheidende Allianz gegen den Faschismus – der diese Postulate bekämpfte – ermöglicht hatten. Michael Stürmer, ein konservativer deutscher Beobachter, stellte 1993 zu Recht fest, daß nunmehr nicht nur die Glaubenssätze des Ostens, sondern auch die des Westens zur Disposition standen: »In dieser Hinsicht besteht übrigens eine merkwürdige Parallelität zwischen Ost und West. Im Osten war die Vorstellung, der Mensch sei Herr seines Schicksals, Staatsdoktrin. Aber sogar bei uns galt – wenngleich sanfter und mehr inoffiziell – die Devise, daß der Mensch auf dem Wege sei, Herr seines Schicksals zu werden. Auf beiden Seiten sind wir mit dieser Omnipotenzanmaßung gescheitert, im Osten absolut, chez nous relativ« (Bergedorf 98. S. 95).
Paradoxerweise endete ausgerechnet jenes Zeitalter, dessen Behauptung, der Menschheit Nutzen gebracht zu haben, ausschließlich auf den enormen Erfolgen des wissenschaftlich und technologisch begründeten materiellen Fortschritts basierte, indem maßgebliche Vertreter der öffentlichen Meinung und vorgeblich große Denker des Westens genau diesen Fortschritt in Frage stellten.
Aber nicht nur die Grundsätze der modernen Zivilisation stürzten in die moralische Krise, sondern auch die historischen Strukturen der menschlichen Beziehungen, die die moderne Gesellschaft von der präindustriellen und präkapitalistischen Vergangenheit geerbt hatte und die ihr, wie wir heute wissen, zur Wirksamkeit verholfen haben. Nicht eine bestimmte Möglichkeit der Organisation von Gesellschaften war in die Krise geraten, sondern alle Möglichkeiten. Und die seltsamen Rufe nach einer diffusen »Zivilgesellschaft«, nach »Gemeinschaft« – und das in einer Zeit, in der solche Worte ihre traditionelle Bedeutung bereits verloren hatten und zu leeren Phrasen geworden waren –, nach Gruppenidentität, die sich nur durch eine einzige Möglichkeit definierte, nämlich durch den Ausschluß von Außenseitern: sie alle waren Stimmen von verlorenen und umhergeisternden Generationen.
Der Dichter T. S. Eliot schrieb: »So wird die Welt enden – nicht mit einem Knall, sondern mit Gewinsel.« Das Kurze 20. Jahrhundert endete mit beidem.