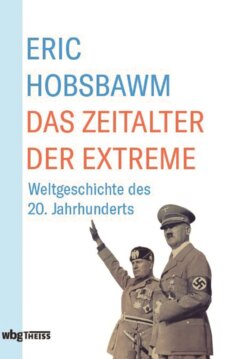Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 13
3
ОглавлениеWie sah die Welt der neunziger Jahre aus, verglichen mit der Welt von 1914? Sie war von fünf oder sechs Milliarden Menschen bevölkert, etwa dreimal soviel, wie beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs gelebt hatten, und dies trotz der Tatsache, daß während des Kurzen 20. Jahrhunderts mehr Menschen umgekommen sind oder auf Weisung und mit Erlaubnis Menschen ermordet wurden als jemals zuvor in der Geschichte. Eine neuere Schätzung der »Megatode« dieses Jahrhunderts beläuft sich auf 187 Millionen (Brzezinski, 1993), was mehr als einem von zehn Menschen der gesamten Weltbevölkerung von 1900 entspricht. Die meisten von ihnen waren größer, schwerer und besser ernährt und wurden weitaus älter als ihre Eltern, obwohl die Katastrophen der achtziger und neunziger Jahre in Afrika, Lateinamerika und der ehemaligen Sowjetunion dies nur schwerlich glaubhaft erscheinen lassen. Die Welt war unvergleichlich viel reicher als jemals zuvor – durch das mittlerweile herrschende Ausmaß an Waren- und Dienstleistungsproduktion –, aber auch reicher in ihrer grenzenlosen Vielfalt. Anders wäre es ihr auch nicht gelungen, eine Weltbevölkerung zu erhalten, die um ein Mehrfaches größer war als jemals zuvor in der Weltgeschichte. Bis in die achtziger Jahre lebten die meisten Menschen besser als ihre Eltern und in den fortgeschrittenen Wirtschaftssystemen auch besser, als sie es selbst jemals erwartet oder für möglich gehalten hatten. Für einige Jahrzehnte sah es in der Mitte des Jahrhunderts sogar so aus, als habe man Mittel und Wege gefunden, zumindest einen Teil dieses enormen Wohlstands in den reicheren Ländern mit einem gewissen Grad an ausgleichender Gerechtigkeit an die arbeitenden Menschen zu verteilen, doch am Ende des Jahrhunderts hatte Ungerechtigkeit wieder die Oberhand gewonnen. Selbst in den ehemals »sozialistischen« Ländern, wo zuvor eine gewisse Gleichheit in Armut geherrscht hatte, hielt Ungerechtigkeit massiv Einzug. Die Menschheit war viel besser ausgebildet als 1914. Tatsächlich waren wahrscheinlich zum erstenmal in der Geschichte die meisten Menschen des Lesens und Schreibens kundig; zumindest stand es so in den offiziellen Statistiken, wenngleich die Bedeutung dieser Errungenschaft am Ende des Jahrhunderts weit weniger klar war, als sie es 1914 gewesen wäre, weil zwischen dem Kompetenzminimum der »Lese- und Schreibkundigkeit«, auf das man sich offiziell geeinigt hatte (was häufig nichts anderes bedeutete als »funktionelles Analphabetentum«), und dem Bildungsniveau der Eliten mittlerweile eine riesige und wahrscheinlich noch wachsende Kluft entstanden war.
Die Welt war angefüllt mit revolutionären und sich ständig weiterentwickelnden Technologien, die auf den Errungenschaften der Naturwissenschaften basierten. 1914 waren sie zwar bereits vorstellbar gewesen, aber ihre Entwicklung hatte noch völlig in den Kinderschuhen gesteckt. Die vielleicht dramatischste Konsequenz dieser Entwicklung war die Revolution im Transport- und Kommunikationswesen, die die Vorstellungen von Zeit und Raumdistanz nahezu zunichte gemacht hat. Es war eine Welt, die täglich, stündlich und in jeden Haushalt mehr Information und Unterhaltung liefern konnte, als sie 1914 kaiserlichen Herrschern zur Verfügung gestanden hatten. Sie ermöglichte es den Menschen, über Ozeane und Kontinente hinweg und nur nach dem Druck auf ein paar Knöpfe miteinander zu sprechen, und sie hat mit gutem Grund die kulturelle Überlegenheit der Stadt über das Land abgeschafft.
Weshalb also endete das Jahrhundert nicht mit einer Jubelfeier angesichts dieses beispiellosen und wunderbaren Fortschritts, sondern in einer Stimmung des Unbehagens? Weshalb blickten so viele der Reflexion fähige Denker ohne Genugtuung zurück und ganz gewiß ohne Vertrauen in die Zukunft? Wahrscheinlich nicht nur deshalb, weil es ohne Zweifel das mörderischste Jahrhundert von allen war, über die wir Aufzeichnungen besitzen: mit Kriegszügen von nie gekannten Ausmaßen und von nie dagewesener Häufigkeit und Dauer, unterbrochen nur für kurze Zeit in den zwanziger Jahren, und beherrscht von bis dahin einmaligen menschlichen Katastrophen, die von diesen Kriegen hervorgerufen worden waren (von den größten Hungerkatastrophen der Geschichte bis hin zum systematischen Genozid). Im Gegensatz zum »Langen 19. Jahrhundert«, das eine Periode des beinahe ununterbrochenen materiellen, intellektuellen und moralischen Fortschritts schien und auch war – das also allgemein die Bedingungen des zivilisierten Lebens verbessert hatte –, hatten sich die Standards und Lebensbedingungen vor allem der Mittelklassen seit 1914 eindeutig wieder verschlechtert; wobei man diese Standards in den entwickelten Industriestaaten für völlig normal gehalten und auch zuversichtlich geglaubt hatte, daß diese sich auf rückständigere Regionen und weniger aufgeklärte Schichten der Bevölkerung ausweiten würden.
Dieses Jahrhundert hat uns zwar gelehrt und lehrt uns auch weiterhin, daß der Mensch fähig ist, unter den brutalsten und theoretisch unerträglichsten Bedingungen zu leben; dennoch fällt es nicht leicht, das Ausmaß der sich leider immer rasender beschleunigenden Rückkehr in einen Zustand zu begreifen, den unsere Vorfahren im 19. Jahrhundert barbarisch genannt hätten. Wir vergessen, daß der alte Revolutionär Friedrich Engels von der Explosion einer irisch-republikanischen Bombe in Westminster Hall entsetzt war, weil er, ein alter Soldat, davon überzeugt war, daß ein Krieg nur gegen Kampftruppen und nicht gegen Zivilisten geführt werden darf. Wir vergessen, daß die Pogrome im zaristischen Rußland, die (vollkommen zu Recht) die Weltmeinung empört und russische Juden zwischen 1881 und 1914 zu Millionen über den Atlantik getrieben hatten, nur klein, beinahe vernachlässigenswert waren, gemessen am Ausmaß des modernen Massakers: Damals wurden die Toten in Dutzenden, nicht in Millionen oder auch nur Hunderten gezählt. Wir vergessen, daß einst eine internationale Konvention dafür Sorge trug, daß feindselige Handlungen »nicht ohne vorhergehende ausdrückliche Warnung und nur in Form einer begründeten Kriegserklärung oder eines Ultimatums mit bedingter Kriegserklärung stattfinden dürfen«. Wann hat zuletzt ein Krieg mit einer solch expliziten oder impliziten Erklärung begonnen? Oder wann mit einem förmlichen Friedensvertrag geendet, der zwischen den kriegführenden Parteien ausgehandelt worden wäre? Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden Kriege zunehmend gegen die Wirtschaft und die Infrastruktur und gegen die Zivilbevölkerung von Staaten geführt. Seit dem Ersten Weltkrieg waren die Kriegsverluste unter Zivilisten bei weitem größer als die Verluste unter den Soldaten aller kriegführenden Staaten, abgesehen von den USA. Wie viele von uns erinnern sich an das, was 1914 noch als selbstverständlich galt:
»Zivilisierte Kriegsführung, so steht es in unseren Lehrbüchern, beschränkt sich soweit wie möglich darauf, die Streitkräfte des Feindes unbrauchbar zu machen; anderenfalls würde der Krieg weitergehen, bis eine der Parteien ausgelöscht wäre. Es geschieht aus gutem Grund …, daß sich die Nationen Europas diese Praxis angeeignet haben« (Encyclopædia Britannica, XI, 1911, Art.: Krieg).
Wir können zwar kaum überschauen, in welchem Ausmaß Folter und Mord erneut zu einem akzeptierten Anwendungsmittel der öffentlichen Sicherheit von modernen Staaten wurden, aber wahrscheinlich unterschätzen wir völlig, welch dramatische Umkehr dies von der langen Ära der Rechtsentwicklung zwischen 1780 und 1914 bedeutet, seit zum erstenmal in einem westlichen Land offiziell die Folter abgeschafft worden war.
Man kann aber die historische Buchhaltung von »Soll« und »Haben« im Weltgeschehen am Ende des Kurzen 20. Jahrhunderts nicht mit der vergleichen, die an seinem Anfang stand. Denn die Welt an seinem Ende unterschied sich qualitativ in zumindest dreierlei Hinsicht.
Erstens war sie nicht mehr eurozentriert. Vielmehr hatte der Niedergang und der Untergang Europas stattgefunden, das zu Beginn des Jahrhunderts das unangefochtene Zentrum von Macht, Wohlstand, Intellektualität und »westlicher Zivilisation« darstellte. Europäer und ihre Nachkommen waren mittlerweile von etwa einem Drittel der Menschheit auf höchstens ein Sechstel reduziert und lebten in Ländern, die ihre Bevölkerungen kaum regenerierten und sich (mit einigen strahlenden Ausnahmen, wie bis in die neunziger Jahre die USA) mit Schutzwällen gegen den Druck der Immigration aus den Armutsländern umgaben. Die Industrien, denen Europa zum Durchbruch verholfen hatte, wanderten anderswohin ab. Die Länder, die einst über den Ozean nach Europa geblickt hatten, blickten anderswohin. Australien, Neuseeland und selbst die USA, zwischen den beiden Ozeanen gelegen, sahen ihre Zukunft im Pazifik, was immer das auch genau bedeuten sollte.
Die »Großmächte« von 1914, europäisch ohne Ausnahme, waren ebenso wie der Erbe des zaristischen Rußland, die Sowjetunion, verschwunden oder auf den Rang von regionalen oder provinziellen Mächten zurückgefallen, mit Ausnahme vielleicht von Deutschland. Gerade die Anstrengungen hin auf die Schaffung einer gemeinsamen, supranationalen »Europäischen Gemeinschaft« und die Bemühungen, eine entsprechende Sensibilität für eine europäische Identität wiederherzustellen und so die alten Loyalitäten gegenüber historischen Nationen und Staaten zu ersetzen, beweisen das ganze Ausmaß dieses Niedergangs.
War dieser Wandel, außer für Historiker, jedoch wirklich von tiefgreifender Bedeutung? Vielleicht nicht, denn er hat sich in den wirtschaftlichen, intellektuellen und kulturellen Konfigurationen der Welt nur geringfügig niedergeschlagen. Schon 1914 waren die USA die größte industrielle Wirtschaftsmacht gewesen, der größte Pionier, das Vorbild und die Antriebskraft für die Massenproduktion und Massenkultur, die die Welt im Kurzen 20. Jahrhundert erobert haben. Aber sie waren auch, trotz ihres spezifischen eigenen Charakters, eine deutliche Erweiterung Europas auf Übersee, wobei sie sich selbst unter dem Rubrum »westliche Zivilisation« an den alten Kontinent klammerten. Wie immer die Zukunft der USA aussehen mag, in den neunziger Jahren konnten sie jedenfalls auf »Das Amerikanische Jahrhundert« zurückblicken, auf ein Zeitalter des Aufstiegs und des Triumphes. Die Industriestaaten des 19. Jahrhunderts bildeten als Gruppe noch immer das größte Wohlstandsgebiet und die größte wirtschaftliche und wissenschaftstechnologische Macht der Welt, und die Bevölkerung dieser Gruppe genoß noch immer den bei weitem höchsten Lebensstandard (was Ende des Jahrhunderts mehr als nur eine Kompensation für die Deindustrialisierung und das Abwandern der Produktion auf andere Kontinente war). All dies macht deutlich, wie oberflächlich letztlich der Eindruck ist, daß die alte eurozentrierte oder »westliche« Welt untergegangen sei.
Eine andere Transformation war von weitaus größerer Bedeutung. Zwischen 1914 und den frühen neunziger Jahren war die Welt in viel höherem Maße zu einer einzigen Funktionseinheit geworden, als sie es 1914 gewesen war und gewesen sein konnte. In der Tat, aus vielen und vor allem wirtschaftlichen Gründen ist »die Welt« heute die primäre Funktionseinheit, wobei ältere Einheiten, wie die »Nationalökonomien«, die sich durch die Politik von territorialen Staaten definierten, auf untergeordnete Komplexe transnationaler Aktivitäten reduziert wurden. Das Stadium, das der Aufbau des »globalen Dorfes« – ein Begriff, der aus den sechziger Jahren stammt (McLuhan, 1962) – in den neunziger Jahren erreicht hatte, wird einem Beobachter Mitte des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich nicht sehr weit fortgeschritten erscheinen; und doch hatten sich nicht nur bestimmte wirtschaftliche und technische Aktivitäten und Wissenschaftsvorgänge grundlegend gewandelt, sondern auch wichtige Aspekte des privaten Lebens – vor allem dank der unvorstellbaren Geschwindigkeit des Fortschritts im Kommunikations- und Transportwesen. Am schlagendsten wird dies vielleicht durch die Spannungen charakterisiert, die am Ende des 20. Jahrhunderts zwischen dem sich beschleunigenden Prozeß der Globalisierung einerseits und der Anpassungsunfähigkeit von Institutionen und dem kollektiven Verhalten der Menschen andererseits entstanden waren: denn seltsamerweise hatte das Individuum sehr viel weniger Schwierigkeiten, sich an die Welt des Satellitenfernsehens, von E-Mail, an die Ferien auf den Seychellen oder an den transozeanischen Pendelverkehr anzupassen.
Die dritte und in mancher Hinsicht verstörendste Transformation war die Auflösung der alten Sozial- und Beziehungsstrukturen und, Hand in Hand damit, das Zerbersten der Bindeglieder zwischen den Generationen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart also. Besonders deutlich trat dies in den fortgeschrittensten Staaten des westlichen Kapitalismus zutage, wo staatliche wie private Ideologien zunehmend von den Werten eines absolut asozialen Individualismus dominiert wurden – obgleich häufig auch jene, die ihn selbst verkörperten, die sozialen Folgen beklagten. Aber diese Tendenz trat auch anderswo auf und wurde nicht nur von der Erosion der traditionellen Gesellschaften und Religionen gefordert, sondern auch durch die Zerstörung oder Selbstzerstörung der Gesellschaften des »real existierenden Sozialismus«.
Eine solche Gesellschaft, die nur noch aus einer unzusammenhängenden Ansammlung von egozentrischen, der Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse nachjagenden (sei es zu Profitzwecken oder zum Vergnügen) Individuen besteht, war der kapitalistischen Wirtschaftstheorie immer eingewoben. Und seit dem Zeitalter der Revolution haben Beobachter aller ideologischen Couleur immer diese schleichende Entwicklung verfolgt und die Auflösung der alten sozialen Bindungen folgerichtig vorhergesehen. Der eloquente Tribut, den das Kommunistische Manifest der revolutionären Rolle des Kapitalismus in der Praxis zollte, ist bekannt. (»Das Bürgertum … hat mitleidlos die feudalen Bindeglieder zerrissen, die den Menschen mit seinen ›natürlichen Vorgesetztem verbanden, und zwischen Mensch und Mensch keinen anderen Nexus belassen als nackten Eigennutz.‹) Doch in der Praxis der neuen und revolutionären kapitalistischen Gesellschaft sah es etwas anders aus.
Denn in der Praxis operierte diese neue Gesellschaft nicht, indem sie ihr gesamtes Erbe von der alten Gesellschaft zerstörte, sondern indem sie dieses Erbe selektiv für ihre eigenen Zwecke nutzte. Die Bereitschaft der bürgerlichen Gesellschaft, den »radikalen Individualismus in der Wirtschaft« einzuführen und »im Verlauf dieses Prozesses alle traditionellen gesellschaftlichen Beziehungen aufzulösen« (also dort, wo sie ihr im Weg stehen), ist kein »soziologisches Puzzle«, ebensowenig wie die Angst vor einem kulturellen (und auf Verhalten wie Moral bezogenen) »radikal-experimentellen Individualismus« (Daniel Bell, 1976, S. 18). Denn die wirksamste Art und Weise, eine auf Privatunternehmen basierende Industriewirtschaft aufzubauen, ist, sie mit Motivationen zu verknüpfen, die nichts mit der Logik des freien Marktes zu tun haben – also beispielsweise mit der protestantischen Ethik; mit dem Verzicht auf unmittelbar eintretenden Erfolg; mit dem Ethos der harten Arbeit; mit familiärem Pflichtgefühl und Vertrauen, aber gewiß nicht mit der antinomistischen Rebellion von Individuen.
Doch Marx und die anderen Propheten der Zerstörung aller alten Werte und sozialen Beziehungen hatten recht. Der Kapitalismus war die Kraft der permanenten, ununterbrochenen Revolution. Logischerweise mußte er auch jene Teile der vorkapitalistischen Vergangenheit zerstören, die für seine eigene Entwicklung notwendig und vielleicht sogar entscheidend gewesen waren. Früher oder später mußte er mindestens einen der Äste absägen, auf denen er selbst saß. Ebendas geschah seit Mitte des Jahrhunderts. Unter dem Einfluß der so überaus starken wirtschaftlichen Explosion des Goldenen Zeitalters und später, während der von ihr bewirkten sozialen und kulturellen Veränderungen – der tiefgreifendsten gesellschaftlichen Revolution seit der Steinzeit –, begann der Ast zu knacken und zu brechen. Am Ende dieses Jahrhunderts war es zum erstenmal möglich, sich eine Welt vorzustellen, in der die Vergangenheit (auch die Vergangenheit der Gegenwart) keine Rolle mehr spielt, weil die alten Karten und Pläne, die Menschen und Gesellschaften durch das Leben geleitet haben, nicht mehr der Landschaft entsprachen, durch die wir uns bewegten, und nicht mehr dem Meer, über das wir segelten. Eine Welt, in der wir nicht mehr wissen können, wohin uns unsere Reise führt, ja nicht einmal, wohin sie uns führen sollte.
Dies ist die Situation, mit der ein Teil der Menschheit bereits Ende dieses Jahrhunderts zurechtkommen muß und auf die sich noch viel mehr Menschen im neuen Jahrtausend einstellen müssen. Doch dann wird vielleicht schon klarer als heute geworden sein, wohin die Menschheit geht. Wir können nur zurückblicken und feststellen, was auf dem Wege lag, der uns bis hierher geführt hat. Das habe ich in diesem Buch versucht. Wir wissen zwar nicht, wovon unsere Zukunft geprägt sein wird; doch ich habe der Versuchung nicht widerstehen können, auch über künftige Probleme nachzudenken, jedenfalls sofern sie aus den Ruinen jener Periode auftauchen werden, die gerade zu Ende gegangen ist. Hoffentlich wird es eine bessere, gerechtere und lebenswertere Welt sein. Das alte Jahrhundert hat kein gutes Ende genommen.
* Ich habe versucht, den Aufstieg dieser Zivilisation in einer dreibändigen Geschichte des »Langen 19. Jahrhunderts« (1780 bis 1914) darzustellen und die Gründe für ihren Zusammenbruch zu analysieren. Hier werde ich immer wieder einmal, wo es sinnvoll erscheint, auf diese Bände Bezug nehmen: Europäische Revolutionen 1789–1848; Die Blütezeit des Kapitals 1848–1875; und Das imperiale Zeitalter 1875–1914.