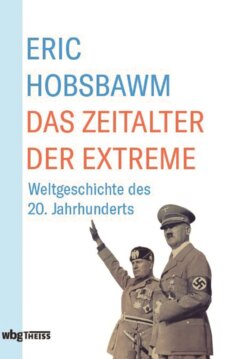Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 8
Vorwort
ОглавлениеNiemand kann heute die Geschichte des 20. Jahrhunderts darstellen wie die eines anderen Zeitalters; und sei es nur deshalb, weil kein Mensch die Ära seiner eigenen Lebenszeit so beschreiben kann (und darf), als sei sie Bestandteil einer Periode, die er nur als Außenstehender kennt, aus zweiter oder dritter Hand, aus zeitgenössischen Quellen oder den Werken nachgeborener Historiker. Meine Lebenszeit umfaßt beinahe den gesamten Zeitraum, mit dem sich dieses Buch beschäftigt und an dessen politischer und gesellschaftlicher Entwicklung ich von meinen Jugendjahren bis heute, also die längste Zeit meines Lebens, bewußt teilgenommen habe. Damit will ich sagen, daß sich meine Ansichten und Vorurteile eher durch mein Leben als Zeitzeuge denn als Wissenschaftler geprägt haben. Deshalb habe ich auch während meiner ganzen Berufsjahre als Historiker zu vermeiden versucht, über die Ära seit 1914 zu schreiben, obgleich ich mich in anderer Eigenschaft durchaus darauf eingelassen habe. »Meine Periode« ist, so meint die Zunft, das 19. Jahrhundert. Doch mittlerweile halte ich es durchaus für möglich, auch das »Kurze 20. Jahrhundert« – von 1914 bis zum Ende der Sowjetzeit – aus einer bestimmten historischen Perspektive zu betrachten. Ich selbst werde dies allerdings tun, ohne die gesamte wissenschaftliche Literatur gelesen oder mehr als nur einen winzigen Überblick über all die archivarischen Quellen zu haben, die die so überaus zahlreichen Historiker des 20. Jahrhunderts aufgehäuft haben.
Schlechterdings unmöglich ist es für einen einzelnen natürlich auch, die Geschichtsschreibung über das gegenwärtige Jahrhundert zu kennen, nicht einmal diejenige, die in einer einzigen führenden Sprache niedergeschrieben worden ist – etwa so, wie der Historiker der klassischen Antike oder des Byzantinischen Reichs über alles Bescheid wissen kann, was während dieser und über diese langen Perioden geschrieben wurde. Nun: Mein eigenes Wissen über dieses Jahrhundert besteht, gerade an den Maßstäben historischer Gelehrsamkeit im Bereich der Zeitgeschichte gemessen, in einem zufällig entstandenen, bunten Mosaik. Das Äußerste, wozu ich fähig war, war, in die Literatur zu besonders widerspenstigen und umstrittenen Problemen einzutauchen – beispielsweise zur Geschichte des Kalten Krieges oder der dreißiger Jahre –, bis ich schließlich die Gewißheit hatte, daß meine Ansichten, wie sie in diesem Buch dargelegt sind, auch dem Licht fachlicher Forschung standhalten würden. Vollkommen konnte dieses Unterfangen natürlich nicht gelingen. Noch immer bleibt eine Reihe von Fragen offen, die nicht nur meine Unkenntnis, sondern auch meine durchaus kontroversen Ansichten offenbaren werden.
Dieses Buch ruht also auf merkwürdig schiefen Fundamenten. Abgesehen vom ausgiebigen Studium der unterschiedlichsten Literaturen während ziemlich vieler Jahre (ergänzt durch das, was zu lesen notwendig war, um Vorlesungen über die Geschichte des 20. Jahrhunderts vor den Graduiertenstudenten der New School for Social Research halten zu können), habe ich aus dem angesammelten Wissen, den Erinnerungen und Meinungen eines Menschen geschöpft, der das Kurze 20. Jahrhundert in recht zahlreichen Ländern als »teilnehmender Beobachter« erlebt hat, wie es die Sozialanthropologen nennen, oder auch einfach nur als Reisender mit offenen Augen oder als Kibbitzer, wie meine Vorfahren es genannt hätten. Der historische Wert solcher Erfahrungen hängt nicht davon ab, ob man Zeuge großer geschichtlicher Ereignisse war oder ob man über prominente Geschichtemacher und Staatsmänner Bescheid weiß und ihnen vielleicht sogar persönlich begegnet ist. Meine eigene Erfahrung als gelegentlicher Journalist bei Recherchen in diesem oder jenem Land – hauptsächlich in Lateinamerika – hat mich vielmehr gelehrt, daß Gespräche mit Staatspräsidenten oder anderen Entscheidungsträgern normalerweise nicht besonders lohnend sind, weil solche Personen im Grunde nur das sagen, was die Öffentlichkeit hören soll. Wirklich Erhellendes kommt fast immer nur von solchen Menschen, die frei sprechen können oder wollen, was vor allem dann der Fall ist, wenn sie keine besonders große öffentliche Verantwortung tragen. Dennoch hat es mir enorm geholfen, Schauplätze selbst gesehen und Menschen persönlich kennengelernt zu haben – selbst dann, wenn deren unvermeidliche Parteilichkeit in die Irre führen mochte. Und allein schon Besuche in einer bestimmten Stadt – etwa in Valencia oder Palermo – in einem Intervall von dreißig Jahren führten einem vor Augen, mit welcher Geschwindigkeit und in welchem Ausmaß sich die sozialen Strukturen im dritten Viertel des gegenwärtigen Jahrhunderts verändert haben. Allein schon eine verborgene und manchmal aus keinem ersichtlichen Grund gespeicherte Erinnerung an etwas, das lange zuvor in einem Gespräch gesagt wurde, konnte plötzlich ein Bild abrunden. Wenn ein Historiker aus diesem Jahrhundert überhaupt schon sinnvolle Schlüsse ziehen kann, dann zum gut Teil dank seiner Beobachtungen und seiner Fähigkeit zum Zuhören. Ich hoffe, es wird mir gelingen, dem Leser zu vermitteln, was ich auf diese Weise gelernt habe.
Dieses Buch basiert natürlich auch auf Informationen, die ich von Kollegen, Studenten und all jenen erhalten habe, die ich während der Arbeit am Manuskript zu Rate gezogen habe. In einigen Fällen bin ich dabei durchaus methodisch vorgegangen. Das Kapitel über die Wissenschaften habe ich meinen Freunden Alan Mackay, der nicht nur Kristallograph, sondern auch Enzyklopädist ist, und John Maddox, dem Herausgeber der Zeitschrift Nature, vorgelegt. Einiges von dem, was ich über ökonomische Entwicklungen geschrieben habe, wurde von Lance Taylor gegengelesen, einem meiner Kollegen an der New School, ehemals Forscher am M.I.T. Der bei weitem größte Teil aber basiert auf dem Studium von Zeitungen und der Teilnahme an Diskussionen. Indem ich meine Ohren offenhielt, konnte ich vieles bei Konferenzen über die unterschiedlichsten makroökonomischen Probleme lernen, die im World Institute for Development and Economic Research an der UN-Universität (UNU/WIDER) in Helsinki stattfanden, das sich unter der Leitung von Dr. Lal Jayawardena zu einem bedeutenden internationalen Forschungs- und Diskussionszentrum verwandelt hat. Von unschätzbarem Wert waren auch die Sommer, die ich als McDonnell Douglas Visiting Scholar an diesem bewundernswerten Institut verbringen konnte. Vor allem konnte ich von der Tatsache profitieren, daß es der ehemaligen Sowjetunion so eng benachbart ist und sich intellektuell so stark mit ihr auseinandersetzte. Nicht immer habe ich die Ratschläge von Kollegen befolgt, und wenn, dann sind eventuell falsche Interpretationen und Schlußfolgerungen natürlich nicht Schuld des Ratgebers. Großen Nutzen zog ich auch aus Konferenzen und Kolloquien, bei denen Akademiker viel Zeit zubringen und Kollegen sich vor allem deshalb treffen, um sich mit intellektuellen Anleihen von anderen zu versorgen. Es ist mir unmöglich, all jene Kollegen aufzuzählen, die mich bei offiziellen und weniger offiziellen Gelegenheiten zu meinem Gewinn unterstützt oder korrigiert haben. Das gilt auch für all jene Informationen, die ich ganz nebenbei ansammeln konnte, weil ich das Glück hatte, eine ganz besonders internationale Gruppe von Studenten an der New School for Social Research in New York zu unterrichten. Dennoch soll hervorgehoben sein, wieviel ich aus den Semesterarbeiten von Ferdan Ergut und Alex Julca über die türkische Revolution und über die Migration und Mobilität der Gesellschaften in der Dritten Welt gelernt habe. Zu Dank verpflichtet bin ich auch meiner Studentin Margarita Giesecke und ihrer Dissertation über APRA und den Trujillo-Aufstand 1932.
Je näher ein Historiker des 20. Jahrhunderts der Gegenwart kommt, um so abhängiger wird er (oder sie) von zwei Arten von Quellen: von Tagespresse, Magazinen und den regelmäßigen Berichten, Wirtschaftsanalysen und anderen Publikationen oder statistischen Sammelwerken von nationalen Regierungen und internationalen Institutionen.
Meine Dankesschuld gegenüber solchen Zeitungen wie dem Londoner Guardian, der Financial Times und der New York Times ist offensichtlich. Aus der Bibliographie wird auch ersichtlich, wieviel ich den unschätzbar hilfreichen Publikationen der Vereinten Nationen, ihrer verschiedenen Agenturen und der Weltbank verdanke. Aber auch der Vorgänger der UN, der Völkerbund, sollte nicht unerwähnt bleiben. Obwohl dieser praktisch beinahe völlig versagt hatte, verdienen seine vorzüglichen ökonomischen Studien und Analysen unsere Dankbarkeit, vor allem die wegbereitende Studie Industrialisation and World Trade aus dem Jahr 1945. Ohne derartige Quellen könnte niemand eine Geschichte des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandels in diesem Jahrhundert schreiben.
Das meiste in diesem Buch, abgesehen von den eindeutig persönlichen Urteilen des Autors, wird der Leser auf Treu und Glauben hinnehmen müssen. Es schien mir kaum sinnvoll, ein solches Buch mit einem ausführlichen Quellenverzeichnis oder anderen Zeichen von Gelehrsamkeit zu überladen. Vielmehr habe ich versucht, Hinweise nur auf die Quellenangaben tatsächlich verwendeter Zitate, Statistiken und andere quantitative Angaben zu beschränken – verschiedene Quellen ergeben manchmal auch verschiedene Zahlen –, und gelegentlich habe ich auch solche Aussagen belegt, die der Leser ungewöhnlich, erstaunlich oder überraschend finden mag. An manchen Stellen schien mir auch ein Beleg für meine eigenen kontroversen Ansichten nötig. Derartige Hinweise werden im Verlauf des Textes in Klammern angegeben. Die vollständige Quellenangabe befindet sich im Anhang des Buches. Doch auch diese Bibliographie ist nur die Auflistung all jener Quellen, die tatsächlich zitiert oder bezugnehmend im Text verwendet wurden, und keine systematische Anleitung zu weiterführender Lektüre. Kurze Hinweise auf Werke, die der Vertiefung dienen, finden sich in einer separaten Liste. Anmerkungen verstärken oder modifizieren im wesentlichen nur den Text.
An dieser Stelle möchte ich noch auf Werke verweisen, denen ich besonders viele Kenntnisse verdanke und deren Autoren angemessen gewürdigt werden sollten. Viel habe ich den Büchern zweier Freunde entnommen: von dem Wirtschaftshistoriker und unermüdlichen Sammler von quantitativen Daten Paul Bairoch und von Ivan Berend, dem ehemaligen Präsidenten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, dem ich das Konzept des »Kurzen 20. Jahrhunderts« verdanke. Ein zuverlässiger und verständlicherweise manchmal auch gestrenger Führer durch die allgemeine politische Weltgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg war P. Calvocoressi: World Politics Since 1945. Besondere Kenntnisse über den Zweiten Weltkrieg verdanke ich dem vorzüglichen Buch War, Economy and Society 1939–45 von Alan Milward; und für die Wirtschaftsgeschichte nach 1945 fand ich Herman Van der Wees Prosperity and Upheaval: The World Economy 1945–1980 sowie Capitalism Since 1945 von Philip Armstrong, Andrew Glyn und John Harrison außerordentlich nützlich. Martin Walkers The Cold War verdient weit mehr Aufmerksamkeit, als laue Kritiker ihm zugestanden haben. Hinsichtlich der Geschichte der Linken seit dem Zweiten Weltkrieg verdanke ich sehr viel Dr. Donald Sassoon vom Queen Mary and Westfield College der Universität London, der mir freundlicherweise seine bislang unveröffentlichte, umfassende und scharfsinnige Studie über dieses Thema überließ. Kenntnisse über die Geschichte der Sowjetunion erhielt ich vor allem aus den Werken von Moshe Lewin, Alec Nove, R. W. Davies und Sheila Fitzpatrick; über China aus den Büchern von Benjamin Schwartz und Stuart Schram; und über die islamische Welt aus den Werken von Ira Lapidus und Nikki Keddie. Meine Ansichten über die Kunst verdanken vieles John Willetts Arbeiten über die Weimarer Kultur (und das Gespräch mit ihm) und Francis Haskell. Das Sechste Kapitel zeigt, wieviel ich Lynn Garafolas Diaghilev entnommen habe.
Mein besonderer Dank aber gilt all jenen, die mir tatkräftig bei der Vorbereitung dieses Buches geholfen haben. Dazu zählen in erster Linie meine Forschungsassistentinnen Joanna Bedford in London und Lise Grande in New York. Ohne die Hilfe von Ms. Grande wäre ich nicht in der Lage gewesen, meine enormen Wissenslücken zu füllen und nur vage erinnerte Fakten und Hinweise zu verifizieren. Besonders danke ich auch Ruth Syers, die meine Manuskripte tippte, und Marlene Hobsbawm, welche die Kapitel aus dem Blickwinkel des nichtakademischen, aber grundlegend an der modernen Welt interessierten Lesers las, an den sich dieses Buch richtet.
Wieviel ich den Studenten der New School verdanke, die meinen Vorlesungen zugehört haben, in denen ich meine Ideen und Interpretationen darzulegen versucht habe, habe ich bereits erwähnt. Ihnen ist dieses Buch gewidmet.