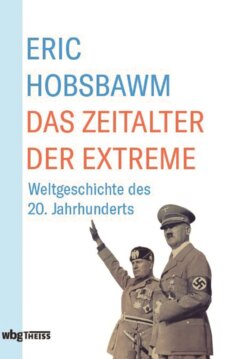Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 19
4
ОглавлениеEs bleibt noch einzuschätzen, welche Auswirkungen die Kriege auf die Menschen hatten und welche Kosten diese tragen mußten. Die schiere Masse der Opfer an Menschenleben, auf die wir bereits zu sprechen kamen, ist nur Teil dieser Kosten. Merkwürdigerweise – wenn wir aus verständlichen Gründen von der Sowjetunion absehen – sollten die wesentlich geringeren Verlustzahlen des Ersten Weltkriegs sehr viel stärkere Auswirkungen zeigen als das ungeheure Ausmaß der Verluste im Zweiten Weltkrieg. Das bezeugt die sehr viel größere Bedeutung von Gedenkstätten und Kulten für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Der Zweite Weltkrieg brachte keine entsprechenden Mahnmale »für den unbekannten Soldaten« hervor, und in der Nachkriegszeit verloren die Feiern zum »Jahrestag des Waffenstillstands« (vom 11. November 1918) immer mehr von jener weihevollen Würde, die sie in den Jahren zwischen den Kriegen geprägt hatte. Etwa zehn Millionen Tote wirkten sehr viel verstörender auf die, die niemals geglaubt hatten, ein solches Opfer bringen zu müssen, als vierundfünfzig Millionen Tote auf die, die bereits einmal durch die Erfahrung gegangen waren, daß Krieg ein Massaker ist10.
Die Totalität der Kriegsanstrengungen und die Entschlossenheit beider Seiten, Krieg ohne Grenzen und zu welchem Preis auch immer zu führen, wurden zum Markenzeichen. Ohne diese Fakten wäre die wachsende Brutalität und Unmenschlichkeit des 20. Jahrhunderts nur schwer zu erklären. Denn daß es seit 1914 zu immer mehr Barbarei gekommen war, daran ist unseligerweise kein ernsthafter Zweifel möglich. Anfang des 20. Jahrhunderts war Folter offiziell aus ganz Westeuropa verbannt. Seit 1945 haben wir uns wieder – und ohne große Abscheu zu zeigen – daran gewöhnt, daß zumindest in einem Drittel der UN-Mitgliedstaaten Folter angewendet wird, darunter auch in einigen der ältesten und zivilisiertesten Staaten11.
Diese zunehmende Brutalisierung lag nun nicht so sehr am latenten Potential von Grausamkeit und Gewalt, das der Mensch in sich birgt und das vom Krieg natürlich legitimiert wird – eine Legitimation, die nach dem Ersten Weltkrieg bei einem gewissen Typus des ehemaligen Soldaten (Veteran) zum Tragen kam und sich beispielsweise auch in den Todesschwadronen und »Freikorps«-Soldaten der nationalistischen Ultrarechten ausdrückte. Weshalb sollten Menschen, die selbst getötet hatten und ansehen mußten, wie Freunde gefoltert und getötet wurden, noch zögern, Feinde für einen guten Zweck zu foltern und zu töten?
Ein wichtiger Grund für diese Brutalisierung lag vielmehr in der seltsamen Demokratisierung des Krieges. Totale Kriege verwandelten sich in »Volkskriege«, weil Zivilisten und ziviles Leben zum geeigneten und manchmal auch eigentlichen Ziel der Strategie wurden und weil in demokratischen Kriegen der Gegner ebenso dämonisiert wird wie in der demokratischen Politik – denn nur so kann erreicht werden, daß er wirklich hassenswert oder zumindest verabscheuungswürdig erscheint. Kriege, die auf beiden Seiten von Berufskämpfern oder Spezialisten oft gleicher sozialer Herkunft geführt werden, schließen gegenseitigen Respekt sowie die Akzeptanz von Regeln und sogar Ritterlichkeit nicht aus. Auch Gewalt hat ihre Regeln. Das war noch unter den Kampfpiloten beider Weltkriege zu beobachten, wie es auch Jean Renoir in seinem pazifistischen Film über den Ersten Weltkrieg, Die große Illusion, darstellte. Professionellen Politikern oder Diplomaten ist es durchaus möglich, sofern sie von Wählern und Presse ungehindert agieren können, einen Krieg zu erklären oder Frieden auszuhandeln, ohne dabei Beklemmungen gegenüber der Gegenseite zu bekommen – wie Boxer, die sich die Hand geben, bevor sie aufeinander einschlagen, und sich nach dem Kampf gemeinsam betrinken. Nur, die totalen Kriege unseres Jahrhunderts waren weit von den Mustern der Bismarck-Ära oder des 18. Jahrhunderts entfernt. Kein Krieg, in dem die nationalen Gefühle der Massen mobilisiert werden, kann geführt werden, als sei er ein Krieg zwischen Aristokraten. Der Charakter des Hitlerregimes im Zweiten Weltkrieg und die Verhaltensweisen der Deutschen in Osteuropa, selbst das Verhalten der alten, nichtnazistischen deutschen Armee, lieferten übrigens, das muß gesagt werden, gute Gründe für die Dämonisierung.
Ein weiterer Grund für diese Brutalisierung war jedoch die neue Unpersönlichkeit der Kriegsführung, die das Töten oder Verstümmeln auf einen Akt reduzierte, der sich auf das Drücken einer Taste oder Bewegen eines Hebels beschränkte. Technologie macht ihre Opfer unsichtbar. Ein Mensch, der mit dem Bajonett erstochen oder durch das Visier einer Waffe angepeilt wird, ist sichtbar. Gegenüber den ständig fixierten Kanonen an der Westfront standen keine Menschen, sondern Statistiken – und nicht einmal reale, sondern hypothetische Statistiken, wie auch die body-counts der feindlichen Verluste während des amerikanischen Vietnamkrieges zeigten. Tief unter den Bombern befanden sich keine Menschen, die gerade verbrannt und verstümmelt werden sollten, sondern Ziele. Sensiblen jungen Männern, die sich ganz gewiß nicht hätten vorstellen können, ein Bajonett in den Bauch einer schwangeren jungen Frau zu stoßen, fiel es sehr viel leichter, Bomben auf London oder Berlin abzuwerfen oder Atombomben auf Nagasaki. Schwer arbeitende deutsche Bürokraten, die es gewiß unerträglich empfunden hätten, höchstpersönlich ausgemergelte Juden ins Schlachthaus treiben zu müssen, waren durch ihre nur indirekte persönliche Beteiligung durchaus imstande, Fahrpläne für den regelmäßigen Verkehr der Todeszüge in die deutschen Vernichtungslager nach Polen auszuarbeiten. Die schlimmsten Grausamkeiten unseres Jahrhunderts waren die unpersönlichen, die systematisch und routiniert aus der Ferne entschieden wurden – besonders dann, wenn sie als bedauerliche, aber unumgängliche Handlungen gerechtfertigt werden konnten.
Also gewöhnte sich die Welt an Zwangsvertreibung und Ausrottung in gewaltigen Ausmaßen – bis dahin waren dies derart unvertraute Phänomene gewesen, daß eigens für sie neue Worte erfunden werden mußten, wie »Apatride« (Staatenlose) oder »Genozid«. Der Erste Weltkrieg führte zur Ermordung von unzähligen Armeniern durch die Türken – für gewöhnlich wird die Zahl mit 1,5 Millionen angegeben –, was als erster moderner Versuch gelten kann, ein gesamtes Volk auszurotten. Ihm folgte die Massenermordung von etwa 5 Millionen Juden durch die Nazis – um die genaue Zahl wird wohl immer gestritten werden (Hilberg, 1985). Der Erste Weltkrieg und die Russische Revolution hatten Millionen Menschen als Flüchtlinge, oder im Rahmen von Zwangs-»Umsiedlungen« von Staat zu Staat, in Marsch gesetzt. 1,3 Millionen Griechen, hauptsächlich aus der Türkei, wurden nach Griechenland repatriiert; 400 000 Türken wurden in den Staat umgesiedelt, der Anspruch auf sie erhob; etwa 200000 Bulgaren zogen in das verkleinerte Territorium, das ihren Nationalnamen trug; und zwischen 1,5 und 2 Millionen Menschen russischer Nationalität, die der Russischen Revolution entflohen waren oder zur Verliererseite des russischen Bürgerkriegs gehörten, wurden heimatlos. Wohl mehr für sie als für die 320 000 vor dem Genozid flüchtenden Armenier wurde ein neues Dokument erfunden, das für alle jene gelten sollte, die in einer zunehmend bürokratischen Welt keine bürokratische Existenz in irgendeinem Staat mehr hatten: der sogenannte Nansen-Paß des Völkerbunds, dessen Namengebung den großen norwegischen Arktisforscher ehren sollte, der in seiner zweiten Karriere zum Freund der Verlassenen wurde. Grob geschätzt erzeugten die Jahre 1914–22 4–5 Millionen Flüchtlinge.
Dieses menschliche Strandgut, das mit der ersten Flut angeschwemmt worden war, war jedoch noch gar nichts, gemessen an der, die auf den Zweiten Weltkrieg folgen sollte, aber auch verglichen mit der Unmenschlichkeit, mit der die zweite Flüchtlingsflut behandelt wurde. Es wird geschätzt, daß es im Mai 1945 etwa 40,5 Millionen entwurzelter Menschen in Europa gab, wobei die nichtdeutschen Zwangsarbeiter und Deutsche, die vor der vorrückenden Roten Armee geflüchtet waren, noch gar nicht mitgezählt sind.12 Etwa 13 Millionen Deutsche wurden aus jenen Gebieten Deutschlands vertrieben, die von Polen und der Sowjetunion, von der Tschechoslowakei und von Teilen Südosteuropas, wo sie seit langer Zeit gesiedelt hatten, annektiert worden waren.13 Sie wurden von der neuen Bundesrepublik übernommen, die jedem Deutschen Heim und Staatsangehörigkeit anbot, der nach Deutschland zurückkehren wollte, ähnlich dem neuen Staat Israel, der jedem Juden das »Recht auf Rückkehr« garantierte. Wann, wenn nicht in einer Epoche der Massenflucht, hätten solche Angebote von Staaten ernsthaft gemacht werden können? Von den 11 223 700 Verschleppten (displaced persons) unterschiedlichster Nationalitäten, die von den Siegermächten 1945 in Deutschland registriert wurden, kehrten 10 Millionen bald schon in ihre jeweilige Heimat zurück, doch die Hälfte von ihnen gegen ihren Willen.14
Dies waren nur die Flüchtlinge in Europa. Die Dekolonialisierung Indiens im Jahr 1947 schuf 15 Millionen Flüchtlinge, die gezwungen wurden, (in beiden Richtungen) über die Grenze zwischen Indien und Pakistan zu wechseln, wobei die 2 Millionen Tote des Bürgeraufstands nicht mitgezählt sind. Der Koreakrieg, ein weiteres Nebenprodukt des Zweiten Weltkriegs, produzierte etwa 5 Millionen Verschleppte. Nach der Gründung Israels – noch eine Folge des Krieges – wurden etwa 1,3 Millionen Palästinenser bei der UNWRA (United Nations Work and Relief Agency) registriert, wohingegen bis in die frühen sechziger Jahre 1,2 Millionen Juden, die Mehrzahl von ihnen Flüchtlinge, nach Israel einwanderten. Die weltweite menschliche Katastrophe, die der Zweite Weltkrieg ausgelöst hatte, war die größte, die es je in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Und die nicht geringste Tragik bei dieser Katastrophe liegt darin, daß die Menschheit gelernt hat, in einer Welt zu leben, in der Mord, Folter und Massenvertreibung zu einer so alltäglichen Erfahrung wurden, daß wir sie gar nicht mehr beachten.
Der Rückblick auf die einunddreißig Jahre zwischen der Ermordung des österreichischen Erzherzogs in Sarajevo und der bedingungslosen Kapitulation Japans zeigt, daß dies eine Ära der Verwüstung war, die nur dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert der deutschen Geschichte vergleichbar ist. Und Sarajevo – das erste Sarajevo – markierte den Beginn eines Zeitalters der Katastrophen und Krisen in der Welt, die das Thema des nächsten Kapitels sind. Und dennoch: Im Gedächtnis der Generationen nach 1945 prägte sich dieser einunddreißig-jährige Krieg nicht auf die gleiche Weise als historische Erinnerung ein wie sein lokal begrenzter Vorgänger aus dem 17. Jahrhundert.
Das kommt daher, weil der einunddreißigjährige Krieg nur in der Perspektive des Historikers eine zusammenhängende Kriegsära bildet. Für all jene, die diese Zeit erlebt haben, waren es zwei völlig verschiedene, wenn auch miteinander verbundene Kriege, unterbrochen von einer »Zwischenkriegszeit«, in der es keine offenen Feindseligkeiten gab – ein Zeitraum von 13 Jahren in Japan (dessen zweiter Krieg 1931 in der Mandschurei begann), aber von 23 Jahren in den USA (die erst im Dezember 1941 in den Zweiten Weltkrieg eintraten). Es kommt aber auch daher, weil jeder dieser Weltkriege seinen eigenen historischen Charakter und sein eigenes Profil hatte. Beide waren Episoden beispiellosen Gemetzels und hinterließen technologische Alptraumbilder, die die nächsten Generationen bei Tag und bei Nacht verfolgen sollten: Giftgas und Flächenbombardierung nach 1918, die Pilzwolke der atomaren Zerstörung nach 1945. Beide endeten im Zusammenbruch und – wie wir im nächsten Kapitel sehen werden – mit einer sozialen Revolution in großen Teilen Europas und Asiens. Beide hinterließen erschöpfte und geschwächte Kriegsparteien, ausgenommen die USA, die aus beiden unversehrt, noch wohlhabender und als ökonomischer Herr der Welt auftauchten. Und doch, wie auffallend die Unterschiede! Der Erste Weltkrieg löste gar nichts. Die Hoffnungen, die er ausgelöst hatte – auf eine friedliche und demokratische Welt aus Nationalstaaten unter der Oberhoheit des Völkerbunds; auf eine Wiederkehr der Weltwirtschaft von 1913 und (von denjenigen, die die Russische Revolution begeistert begrüßten) auf einen Weltkapitalismus, der innerhalb von Jahren oder auch nur Monaten durch den Aufstand der Unterdrückten niedergeschlagen werden könnte –, wurden bald schon enttäuscht. Die Vergangenheit war unerreichbar geworden, die Zukunft war auf unbestimmte Zeit aufgeschoben, und die Gegenwart war bitter, abgesehen von einer kurzen Zeit Mitte der zwanziger Jahre. Der Zweite Weltkrieg hat hingegen tatsächlich für zumindest einige Jahrzehnte Lösungen geschaffen. Die dramatischen sozialen und ökonomischen Probleme des Kapitalismus schienen sich während des Katastrophenzeitalters aufgelöst zu haben; die westliche Weltwirtschaft trat in ihr Goldenes Zeitalter ein; die westliche politische Demokratie, von einer außergewöhnlichen Verbesserung des materiellen Wohlstands gestützt, war stabil; und Kriege wurden in die Dritte Welt verbannt. Andererseits aber hatte auch die Revolution ihren Weg gemacht. Die alten Kolonialmächte verschwanden oder wurden kurzerhand gezwungen abzutreten; und ein Konsortium kommunistischer Staaten, das um die Sowjetunion herum organisiert war, wandelte sich zur Supermacht und schien bereit, mit dem Westen in Wettbewerb um Wirtschaftswachstum zu treten. Sogar die internationale Bühne schien stabil. Aber all dies hat sich als Illusion erwiesen – allerdings erst, als sich die sechziger Jahre zu verabschieden begannen. Im Gegensatz zur Zeit nach dem Großen Krieg waren diesmal die ehemaligen Feinde – Deutschland und Japan – wieder in die (westliche) Weltwirtschaft eingegliedert worden und konnten sich die beiden neuen Feinde – die USA und die Sowjetunion – niemals wirklich handelseinig werden.
Sogar die Revolutionen, die am Ende beider Kriege auftraten, unterschieden sich voneinander. Die Revolutionen nach dem Ersten Weltkrieg wurzelten, wie wir noch sehen werden, in der Auflehnung gegen das, was die meisten Menschen durchlebt und zunehmend als sinnlose Schlachterei begriffen hatten. Es waren Revolutionen gegen den Krieg. Die Revolutionen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden aus der Teilnahme ganzer Völker an einem Kampf der ganzen Welt gegen ihre Feinde – Deutschland, Japan – oder, allgemeiner gesagt: gegen den Imperialismus. Es war ein Kampf, den alle, die an ihm teilnahmen, als gerecht empfanden, wie schrecklich er auch gewesen sein mochte. Und doch können diese beiden Arten von Nachkriegsrevolutionen, wie auch die beiden Weltkriege, aus historischer Perspektive als ein einziger Prozeß betrachtet werden. Diesem werden wir uns nun zuwenden.