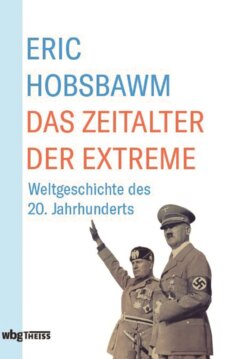Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 16
1
Оглавление»Jetzt verlöschen die Lichter in ganz Europa«, sagte Edward Grey, Außenminister von Großbritannien, während er an jenem Abend im Jahr 1914, als Großbritannien und Deutschland in den Krieg eintraten, auf die Lichter von Whitehall blickte. »Wir werden sie nie wieder in unserem Leben brennen sehen.« In Wien bereitete sich der große Satiriker Karl Kraus darauf vor, diesen Krieg in einem ungewöhnlichen Reportagedrama von 792 Seiten zu dokumentieren und zu brandmarken, dem er den Titel Die letzten Tage der Menschheit gab. Beide sahen mit diesem Weltkrieg das Ende der Welt gekommen, und damit standen sie nicht allein. Es war nicht das Ende der Menschheit, obwohl es im Verlauf der einunddreißig Jahre des Weltkonflikts zwischen dem 28. Juli 1914, als Österreich Serbien den Krieg erklärte, und der bedingungslosen Kapitulation Japans am 14. August 1945 – vier Tage nach der Explosion der ersten Atombombe – Augenblicke gegeben hat, in denen das Ende eines beträchtlichen Anteils der Menschheit nicht weit entfernt schien. Es hat sicher Zeiten gegeben, zu denen der Gott oder die Götter, die fromme Menschen als Schöpfer der Welt und von allem, was in ihr ist, verehren, bedauert haben dürften, ebendas getan zu haben.
Die Menschheit hat überlebt. Doch das großartige Bauwerk der Zivilisation des 19. Jahrhunderts brach in den Flammen des Weltkriegs zusammen, als seine Säulen einstürzten. Das Kurze 20. Jahrhundert wäre ohne diese Geschichte nicht zu verstehen. Es war von Krieg gekennzeichnet. Es hat in den Vorstellungen eines Weltkriegs gelebt und gedacht, selbst als die Kanonen schwiegen und keine Bomben mehr explodierten. Seine Geschichte, genauer gesagt die Geschichte des Zeitalters seit dem Beginn seines Zusammenbruchs und der Katastrophe, muß mit der Geschichte des einunddreißigjährigen Weltkriegs beginnen.
Für viele, die vor 1914 aufgewachsen waren – wozu auch die Generation der Eltern des Autors und deren mitteleuropäische Familienmitglieder gehörten –, war der Kontrast derart dramatisch, daß sie sich weigerten, überhaupt irgendeine Kontinuität zur Vergangenheit zu sehen. »Im Frieden«, das bedeutete: »vor 1914«. Danach kam etwas, das diese Bezeichnung nicht länger verdiente. Und das war verständlich. Denn 1914 hatte es seit einem Jahrhundert keinen großen Krieg gegeben, das heißt einen Krieg, in den alle oder zumindest die Mehrheit der wichtigsten Staaten verwickelt gewesen wären. Die entscheidenden Figuren im internationalen Spiel waren damals die sechs europäischen »Großmächte« (Großbritannien, Frankreich, Rußland, Österreich-Ungarn, Preußen – nach 1871 vergrößert als Deutschland – und, nachdem es vereint war, Italien) sowie die USA und Japan. Es hatte nur einen einzigen kurzen Krieg gegeben, bei dem mehr als zwei Großmächte in die Schlacht gezogen waren: den Krimkrieg (1854–56) zwischen Rußland auf der einen und Großbritannien und Frankreich auf der anderen Seite. Hinzu kommt, daß die meisten Kriege, in die überhaupt Großmächte verwickelt waren, vergleichsweise kurz gewesen waren. Der bei weitem längste war denn auch kein internationaler Konflikt, sondern ein Bürgerkrieg innerhalb der USA (1861 -65). Die Dauer eines Krieges wurde in Monaten oder sogar nur Wochen gemessen (wie der Krieg 1866 zwischen Preußen und Österreich). Zwischen 1871 und 1914 hatte es in Europa überhaupt keine Kriege gegeben, bei denen die Armeen der Großmächte eine feindliche Grenze überschritten hätten, obgleich Japan im Fernen Osten Rußland bekämpfte und besiegte (1904–05) und damit die Russische Revolution beschleunigte.
Weltkriege hatte es überhaupt nicht gegeben. Im 18. Jahrhundert hatten Frankreich und Großbritannien zwar eine Reihe von Kriegen bestritten, deren Schlachtfelder in Indien, Nordamerika und anderswo jenseits der Weltozeane lagen. Doch zwischen 1815 und 1914 hatte keine Großmacht eine andere außerhalb ihres unmittelbaren Machtbereichs bekämpft, obwohl natürlich Feldzüge von Imperien oder Möchtegernimperien gegen schwächere Feinde in Übersee an der Tagesordnung waren. Dies waren meist spektakulär einseitige Kämpfe, wie die Kriege der USA gegen Mexiko (1846–48) und Spanien (1898) oder die verschiedenen Feldzüge der Briten und Franzosen, um ihre Kolonialreiche zu vergrößern. Allerdings, sogar der Wurm krümmte sich das eine oder andere Mal, beispielsweise als sich Frankreich in den 1860er Jahren aus Mexiko zurückziehen mußte oder die Italiener 1896 zum Abzug aus Äthiopien genötigt waren. Dennoch, selbst die stärksten Gegner der modernen Staaten, die ihre Arsenale mit immer mehr überwältigend überlegener Todestechnologie füllten, konnten bestenfalls darauf hoffen, den unvermeidlichen Rückzug hinauszuschieben. Derart exotische Konflikte waren der Stoff, aus dem Abenteuerliteratur entstand oder die Berichte einer neuen Erfindung des mittleren 19. Jahrhunderts – des Kriegskorrespondenten –, aber sie hatten keine unmittelbare Relevanz für die Mehrzahl der Bewohner jener Staaten, die diese imperialen Kriege führten und gewannen.
All dies änderte sich 1914 schlagartig. Der Erste Weltkrieg verwickelte alle Großmächte und alle europäischen Staaten, außer Spanien, den Niederlanden, den drei skandinavischen Staaten und der Schweiz. Darüber hinaus wurden – und das häufig zum erstenmal – Truppen aus der Welt jenseits der Ozeane in den Kampf und zur Arbeit außerhalb ihrer eigenen Regionen geschickt. Kanadier kämpften in Frankreich, Australier und Neuseeländer schmiedeten ihr Nationalbewußtsein auf der ägäischen Halbinsel »Gallipoli«, die zu ihrem Nationalmythos werden sollte. Aber wichtiger noch war, daß die USA George Washingtons Warnung vor »europäischen Verwicklungen« in den Wind schlugen und ihre Männer ebendorthin zum Kampf schickten – und damit den Lauf der Geschichte des 20. Jahrhunderts bestimmten. Inder wurden nach Europa und in den Nahen Osten geschickt, chinesische Arbeitsbataillone fanden sich im Westen wieder, Afrikaner kämpften in der französischen Armee. Die militärischen Aktionen außerhalb Europas waren, vom Nahen Osten einmal abgesehen, nicht von großer Bedeutung, der Seekrieg hingegen war wiederum global: sein erster Kampf wurde 1914 vor den Falklandinseln und seine entscheidenden Schlachten von deutschen Unterseebooten und alliierten Konvois auf und unter der Nordsee und inmitten des Atlantiks geführt.
Daß der Zweite Weltkrieg im buchstäblichen Sinne weltweit war, bedarf kaum eines Beweises. Tatsächlich waren alle unabhängigen Staaten der Welt freiwillig oder unfreiwillig involviert, obschon die Republiken Lateinamerikas eigentlich nur nominell beteiligt waren. Und die Kolonien der imperialen Mächte hatten dabei keine Wahl. Abgesehen von der zukünftigen Republik Irland, Schweden, Schweiz, Portugal, Türkei und Spanien in Europa, und möglicherweise auch Afghanistan außerhalb Europas, führte die gesamte Welt Krieg oder war besetzt, oder beides. Und was die Schlachtfelder anging, so wurden derart exotische Namen wie der der Melanesischen Inseln oder von Siedlungen in der nordafrikanischen Wüste oder aus Birma und den Philippinen Zeitungslesern und Radiohörern – dies war im wesentlichen der Krieg der Radionachrichten – überall ebenso vertraut wie die Namen von arktischen und kaukasischen Schlachten, von der Normandie, Stalingrad oder Kursk. Der Zweite Weltkrieg war ein Lehrstück in Weltgeographie.
Lokale, regionale oder globale Kriege des 20. Jahrhunderts sollten ein weit größeres Ausmaß annehmen als alles, was jemals zuvor geschehen war. Unter den vierundsiebzig internationalen Kriegen zwischen 1816 und 1965, die von amerikanischen Spezialisten (die solche Dinge gerne verrichten) nach der Anzahl von Menschen katalogisiert wurden, die in ihnen umgekommen sind, gehörten die ersten vier auf der Liste dem 20. Jahrhundert an: beide Weltkriege, der japanische Krieg gegen China 1937–39 und der Koreakrieg. Die Zahl der Menschen, die in jedem dieser Kriege auf den Schlachtfeldern getötet wurden, begann bei einer Million. Der größte aller dokumentierten Kriege des postnapoleonischen 19. Jahrhunderts, 1870–71 zwischen Preußen-Deutschland und Frankreich, hatte etwa 150000 Opfer gefordert, was allein schon der Zahl der Gefallenen in den Chaco-Kriegen 1932–35 zwischen Bolivien (mit einer Bevölkerungszahl von ca. 3 Millionen) und Paraguay (Bevölkerung ca. 1,4 Millionen) entsprach. Kurz gesagt, 1914 begann das Zeitalter des Massakers.1
In diesem Buch ist kein Raum für die ausführliche Darstellung der Gründe und Auslöser für den Ersten Weltkrieg, um die sich der Autor an anderer Stelle bemüht hat (Hobsbawm, 1987). Er begann als ein seiner Natur nach europäischer Krieg, mit der Dreierallianz Frankreich, Großbritannien und Rußland auf der einen und den sogenannten »Mittelmächten« Deutschland und Österreich-Ungarn auf der anderen Seite, wobei Serbien durch den österreichischen Angriff (der ja den Krieg ausgelöst hatte) und Belgien durch den deutschen Angriff (der Teil des strategischen Kriegsplans der Deutschen war) unmittelbar hineingezogen wurden. Die Türkei und Bulgarien schlossen sich bald schon den Mittelmächten an, während sich auf seiten der Dreierallianz allmählich eine große Koalition aufbaute. Italien wurde bestochen, sich anzuschließen. Griechenland, Rumänien und (eher nominell) Portugal wurden einfach hineingezogen. Japan kam beinahe unmittelbar nach Kriegsausbruch dazu, um deutsche Positionen im Fernen Osten und im westlichen Pazifik zu vertreten, war jedoch an keinen Aktivitäten außerhalb seines Hoheitsgebietes interessiert. Die USA – und das war nun viel wichtiger – traten 1917 in den Krieg ein. Ihre Intervention sollte sich in der Tat als entscheidend erweisen.
Die Deutschen sahen sich einem an zwei Fronten möglichen Krieg ausgesetzt (wie später auch im Zweiten Weltkrieg), vom Balkan einmal abgesehen, wo sie durch ihre Allianz mit Österreich-Ungarn hineingezogen wurden. (Da jedoch drei der vier Mittelmächte in dieser Region waren – die Türkei, Bulgarien, Österreich –, war das strategische Problem dort nicht so drängend.) Der deutsche Plan sah vor, zuerst schnellstens Frankreich im Westen zu schlagen und dann mit ebensolcher Geschwindigkeit Rußland im Osten, bevor das Zarenreich seine ungeheure Kampfkraft in vollem Ausmaß aktivieren konnte. Damals, genau wie später wieder, plante Deutschland einen Blitzkrieg, weil ihm nichts anderes übrigblieb. Beinahe sollte dieser Plan gelingen, aber nur beinahe. Die deutsche Armee rückte nach Frankreich vor, unter anderem durch das neutrale Belgien, und konnte erst fünf oder sechs Wochen nach der Kriegserklärung ein paar Dutzend Kilometer östlich vor Paris an der Marne gestoppt werden. (1940 sollte dieser Plan dann gelingen.) Dann zogen sich die Deutschen ein Stück zurück, und beide Seiten – die Franzosen wurden mittlerweile von den noch übrigen Belgiern und von einer britischen Landstreitmacht unterstützt, die sich schon bald enorm vergrößern sollte – improvisierten parallel verlaufende Verteidigungslinien aus Schützengräben und Bunkern, die sich bald ohne Unterbrechung von der Kanalküste Flanderns bis zur Schweizer Grenze zogen. Ein Großteil des östlichen Frankreich und Belgien standen damit unter deutscher Besatzung. Während der nächsten dreieinhalb Jahre änderte sich kaum etwas an diesem Frontverlauf.
Das war die »Westfront«, die zum Schauplatz von Massakern werden sollte, wie es sie wahrscheinlich nie zuvor in der Kriegsgeschichte gegeben hat. Millionen von Männern lagen sich hinter Sandsäcken verbarrikadiert in Schützengräben gegenüber, in denen sie wie Ratten und zusammen mit Ratten und Läusen hausen mußten. Von Zeit zu Zeit versuchten ihre Generäle aus diesen Gräben auszubrechen. Tage, ja sogar Wochen unaufhörlichen Artilleriefeuers – das ein deutscher Schriftsteller später »Stahlgewitter« nannte (Ernst Jünger, 1921) – sollten den Feind »zermürben« und unter die Erde treiben. Im geeigneten Augenblick kletterten dann Wellen von Soldaten aus den Schützengräben, die üblicherweise unter Stacheldraht und Netzen verborgen waren, ins Niemandsland hinaus, in ein Chaos aus verschlammten Granattrichtern, zersplitterten Baumstümpfen, Morast und liegengelassenen Leichen, um schließlich in das gegnerische Maschinengewehrfeuer zu laufen und niedergemäht zu werden. Sie wußten, daß es so geschehen würde. Der deutsche Versuch, in Verdun durchzubrechen (Februar–Juli 1916), führte zu einer Schlacht mit zwei Millionen Soldaten und einer Million Gefallenen. Der Versuch schlug fehl. Die britische Offensive an der Somme, mit der die Deutschen gezwungen werden sollten, die Verdun-Offensive abzubrechen, kostete die Briten 420 000 Tote – 60 000 allein am ersten Tag des Angriffs. Es kann daher auch kaum verwundern, daß dieser Krieg den Briten und Franzosen, die die längste Zeit an der Westfront gekämpft hatten, als der »Große Krieg« in Erinnerung geblieben ist, mit noch schrecklicheren und traumatischeren Bildern vor Augen, als sie der Zweite Weltkrieg hinterlassen sollte. Die Franzosen verloren beinahe 20 Prozent ihrer Männer im wehrfähigen Alter, und wenn wir die Kriegsgefangenen, Verwundeten und für immer Verkrüppelten und Entstellten hinzuzählen – jene gueules cassés (»zerschlagenen Fressen«), die das Bild nach dem Krieg so eindrucksvoll prägten –, dann hatte nur etwa jeder dritte französische Soldat ohne bleibende Schäden den Krieg überlebt. Die Chancen für die etwa fünf Millionen britischen Soldaten, den Krieg unverletzt zu überstehen, standen fünfzig zu fünfzig.2 Die Briten verloren eine ganze Generation – eine halbe Million Männer unter dreißig (Winter, 1986, S. 83), die vor allem aus der Oberschicht stammten und zu Gentlemen erzogen worden waren, welche als Offiziere ein Beispiel zu geben hatten. Sie marschierten ihren Männern voran in die Schlacht und wurden daher auch als erste niedergemäht. Ein Viertel der unter fünfundzwanzigjährigen Studenten aus Oxford und Cambridge, die 1914 von der britischen Armee eingezogen worden waren, wurde getötet (Winter, S. 98). Die Deutschen, mit ihren viel weiter gefaßten Gruppen im kriegsfähigen Alter, verloren proportional gesehen weniger – 13 Prozent –, obwohl die Gesamtzahl ihrer Toten höher war als die der Franzosen. Selbst die vergleichsweise geringen Verluste der USA (116 000 gemessen an 1,6 Millionen Franzosen, beinahe 800 000 Briten und 1,8 Millionen Deutschen) zeigen, wie mörderisch diese Westfront war. Im Zweiten Weltkrieg waren die Verluste der USA zwar zweieinhalb- bis dreimal so hoch, aber damals kämpften ihre Truppen auch dreieinhalb Jahre auf der ganzen Welt, wohingegen sie 1917–18 kaum eineinhalb Jahre lang in nur einem einzigen, begrenzten Gebiet eingesetzt waren.3
Die Kriegsgreuel an der Westfront sollten aber noch andere und schlimmere Folgen haben. Denn diese neue Erfahrung trug dazu bei, den Krieg und ebenso die Politik zu brutalisieren: Wenn Krieg geführt werden konnte, ohne die menschlichen und anderen Kosten aufzurechnen, weshalb dann nicht auch die Politik? Die meisten Männer, die im Ersten Weltkrieg – in der überwältigenden Mehrheit als Wehrdienstpflichtige – gedient hatten, kamen als überzeugte Kriegsgegner zurück. Jene ehemaligen Soldaten aber, die durch diesen Krieg hindurchgegangen waren, ohne sich gegen ihn aufzulehnen, zogen aus der gemeinsamen Erfahrung eines Lebens mit Tod und Tapferkeit eine Art unvermittelbarer, urtümlich-roher Überlegenheit, die sich vor allem gegen Frauen und all jene richtete, die nicht gekämpft hatten. Schon bald in der Nachkriegszeit sollten diese ehemaligen Frontsoldaten in die vordersten Reihen der Ultrarechten aufrücken. Adolf Hitler war nur einer dieser Männer, für die die Zeit als Soldat die prägende Erfahrung ihres Lebens werden sollte. Allerdings hatte auch die entgegengesetzte Reaktion negative Konsequenzen. Denn nach dem Krieg war zumindest den Politikern der demokratischen Staaten ziemlich klar geworden, daß ein Blutbad wie das von 1914–18 von den Wählern nicht mehr hingenommen werden würde. Die gesamte Strategie von Großbritannien und Frankreich nach 1918 basierte auf dieser Annahme, wie später auch die Strategie der USA nach der Vietnam-Erfahrung. Und auf kurze Sicht gesehen trug genau diese Haltung dazu bei, daß Deutschland 1940 im Zweiten Weltkrieg ein Frankreich besiegen konnte, das fest entschlossen war, sich hinter seinen (unzureichenden) Schutzwällen zu verschanzen, und, als diese erst einmal gestürmt waren, schlichtweg keinen Willen mehr hatte, den Kampf weiterzuführen. Dasselbe galt für Großbritannien, das sich verzweifelt bemühte, einer derart gewaltigen Landschlacht zu entgehen, wie sie 1914–18 so viele seiner Soldaten das Leben gekostet hatte. Aber auch langfristig gesehen konnten demokratische Regierungen nicht der Versuchung widerstehen, das Leben ihrer eigenen Bürger auf (unbegrenzte) Kosten des Lebens der Bürger des feindlichen Staates zu schützen. Die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 wurden nicht damit gerechtfertigt, daß sie für den Sieg – der ja damals schon absolut sicher war – unumgänglich gewesen seien, sondern als Maßnahme, um das Leben amerikanischer Soldaten zu retten. Vielleicht aber lag der US-Regierung auch der Gedanke nicht fern, daß sie damit den amerikanischen Verbündeten Sowjetunion daran hindern konnte, einen wesentlichen Anteil am Sieg über Japan für sich zu beanspruchen.
Während die Westfront in eine blutige Starre verfallen war, blieb die Ostfront in Bewegung. Die Deutschen pulverisierten in den ersten Kriegsmonaten bei der Schlacht von Tannenberg eine schwerfällige russische Invasionstruppe und vertrieben mit zeitweilig wirkungsvoller Hilfe der Österreicher die Russen aus Polen. Trotz gelegentlicher russischer Gegenoffensiven war klar, daß die Mittelmächte die Oberhand hatten und die Russen nur noch ein defensives Nachhutgefecht gegen die vorrückenden Deutschen kämpften. Auch den Balkan hatten die Mittelmächte unter Kontrolle, trotz des Auf und Ab der militärischen Leistungen des schwankenden Habsburgischen Reichs. Die regionalen Kriegsparteien Serbien und Rumänien hatten übrigens proportional die bei weitem stärksten militärischen Verluste zu beklagen. Die Alliierten machten, obwohl sie Griechenland besetzt hatten, keinerlei Fortschritte, bis nach dem Sommer 1918 die Mittelmächte schließlich zusammenbrachen. Der Plan Italiens, in den Alpen eine weitere Front gegen Österreich-Ungarn aufzubauen, schlug fehl; hauptsächlich, weil viele italienische Soldaten keinen Grund sahen, weshalb sie für die Regierung eines Staates kämpfen sollten, der nicht der ihre war und dessen Sprache nur wenige beherrschten. Nach einem großen militärischen Debakel, 1917 in Caporetto (das Ernest Hemingway in seinem Roman In einem andern Land verewigt hat), mußten die Italiener sogar noch durch den Transfer von alliierten Truppeneinheiten verstärkt werden. Inzwischen bluteten sich Frankreich, Großbritannien und Deutschland an der Westfront gegenseitig aus; Rußland wurde zunehmend von einem Kampf destabilisiert, den es offensichtlich verlor; und das österreichisch-ungarische Reich torkelte unaufhaltsam auf seinen Untergang zu, den sich zwar die nationalistischen Bewegungen des Reichs wünschten, in den sich die Außenministerien der Alliierten aber ohne Begeisterung fügten. Zu Recht sahen sie ein instabiles Europa vor sich.
Das entscheidende Problem beider Seiten war es nun, wie die Erstarrung an der Westfront gelöst werden könnte, denn ohne einen Sieg im Westen würde keine Seite den Krieg gewinnen können, vor allem da auch der Seekrieg in eine Sackgasse geraten war. Abgesehen von ein paar isolierten Kommandounternehmen wurden die Ozeane von den Alliierten kontrolliert. Nur die britischen und deutschen Schlachtflotten lagen sich noch immer in der Nordsee gegenüber und lähmten sich gegenseitig. Ihr einziger Versuch, sich zu bekämpfen (1916), endete unentschieden; doch da die deutsche Flotte in ihren eigenen Gewässern festsaß, geriet das Ganze mehr zum Vorteil der Alliierten.
Beide Seiten versuchten es mit Technologie. Die Deutschen, schon immer stark bei der Entwicklung von Chemie, führten Giftgas auf dem Schlachtfeld ein, wo es sich nicht nur als barbarisches Mittel, sondern auch als ineffektiv erwies. Das führte aber zu der einzigen humanitären Reaktion von Regierungen gegen ein Kriegsmittel: die Genfer Konvention von 1925, mit der die Weltgemeinschaft an sich selbst appellierte, keine chemischen Waffen einzusetzen. Und tatsächlich wurden sie, obwohl sich alle Regierungen weiterhin darauf vorbereiteten und auch davon ausgingen, daß der Feind sie benützen würde, von keiner Seite im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Nur die Italiener konnten auch von humanitären Gefühlen nicht davon abgehalten werden, Kolonialvölker zu vergasen. Der tiefe Fall der zivilisatorischen Werte nach dem Zweiten Weltkrieg brachte schließlich auch das Giftgas auf die Bühne zurück. Während des Krieges zwischen dem Iran und Irak in den achtziger Jahren setzte der Irak, der damals von den westlichen Staaten enthusiastisch unterstützt wurde, in völliger Offenheit Giftgas gegen Soldaten wie Zivilisten ein. Die Briten erfanden das gepanzerte Raupenfahrzeug, das im Englischen noch heute bei seinem damaligen Codenamen tank genannt wird, doch ihre wahrhaftig nicht sehr beeindruckenden Generäle hatten noch nicht entdeckt, wie man es wirkungsvoll benutzt. Beide Seiten setzten die neuen, noch recht zerbrechlichen Flugzeuge ein und Deutschland auch die seltsam zigarrenförmigen und mit Gas gefüllten Flugschiffe, die glücklicherweise wenig erfolgreich mit Luftbombardements experimentierten. Aber auch der Luftkrieg kam erst im Zweiten Weltkrieg voll zur Geltung, vor allem als Mittel zur Terrorisierung der Zivilbevölkerung.
Die einzige technische Waffe, die auf die Kriegsführung 1914–18 wesentlichen Einfluß hatte, war das Unterseeboot. Da keine Seite in der Lage war, die Soldaten der anderen zu schlagen, zogen sich beide darauf zurück, die Zivilbevölkerung der anderen Seite auszuhungern. Und da die gesamte britische Versorgung auf dem Seeweg stattfand, schien es tunlich, die Britischen Inseln durch einen immer erbarmungsloseren Unterwasserkrieg gegen britische Schiffe zu strangulieren. 1917, kurz bevor endlich Mittel und Wege zu Gegenmaßnahmen gefunden wurden, war diese Schlacht dem Erfolg schon sehr nahe gekommen. Doch mehr als alles andere trug sie dazu bei, die USA in den Krieg hineinzuziehen. Auch die Briten taten ihr Bestes, um den Versorgungsnachschub nach Deutschland zu blockieren und sowohl die deutsche Kriegswirtschaft als auch die deutsche Bevölkerung auszuhungern. Daß sie dabei erfolgreicher waren, als sie selbst angenommen hatten, lag daran, daß die deutsche Kriegswirtschaft in Wirklichkeit nicht mit der Effizienz und Rationalität arbeitete, mit der sich die Deutschen immer stolz gebrüstet hatten, im Gegensatz zur deutschen Militärmaschinerie, die den anderen im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg haushoch überlegen war. Die schiere militärische Überlegenheit der deutschen Streitkräfte hätte den Krieg tatsächlich entscheiden können, wäre es den Alliierten 1917 nicht gelungen, die praktisch unbegrenzten Ressourcen der USA zu mobilisieren. Tatsache war, daß Deutschland trotz seiner Fesselung an die Allianz mit Österreich einen totalen Sieg im Osten verbuchen konnte, nachdem es 1917–18 Rußland aus dem Krieg in die Revolution getrieben und aus großen Teilen seiner europäischen Territorien vertrieben hatte. Kurz nachdem Deutschland den diktierten Frieden von Brest-Litowsk verhängt hatte (März 1918), gelang den nunmehr auf den Westen konzentrierten Streitkräften der Durchbruch an der Westfront, und sie konnten erneut in Richtung Paris vorrücken. Nur dank der massiven amerikanischen Unterstützung und Ausrüstung konnten sich die Alliierten wieder erholen, aber für eine Weile hatte es knapp ausgesehen. Dies war jedoch das letzte Aufbäumen eines erschöpften Deutschland, das selbst wußte, wie nahe seine Niederlage bevorstand. Als die Alliierten im Sommer 1918 erst einmal vorzurücken begannen, war das Ende nur noch eine Frage von Wochen. Die Mittelmächte gestanden ihre Niederlage ein und brachen schließlich vollständig zusammen. Im Herbst 1918 schwappte die Revolution genauso über Mittel- und Südosteuropa, wie sie sich 1917 über Rußland ausgebreitet hatte (siehe folgendes Kapitel). Keine der alten Regierungen zwischen den Grenzen Frankreichs und dem Japanischen Meer hielt sich. Selbst die kriegführenden Parteien der siegreichen Seite wurden erschüttert, obwohl man kaum bezweifeln kann, daß Großbritannien und Frankreich auch eine Niederlage als stabile politische Gebilde überlebt hätten – nicht jedoch Italien. Von den besiegten Staaten entging keiner der Revolution.
Hätte sich einer der großen Minister oder Diplomaten der Vergangenheit – einer von jenen, die den Aspiranten des auswärtigen Dienstes noch immer als Vorbilder hingestellt werden, etwa ein Talleyrand oder ein Bismarck – aus seinem Grab erhoben, um den Ersten Weltkrieg zu beobachten, so hätte er sich gewiß darüber gewundert, weshalb verständige Staatsmänner sich nicht zusammengesetzt und den Krieg mit irgendeinem Kompromiß beendet haben, bevor er die Welt von 1914 zerstören konnte. Auch wir müssen uns diese Frage stellen. Die meisten nichtrevolutionären und nichtideologischen zwischenstaatlichen Kriege der Vergangenheit waren nicht als Kampf bis zur völligen Erschöpfung oder zum Tod geführt worden. Und auch 1914 war es gewiß nicht Ideologie gewesen, die die Kriegsparteien spaltete – abgesehen von der Tatsache, daß die Kriegsführung auf beiden Seiten auch die öffentliche Meinung mobilisierte, etwa mit der Behauptung, es ginge um die fundamentale Herausforderung der geltenden nationalen Werte: wie russische Barbarei gegen deutsche Kultur, französische und britische Demokratie gegen deutschen Absolutismus und ähnliches mehr. Außerdem gab es Staatsmänner, die sich für Friedensverhandlungen einsetzten, von Rußland und Österreich-Ungarn einmal abgesehen, die in wachsender Verzweiflung ihre jeweiligen Alliierten in eine Kompromißlösung drängen wollten, als ihre Niederlagen immer näher rückten. Weshalb also wurde der Erste Weltkrieg von den führenden Mächten beider Seiten als Nullsummenspiel geführt, als ein Krieg also, dessen Ausgang nur ein totaler Sieg oder eine totale Niederlage sein konnte?
Der Grund dafür war, daß sich dieser Krieg, im Gegensatz zu den (normalerweise begrenzten und spezifizierten) früheren Kriegen, auf unbegrenzte Ziele richtete. Im imperialen Zeitalter waren Politik und Wirtschaft miteinander verschmolzen. Internationale politische Rivalität ahmte Wirtschaftswachstum und Wettbewerb nach, deren charakteristisches Merkmal es ja schon prinzipiell war, grenzenlos zu sein. »Die ›natürlichen Grenzen‹ von Standard Oil, der Deutschen Bank oder der De Beers Diamond Corporation lagen dort, wo das Universum endet, zumindest aber erst da, wo ihre Expansionsfähigkeit endete« (Hobsbawm, 1987, S. 318). Konkreter noch: Auch für die beiden Hauptkontrahenten Deutschland und Frankreich lagen die Grenzen jenseits des Horizonts. Denn Deutschland wollte eine weltweite politische und maritime Machtposition erringen, die zu dieser Zeit noch von Großbritannien eingenommen wurde. Aber Großbritannien befand sich bereits am Abstieg und befürchtete, mit Deutschlands Vormarsch automatisch in eine untergeordnete Rolle zurückgedrängt zu werden. Es ging daher um alles oder nichts. Und für Frankreich ging es schon damals (wie auch später immer wieder) weniger um eine globale als um eine andere drängende Frage: um die Kompensation für seine zunehmende und offenbar auch unvermeidliche demographische und ökonomische Unterlegenheit gegenüber Deutschland. Auch die Zukunft Frankreichs als Großmacht stand hier auf dem Spiel. In beiden Fällen hätte ein Kompromiß im Grunde nur eine Verzögerung bedeutet. Deutschland selbst, so hätte man vermuten können, hätte nur zu warten brauchen, bis seine territoriale Größe und Überlegenheit genau die Position begründet hätten, die deutsche Regierungen für ihren Staat angemessen fanden. Das wäre früher oder später auch geschehen. Tatsache aber ist, daß die Vormachtstellung des zweimal besiegten Deutschland in den frühen 1990er Jahren, als der Staat keinerlei Ansprüche mehr darauf erhob, eine unabhängige Militärmacht in Europa zu sein, wesentlich unangefochtener sein sollte, als es das militaristische Deutschland vor 1945 je angestrebt hatte. Doch wie wir noch sehen werden, war dies nur möglich, weil Großbritannien und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg dazu genötigt wurden, ihren Rückzug (wenn auch zögerlich) in eine zweitrangige Position zu akzeptieren, und weil die Bundesrepublik trotz all ihrer ökonomischen Stärke überdies erkannt hatte, daß eine Vormachtstellung als einzelner Staat in der Welt nach 1945 jenseits ihrer Möglichkeiten lag und auch weiterhin liegen müßte. Um 1900, auf dem Gipfel des imperialen und imperialistischen Zeitalters, war der deutsche Anspruch auf einen einzigartigen, globalen Status (»Am deutschen Wesen soll die Welt genesen« – so lautete die Phrase) noch ungebrochen, ebenso wie der Widerstand Großbritanniens und Frankreichs dagegen – beide damals noch unbestreitbar »Großmächte« in einer eurozentrierten Welt. Auf dem Papier wäre zweifellos ein Kompromiß bei diesem oder jenem Punkt der fast schon megalomanischen »Kriegsziele« zu erreichen gewesen, die beide Seiten unmittelbar nach Ausbruch des Krieges formuliert hatten. Doch in der Wirklichkeit war das einzige Kriegsziel, das zählte, der totale Sieg – also die »bedingungslose Kapitulation«, wie es dann im Zweiten Weltkrieg heißen sollte.
Es war ein absurdes und selbstzerstörerisches Ziel, das sowohl Sieger wie Besiegte ruinieren sollte. Es trieb die Besiegten in die Revolution und die Sieger in den Bankrott und bis zur völligen physischen Erschöpfung. 1940 konnte Frankreich nur deshalb mit so lächerlicher Leichtigkeit und Geschwindigkeit von einer zahlenmäßig durchaus nicht überlegenen deutschen Wehrmacht überrannt werden und ohne Zögern die Unterwerfung unter Hitler akzeptieren, weil das Land 1914–18 beinahe ausgeblutet wäre. Auch Großbritannien konnte nach 1918 nie wieder zu seinem alten Zustand zurückfinden, weil das Land seine Wirtschaft ruiniert hatte, indem es einen Krieg geführt hatte, der seine Mittel weit überstieg. Hinzu kommt, daß der totale Sieg, ratifiziert durch das Strafgericht eines Friedensdiktats, auch noch die letzten Chancen verbaut hatte, etwas wiederherzustellen, das einem stabilen, liberalen, bürgerlichen Europa auch nur ähnlich gewesen wäre (wie der Ökonom John Maynard Keynes schon unmittelbar nach Kriegsende erkannt hatte). Und ohne Deutschland wieder in die europäische Wirtschaft zu integrieren, beziehungsweise ohne sein wirtschaftliches Gewicht innerhalb der europäischen Wirtschaft zu erkennen und zu akzeptieren, konnte es keine Stabilität geben. Doch dies war das letzte, woran jene denken wollten, die darum gekämpft hatten, Deutschland auszuschalten.
Der Friedensvertrag, der von den Siegermächten (USA, Großbritannien, Frankreich, Italien) oktroyiert wurde und für gewöhnlich, aber etwas ungenau, Vertrag von Versailles genannt wird4, war von fünf Überlegungen geleitet. Die drängendste davon betraf den Zusammenbruch so vieler Regime in Europa und das Auftauchen eines alternativen, bolschewistischen Revolutionsregimes in Rußland, das sich der weltweiten Subversion verschrieben hatte und zum Magneten für die revolutionären Kräfte allerorten geworden war (siehe Zweites Kapitel). Zweitens ging es darum, Deutschland, das immerhin beinahe die gesamte alliierte Koalition im Alleingang besiegt hätte, kontrollieren zu können. Aus naheliegenden Gründen war dies und blieb dies seither die Hauptsorge Frankreichs. Drittens mußte die Landkarte Europas neu aufgeteilt und gezeichnet werden, nicht nur um Deutschland zu schwächen, sondern auch, um die riesigen leeren Flächen neu zu füllen, die durch den gleichzeitigen Sieg über und den Zusammenbruch des Russischen, Habsburgischen und Osmanischen Reichs in Europa und im Nahen Osten entstanden waren. Die eifrigsten Anwärter auf die Nachfolge waren die verschiedenen nationalistischen Bewegungen in Europa, die von den Siegermächten mehr oder weniger noch dazu ermuntert wurden, weil sie antibolschewistisch eingestellt waren. In der Tat wurde es dann auch zum Grundprinzip für die Neuordnung der europäischen Landkarte, ethnisch-linguistisch begründete Nationalstaaten zu schaffen, entsprechend der Überzeugung, daß Nationen ein »Recht auf Selbstbestimmung« hätten. Der amerikanische Präsident Wilson, der als das Sprachrohr derjenigen Macht galt, ohne die der Krieg verloren wäre, vertrat diese Überzeugung mit leidenschaftlicher Vehemenz, was schon immer jenen leichter fiel (und fällt), die weit entfernt von den ethnischen und linguistischen Realitäten der Regionen lebten, die gerade in säuberliche Nationalstaaten aufgeteilt werden sollten. Der Versuch geriet zum Desaster, wie selbst das Europa der neunziger Jahre noch beweist. Die Nationalitätenkonflikte, die den Kontinent der neunziger Jahre spalteten, waren die alten Gespenster von Versailles, die wieder einmal ihr Unwesen trieben.5 Die Neuaufteilung des Nahen Ostens verlief entlang konventioneller imperialistischer Linien – also Aufteilung zwischen Großbritannien und Frankreich (mit Ausnahme von Palästina, wo die britische Regierung, die sich im Krieg eifrig um internationale Unterstützung für die Juden bemüht hatte, unvorsichtiger- und problematischerweise versprochen hatte, den Juden eine »nationale Heimstätte« zu geben – auch dies ein problembeladenes und unvergeßliches Relikt aus dem Ersten Weltkrieg).
Die vierte Überlegung galt den Innenpolitiken der Siegermächte – die faktisch nur aus Großbritannien, Frankreich und den USA bestanden – und den Reibereien unter ihnen. Wichtigstes Resultat dieses internen Ränkespiels war, daß sich der US-Kongreß weigerte, den Friedensvertrag, der zu großen Teilen vom und für den amerikanischen Präsidenten geschrieben worden war, zu ratifizieren und somit die USA zwang, wieder davon Abstand zu nehmen (was weitreichende Konsequenzen haben sollte).
Schließlich versuchten die Siegermächte verzweifelt, eine Art Friedensvertrag zu formulieren, der einen neuen Krieg wie jenen, der die Welt gerade erst verwüstet hatte und von dessen Nachwirkungen alle betroffen waren, unmöglich machen sollte. Nur zwanzig Jahre später befand sich die Welt wieder im Krieg.
Die Versuche, die Welt gegen den Bolschewismus zu sichern, überschnitten sich mit dem Versuch, die europäische Landkarte neu zu zeichnen. Denn die unmittelbarste Möglichkeit, dem Revolutionsrußland Paroli zu bieten (so es denn überhaupt überleben sollte, was 1919 absolut noch nicht klar war), hieß, es hinter einem Quarantänegürtel aus antikommunistischen Staaten zu isolieren (einem cordon sanitaire in der Sprache der damaligen Diplomatie). Da die Gebiete dieser Staaten zu großen Teilen oder auch vollständig aus ehemals russischem Territorium herausgemeißelt worden waren, wäre ihre feindselige Haltung Moskau gegenüber garantiert gewesen. Von Nord nach Süd gesehen ging es hierbei um Finnland, eine autonome Region, die von Lenin die Erlaubnis erhalten hatte, sich auszugliedern; um die drei kleinen, neuen baltischen Republiken (Estland, Lettland, Litauen), die historisch ohne Vorläufer waren; um Polen, das nach 120 Jahren wieder seine Souveränität erhielt; und um ein enorm vergrößertes Rumänien, dessen Umfang sich durch den Beitritt von ungarischen und österreichischen Gebieten aus dem ehemaligen Habsburgischen Reich und dem ehemals russischen Bessarabien verdoppelt hatte. Die meisten dieser Gebiete waren Rußland von Deutschland abgenommen und wären ihm sehr wahrscheinlich auch wieder zurückgegeben worden, wäre da nicht die bolschewistische Revolution gewesen. Der Versuch, den Quarantänegürtel bis in den Kaukasus auszudehnen, schlug fehl, vor allem, weil sich das Revolutionsrußland mit der nichtkommunistischen, aber ebenfalls revolutionären Türkei – die keinerlei Zuneigung für die britischen und französischen Imperialisten hegte – einig wurde. Folglich konnten auch die kurzfristig unabhängigen Staaten Armenien und Georgien (die nach Brest-Litowsk und den Versuchen Großbritanniens gegründet worden waren, Aserbeidschan mit seinen reichen Ölvorkommen auszugliedern) den Sieg der Bolschewiken im Bürgerkrieg von 1918–20 und den sowjetisch-türkischen Vertrag von 1921 nicht überleben. Mit einem Wort: Im Osten akzeptierten die Alliierten die Grenzen, die Deutschland dem Revolutionsrußland oktroyiert hatte, insofern diese nicht durch Kräfte jenseits ihrer Kontrolle außer Kraft gesetzt worden waren.
Große Teile vor allem des ehemals österreichisch-ungarischen Europa mußten nun noch neu verteilt werden. Österreich und Ungarn wurden zu deutschen und magyarischen Rumpfstaaten reduziert, Serbien wurde gemeinsam mit (dem ehemals österreichischen) Slowenien und (dem ehemals ungarischen) Kroatien einem neuerschaffenen Jugoslawien einverleibt. Zu ihm gehörte auch das ehemals unabhängige, kleine Stammeskönigreich Montenegro, eine kahle, von Hirten und Banditen bevölkerte Berglandschaft, deren spontane Reaktion auf den erstmaligen Verlust ihrer Unabhängigkeit war, daß sie in Massen zum Kommunismus konvertierten (von dem sie annahmen, daß er ihren heroischen Geist willkommen heißen würde). Dieser Teil Jugoslawiens war überdies mit dem orthodoxen Rußland verbunden, dessen Glauben die unbesiegten Männer von den Schwarzen Bergen so viele Jahrhunderte lang gegen die ungläubigen Türken verteidigt hatten. Auch eine neue Tschechoslowakei wurde gebildet, indem das industrielle Herz des ehemaligen Habsburgischen Reichs, Böhmen und Mähren, mit den Gebieten der slowakischen und karpato-ukrainischen Landbevölkerungen, die einst zu Ungarn gehört hatten, verbunden wurde. Rumänien wurde zu einem multinationalen Konglomerat erweitert, aber auch Polen und Italien zogen Nutzen aus dieser Neuordnung. Für die Neuordnungen in Jugoslawien und der Tschechoslowakei hatte es absolut keine historischen Vorläufer und auch keine logische Begründung gegeben. Es waren Konstruktionen einer nationalistischen Ideologie, die an die Macht gemeinsamer Ethnizität glaubte und extrem kleine Nationalstaaten für nicht wünschenswert hielt.6 Alle Südslawen (= Jugoslawen) gehörten nun zu einem Staat, wie auch alle Westslawen der tschechischen und slowakischen Länder. Wie zu erwarten, erwiesen sich diese politischen Zwangsehen als nicht sehr haltbar. Und abgesehen von den Rumpfstaaten Österreich und Ungarn, die der meisten, aber nicht all ihrer Minoritäten verlustig gegangen waren, waren die neuen Nachfolgestaaten nicht weniger multinational als ihre Vorgänger, ob sie nun aus Rußland oder dem Habsburgischen Reich ausgegliedert worden waren.
Deutschland wurde ein Friede diktiert, der mit dem Argument gerechtfertigt wurde, daß dieser Staat die Alleinverantwortung für den Krieg und all seine Folgen trage (»Kriegsschuld«-Klausel), was die andauernde Schwächung Deutschlands legitimieren sollte. Das wurde aber im wesentlichen nicht durch territoriale Abstriche erreicht, obwohl Elsaß-Lothringen an Frankreich zurückfiel, eine große Region im Osten an das wiedererschaffene Polen (der »polnische Korridor«, der Ostpreußen vom Rest Deutschlands trennte) und einige kleinere Veränderungen entlang der deutschen Grenze vorgenommen wurden. Eher wurde es dadurch erreicht, daß man Deutschland einer einsatzfähigen Marine und jeglicher Luftwaffe beraubte, die Streitkräfte auf 100 000 Mann beschränkte, ihm theoretisch unbegrenzte »Reparationszahlungen« für die Kriegskosten der Siegermächte auferlegte, Teile des westlichen Deutschland besetzte und ihm nicht zuletzt auch seine gesamten ehemaligen Kolonien in Übersee nahm. (Sie wurden dann unter den Briten und ihrem Commonwealth, unter den Franzosen und in geringerem Maß auch unter den Japanern aufgeteilt. Aufgrund der wachsenden Unpopularität des Imperialismus wurden sie jedoch nicht mehr »Kolonien«, sondern »Mandatsgebiete« genannt – was besagen sollte, daß man nur für den Fortschritt jener rückständigen Völker sorgen wolle, die den Imperien von der Menschheit ans Herz gelegt worden waren, daß man aber nicht einmal im Traum daran zu denken wagte, diese Völker zu irgendeinem Zweck auszubeuten.) Abgesehen von den Gebietsklauseln war Mitte der dreißiger Jahre vom Versailler Vertrag nichts mehr übrig.
Was nun die Mechanismen für die Vorsorge gegen einen weiteren Weltkrieg betraf, so war deutlich, daß das Konsortium der europäischen »Großmächte«, die ihn schon vor 1914 hätten verhindern sollen, vollkommen zusammengebrochen war. Die Alternative, zu der Präsident Wilson die hartnäckigen europäischen Politiker mit der Liberalität und Inbrunst eines in Princeton ausgebildeten Politikwissenschaftlers drängte, war ein allumfassender Völkerbund (unabhängiger Staaten), der in der Lage sein sollte, Probleme auf friedliche und demokratische Weise zu lösen, bevor sie aus den Rudern laufen konnten, und dies vorzugsweise durch öffentliche Verhandlungen (»öffentlich verhandelte Staatsverträge«). Denn seit dem Krieg haftete den schon im Normalfall sensiblen Prozessen internationaler Verhandlungen der Ruch von »Geheimdiplomatie« an, was größtenteils eine Reaktion auf die Geheimverträge war, die während des Krieges unter den Alliierten geschlossen worden waren und mit denen das Europa und der Nahe Osten der Nachkriegszeit mit unglaublicher Rücksichtslosigkeit auf die Wünsche oder auch nur Interessen der Bewohner dieser Regionen neu verteilt werden sollten. Die Bolschewiken hatten diese sensiblen Dokumente, die sie in den zaristischen Archiven entdeckt hatten, prompt vor der Welt veröffentlicht, und daher galt es nun, eine Lektion in Schadensbegrenzung zu veranstalten. Der Völkerbund wurde denn auch in der Tat als Teil des Friedensvertrages ins Leben gerufen, erwies sich jedoch als völliger Mißerfolg, abgesehen von seiner Rolle als Institution zur Erstellung von Statistiken. Immerhin konnte er in seiner ersten Zeit ein bis zwei kleinere Dispute beilegen, die den Weltfrieden jedoch nicht weiter gefährdet hatten (beispielsweise den Disput zwischen Finnland und Schweden um die Ålandinseln7). Die Weigerung der USA, dem Völkerbund beizutreten, hatte ihn nicht zu wahrer Bedeutung kommen lassen.
Es ist nicht unbedingt notwendig, auf die Einzelheiten der Zwischenkriegsgeschichte einzugehen, um erkennen zu können, daß der Versailler Vertrag keine Basis für einen dauerhaften Frieden sein konnte. Er war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, und daher war ein neuer Krieg praktisch gewiß. Wie wir wissen, sind die USA schnell wieder aus dem Vertrag ausgestiegen; und in einer Welt, die nicht mehr eurozentriert und eurobestimmt war, konnte kein Vertrag Beständigkeit haben, der nicht auch von den zu einer Weltmacht aufgestiegenen Vereinigten Staaten unterschrieben wurde. Wir werden noch sehen, daß dies auch für alle kommenden weltwirtschaftlichen und politischen Verträge gelten sollte. Zwei europäische Großmächte, ja sogar Weltmächte, waren für eine Weile nicht nur aus dem internationalen Spiel ausgeschlossen, sondern als unabhängige Spieler überhaupt nicht mehr präsent: Deutschland und Sowjetrußland. Doch sobald sie oder einer von ihnen die Szene wieder betreten sollten, konnte kein Friedensvertrag halten, der ausschließlich auf Großbritannien und Frankreich basierte – denn auch Italien war nicht zufriedengestellt worden. Und früher oder später mußten Deutschland und/oder Rußland unvermeidlich wieder als Hauptdarsteller in Erscheinung treten.
Die geringen Chancen, die dieser Friede überhaupt noch hatte, wurden von den Siegermächten torpediert, indem sie sich weigerten, die Verlierer wieder zu integrieren. Richtig ist, daß sich die vollständige Knebelung Deutschlands und die vollständige Ächtung Sowjetrußlands bald schon als nicht durchführbar herausstellten, aber die Anpassung an diese Realität verlief äußerst langsam und nur unter großem Zögern. Vor allem die Franzosen verabschiedeten sich nur unwillig von der Hoffnung, Deutschland schwach und hinfällig halten zu können (die Briten wurden ja auch nicht von Alpträumen aus Niederlage und Besatzungszeit verfolgt). Was nun die Sowjetunion anbelangt, so hätten es die Siegermächte sicher vorgezogen, wenn es sie überhaupt nicht gegeben hätte. Also zeigten sie sich von ihrem Überleben auch kaum begeistert, vor allem nachdem sie die Armeen der Konterrevolution im russischen Bürgerkrieg unterstützt hatten und ihnen mit eigenen Truppen zu Hilfe geeilt waren. Sogar ihre Geschäftsleute schlugen Angebote mit weitreichenden Konzessionen aus, die Lenin ausländischen Investoren bei seiner verzweifelten Suche nach irgendeiner Möglichkeit machte, eine von Krieg, Revolution und Bürgerkrieg beinahe vollständig zerstörte Wirtschaft wiederaufzubauen. Sowjetrußland wurde gezwungen, sich in der Isolation weiterzuentwickeln. Und nur die beiden geächteten Staaten Europas, Sowjetrußland und Deutschland, sollten sich, auch wenn aus politischen Gründen, schließlich Anfang der zwanziger Jahre näherkommen.
Vielleicht hätte der nächste Krieg verhindert oder wenigstens verzögert werden können, wenn die Vorkriegswirtschaft wieder als global expandierendes System des wachsenden Wohlstands hergestellt worden wäre. Doch nach nur wenigen Jahren, als die Weltwirtschaft Mitte der zwanziger Jahre die Zerreißprobe nach Krieg und Nachkrieg bestanden zu haben schien, stürzte sie in die größte Krise seit der industriellen Revolution (siehe Drittes Kapitel). Hand in Hand damit kamen in Deutschland und Japan rechtsextremistische politische und militärische Kräfte an die Macht, die durch Konfrontation und nötigenfalls auch mit militärischen Mitteln (anstatt durch Schritt für Schritt ausgehandelte Transformation) den Bruch mit dem Status quo herbeizuführen suchten. Von da ab wurde ein neuer Weltkrieg nicht nur vorhersehbar, sondern in der Tat auch regelmäßig vorhergesagt. Wer in den dreißiger Jahren heranwuchs, der lebte in der ständigen Erwartung eines solchen Krieges. Bilder von Flugzeuggeschwadern, die Bomben auf Städte werfen, und von alptraumhaften Gestalten in Gasmasken, die wie Blinde ihren Weg durch Giftgaswolken tasten, spukten in den Köpfen der Generation des Autors – prophetisch wahr die ersten, irrtümlich die letzten.