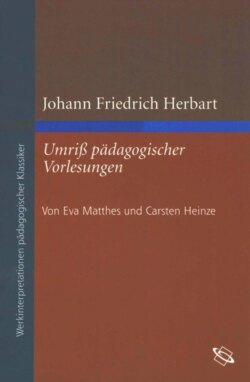Читать книгу Johann Friedrich Herbart: Umriß pädagogischer Vorlesungen - Eva Matthes - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Viertes Kapitel Bedingungen des Interesses
Оглавление§ 71. Interesse ist Selbsttätigkeit. Das Interesse soll vielseitig sein; also verlangt man eine vielseitige Selbsttätigkeit. Aber nicht alle Selbsttätigkeit ist erwünscht, sondern nur die rechte im rechten Maße, sonst brauchte man lebhafte Kinder nur sich selbst zu überlassen; man brauchte sie nicht zu erziehen und nicht einmal zu regieren. Der Unterricht soll ihre Gedanken und Bestrebungen richten, aufs Rechte lenken; indem das geschieht macht er sie zum Teil passiv, aber die Passivität soll auch nicht erdrücken, vielmehr das Bessere anregen.
Hier ist eine psychologische Unterscheidung nötig, die zwischen gehobenen und frei steigenden Vorstellungen. Gehobene Vorstellungen zeigen sich im Aufsagen des Gelernten; frei steigende in den Phantasien und Spielen. Dasjenige Lernen, welches bloß zum Aufsagen führt, macht die Kinder größtenteils passiv; denn es verdrängt, solange es dauert, die Gedanken, welche sie sonst würden gehabt haben. Im Phantasieren und Spielen aber, also auch in demjenigen Unterricht, welcher hier nachklingt, ist die freie Tätigkeit vorherrschend.
Die angegebene Unterscheidung ist nicht so zu verstehen, als ob dadurch zwei Fächer gemacht würden, in welchen die Vorstellungen, ein für allemal gesondert, notwendig stehen blieben. Aus solchen Vorstellungen, welche gehoben werden müssen, weil sie nicht von selbst kommen, können bei allmählicher Verstärkung frei steigende werden. Darauf ist aber nicht zu rechnen, wenn nicht der Unterricht es allmählich fortschreitend dahin bringt.
§ 72. Der Lehrer soll während des Unterrichts darauf achten, ob ihm die Vorstellungen der Schüler frei steigend entgegenkommen oder nicht. Im ersten Falle nennt man sie aufmerksam, und der Unterricht hat ihr Interesse für sich. Im andern Falle ist zwar die Aufmerksamkeit noch nicht immer wirklich erloschen, auch läßt sie sich eine Zeitlang noch erzwingen, bevor wirkliche Ermüdung eintritt; aber es schwebt die Frage, ob der Unterricht für die nämlichen Gegenstände künftig noch Interesse bewirken könne.
Die Aufmerksamkeit ist für die Erziehung ein so wichtiger Gegenstand, daß ihr eine ausführlichere Betrachtung muß gewidmet werden.
§ 73. Zuerst ist das Aufmerken zu unterscheiden vom Merken, welches wiederum in doppeltem Sinne gebraucht wird. Etwas merken heißt spüren, was verborgen oder kaum wahrzunehmen ist; dies geschieht durch die Stärke der von innen entgegenkommenden Vorstellungen. Sich etwas merken heißt einprägen, wie es beim Memorieren geschieht.
Die Aufmerksamkeit im allgemeinen ist die Aufgelegtheit, einen Zuwachs des vorhandenen Vorstellens zu erlangen. Diese ist entweder willkürlich oder unwillkürlich. Die willkürliche hängt vom Vorsatze ab, der Lehrer bewirkt sie oft durch Ermahnungen oder Drohungen. Weit erwünschter und erfolgreicher ist die unwillkürliche Aufmerksamkeit; sie muß durch die Kunst des Unterrichts gesucht werden; in ihr liegt das Interesse, welches wir beabsichtigen.
§ 74. Die unwillkürliche Aufmerksamkeit zerfällt wieder in die primitive und die apperzipierende. Die letztere ist es, welche beim Unterricht am allermeisten wichtig wird; aber sie stützt sich auf jene erste, deren Bedingungen auch fortwährend in Betracht kommen.
Apperzeption oder Aneignung geschieht durch früher erworbene, jetzt hinzutretende Vorstellungen; am stärksten (wiewohl nicht unbedingt am besten) durch die frei steigenden. Hiervon ist weiterhin zu reden (§ 77); vorläufig ist klar, daß dem apperzipierenden Aufmerken ein primitives muß vorausgesetzt werden, sonst wären die apperzipierenden Vorstellungen niemals entstanden.
§ 75. Das primitive oder ursprüngliche Aufmerken hängt zuerst ab von der Stärke der Wahrnehmung. Helle Farben, lautes Sprechen wird leichter bemerkt als Dunkles und leise Töne. Allein man darf hieraus nicht schließen, daß die stärksten Wahrnehmungen auch am zweckmäßigsten wären, denn sie stumpfen die Empfänglichkeit schnell ab, und im Laufe der Zeit können schwache Wahrnehmungen ein ebenso starkes Vorstellen erzeugen als diejenigen, welche sich anfangs aufdringen. Daher muß schon hier ein mittleres Maß gesucht werden. Jedoch ist bei Kindern durchgehends die wirkliche sinnliche Anschauung, wäre es auch nur einer Abbildung, wenn der Gegenstand selbst nicht zu erlangen ist, – der bloßen Beschreibung vorzuziehen.
Wenn aber Vorstellungen von entgegengesetzter Art in den Köpfen der Schüler eben jetzt vorhanden sind – wären sie auch durch den Unterricht selbst dargeboten worden –, so wirken diese als Hindernisse wider das Neue, was nun sollte gemerkt werden. Gerade dies ist die Ursache, weshalb Klarheit der Auffassung nicht gewonnen wird, wenn der Unterricht zu schnell eins aufs andere häuft, und daher ist es nötig, bei Anfängern alles so sehr zu vereinzeln, zu zerlegen und schrittweise durchzugehen, bis sie es bequem fassen können (§ 68).
Ein anderes Hindernis des Aufmerkens ist mehr vorübergehend, kann aber gleichfalls sehr schädlich werden. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob die eben vorhandenen Vorstellungen unter sich im Gleichgewichte sind oder nicht. Lange Perioden im Sprechen und in Büchern werden schwerer aufgefaßt als kurze, weil sie vieles aufregen, was zwar zusammengehört, aber eine Bewegung der Gedanken hervorbringt, die nicht sogleich zur Ruhe kommt. Wie nun die gehörige Interpunktion beim Lesen und Schreiben muß beobachtet werden, und wie diese leichter wird in kurzen als in langen Perioden, so müssen überhaupt im Unterrichte gewählte Absätze und Ruhepunkte vorkommen, bei welchen der Schüler hinreichend verweilen kann. Sonst drängen die zu sehr angehäuften Gedanken auf das Nächstfolgende, dies wieder auf das Folgende, und es entsteht ein Zustand, wobei die Schüler endlich nichts mehr hören.
§ 76. Will man nun die angegebenen vier Hauptpunkte – Stärke des sinnlichen Eindrucks, Schonung der Empfänglichkeit, Vermeidung des schädlichen Gegensatzes gegen schon vorhandene Vorstellungen, Abwarten des wiederhergestellten Gleichgewichts unter den aufgeregten Vorstellungen – alle zugleich im Unterricht beachten, so findet sich, daß es schwer hält, allen diesen Rücksichten zugleich zu genügen. Um die Empfänglichkeit zu schonen, darf man einerlei nicht zu lange darbieten; die Eintönigkeit ermüdet. Aber springt man zu etwas anderem über, so findet sich oft, daß dies dem Vorigen zu fremdartig ist, und daß die früheren Gedanken noch nicht weichen wollen. Wartet man zu lange, so wird der Vortrag schleppend; bietet der Unterricht zu wenig Mannigfaltiges dar, so wird er langweilig, die Schüler denken an etwas anderes, und hiermit ist ihr Aufmerken vollends verloren.
Es ist sehr nötig, anerkannt musterhafte Schriftsteller zu studieren, um von ihnen zu lernen, wie sie den Schwierigkeiten ausgewichen sind. Für den Ton des früheren Unterrichts muß man sich besonders an populäre Autoren wenden, z. B. an den Homer, dessen Art zu erzählen dagegen für Herangewachsene, die sich noch nicht auf eine frühere Stufe zurückzuversetzen wissen, zu breit und zu kindlich ist. Doch läßt sich im allgemeinen bemerken, daß Schriftsteller, deren Vortrag klassisch ist, nicht leicht Sprünge machen, aber auch nie ganz stillstehen. Ihre Darstellung ist ein kaum merkliches, wenigstens immer bequemes Fortschreiten, wobei der nämliche Gedankenfaden lange festgehalten, und dennoch allmählich bis zu den stärksten Kontrasten fortgeführt wird. Schlechte Schriftsteller dagegen häufen die grellsten Gegensätze unbehutsam aufeinander und erreichen nichts anderes als die natürliche Folge, daß entgegengesetzte Vorstellungen einander verdrängen und den Geist leer lassen. Dasselbe hat ein Lehrer zu fürchten, der durch bunten Vortrag glänzen will.
§ 77. Das apperzipierende oder aneignende Merken (§ 74) ist zwar nicht das erste, doch zeigt es sich schon bei kleinen Kindern, wenn sie in einem ihnen sonst unverständlichen Gespräch der Erwachsenen einzelne bekannte Worte vernehmen und laut wiederholen; wenn sie, etwas später, im Bilderbuche bekannte Gegenstände nach ihrer Weise benennen, noch später beim Lesenlernen, wenn sie aus dem Buche einzelne Namen herausreißen, womit ihre Erinnerung zusammentrifft, und so in unzähligen Beispielen. Man sieht hier plötzlich Vorstellungen aus dem Inneren hervorbrechen, um sich mit dem Gleichartigen, was sich eben darbietet, zu vereinigen. Eben dies Apperzipieren nun muß während alles Unterrichts in beständiger Tätigkeit sein. Denn der Unterricht hat nur Worte mitzuteilen; die Vorstellungen zu den Worten, worauf der Sinn der Rede beruht, müssen aus dem Innern des Hörenden kommen. Aber die Worte wollen nicht bloß verstanden sein, sie wollen interessieren. Dazu gehört ein höherer Grad und eine größere Leichtigkeit der Apperzeption.
Gedichte, welche allgemein gefallen, wirken nicht dadurch, daß sie etwas Neues lehren. Was man schon weiß, das malen sie aus1, was jeder fühlt, sprechen sie aus. Die vorhandenen Vorstellungen werden gehoben, erweitert und verdichtet, hiermit geordnet und verstärkt. Umgekehrt, wo Fehler apperzipiert werden (Druckfehler, Sprachfehler, unrichtige Zeichnungen, falsche Töne u. dergl.), da entsteht eine Störung im Ablaufen der Vorstellungsreihen, die sich nun nicht gehörig verweben können. Hieraus läßt sich erkennen, wie der Unterricht wirken und was er vermeiden muß, um zu interessieren.
Anmerkung. Das apperzipierende Merken ist für den Unterricht so wichtig, daß hier noch etwas darüber soll beigefügt werden. Den höchsten Grad dieses Merkens bezeichnen die Worte Schauen, Spüren, Horchen, Tasten. Dabei ist die Vorstellung des Gegenstandes, welcher beobachtet wird, schon im Bewußtsein gegenwärtig, auch die Vorstellung der Klasse von Wahrnehmungen, welche von ihm erwartet werden; es kommt nun auf die folgenden Wahrnehmungen an, auf ihre Gegensätze, Verbindungen und Reproduktionen; diese können ungehindert die von ihnen abhängenden Gemütszustände bewirken, indem das Fremdartige schon entfernt ist und fern gehalten wird. Man gehe von diesem höchsten Grade rückwärts zu niederen Graden des Merkens. Dann ist die Vorstellung des Gegenstandes noch nicht oder doch nicht vorzugsweise gegenwärtig, sie muß erst selbst reproduziert oder doch mehr gefördert werden. Es kommt in Frage, ob dies unmittelbar oder nur mittelbar gelingen könne. Im ersten Falle muß sie an sich stark genug, im zweiten hinreichend mit andern Vorstellungen, die sich unmittelbar erwecken lassen, verbunden sein, und die Hindernisse der Reproduktion müssen sich überwinden lassen.
Ist das apperzipierende Merken schon im Gange, so soll es benutzt und nicht gestört werden. Die Rede muß dahin fortlaufen, wo sie erwartet wird, bis die Erwartungen befriedigt sind; die Lösungen müssen den Aufgaben sichtbar entsprechen, alles muß ineinander greifen. Gestört wird das Merken durch unzeitige Pausen und fremdartige Einmischungen; gestört wird es auch durch Apperzeptionen, welche das ins Licht stellen, was im Schatten bleiben sollte. Dahin gehören Worte, die sich zu oft wiederholen, angewöhnte Redensarten; alles was die Sprache auf Kosten der Sache hervorhebt, selbst Reime, Versglieder und rhetorischer Schmuck am unrechten Orte.
Man muß aber auch das gar zu Einfache vermeiden. Die Apperzeption desselben ist gleich am Ende, es beschäftigt nicht. Die Fülle dessen, was sich zusammenfassen läßt, soll man suchen.
Eine Hauptregel ist, die Schüler unmittelbar bevor sie selbst arbeiten sollen, in den Gedankenkreis zu versetzen, welchem die Arbeit angehört; besonders beim Anfange einer Lehrstunde durch eine kurze Übersicht dessen, was gelesen oder vorgetragen werden wird.
§ 78. Der Unterricht hat Erfahrung und Umgang zu ergänzen (§ 36); diese seine Grundlagen müssen schon vorhanden sein; wo sie es nicht sind, müssen sie zuerst in gehöriger Tüchtigkeit geschafft werden, was daran fehlt, ist ein Verlust für den Unterricht, denn es fehlt an den Gedanken, welche die Lehrlinge selbst in die Rede des Lehrers hineinlegen müssen.
Wie nun Erfahrung und Umgang, so muß auch das früher Gelernte durch den späteren Unterricht ergänzt werden. Dies aber setzt eine solche Anlage des gesamten Unterrichts voraus, daß immer das Spätere schon das Frühere vorfinde, mit welchem es sich verbinden soll.
§ 79. Der gewöhnliche Unterricht, zu wenig bekümmert um die vorhandenen Vorstellungen der Schüler, indem er nur das, was zu lernen ist, im Auge hat, pflegt sich um die nötige Aufmerksamkeit erst dann zu bemühen, wenn sie schon mangelt und sein Fortgang dadurch aufgehalten wird. Er wendet sich also an das willkürliche Aufmerken (§ 73), welches nun durch Aufmunterungen oder noch öfter durch Verweise und Strafen soll erreicht werden. Hiermit tritt ein mittelbares Interesse (§ 63) an die Stelle des unmittelbaren, und der Vorsatz des Schülers, aufmerksam zu sein, schafft keine starke Auffassung, wenig Zusammenhang des Gelernten, wankt unaufhörlich und macht oft genug dem Überdrusse Platz.
Im günstigsten Falle, wenn der Unterricht gründlich ist (also der Wissenschaft entspricht), gewinnen die Elementarkenntnisse allmählich hinreichende Festigkeit im Geiste des Schülers, damit in späteren Jahren darauf gebaut werde, d. h. damit aus den Elementarkenntnissen sich eine apperzipierende Vorstellungsmasse bilde, welche den späteren Studien zu Hilfe komme. Solcher Vorstellungsmassen kann es mehrere geben, jede für sich aber bildet eine eigene Art von einseitiger Gelehrsamkeit, wobei sich noch fragt, ob hierin wenigstens ein unmittelbares Interesse liege? Denn wofern dies Interesse erst in den Jünglingsjahren erwachen soll, nachdem das Knabenalter zur Einprägung der Vorkenntnisse verwendet war, so ist die Hoffnung nicht groß. Die Aussichten auf künftigen Stand und Erwerb eröffnen sich, die Examina stehen bevor.
§ 80. Man darf jedoch nicht übersehen, daß die primitive und die apperzipierende Aufmerksamkeit (§ 75 – 78) auch bei der besten Methode nicht von jedem Individuum im hinreichenden Grade können erlangt werden; alsdann muß die willkürliche, also der Vorsatz des Schülers in Anspruch genommen werden. Hierbei darf es nicht bloß auf Lohn und Strafe ankommen, sondern hauptsächlich auf Gewohnheit und Sitte; also hängt hier der Unterricht mit Regierung und Zucht zusammen. Bei allem solchen Lernen, welches anfangs nicht ganz ohne Zwang geschieht, kommt es vorzüglich darauf an, daß der Lehrling bald seine Fortschritte selbst wahrnehme. Die einzelnen Schritte müssen sehr bestimmt und zweckmäßig angegeben, dabei leicht ausführbar sein und einander langsam folgen. Der Unterricht muß hierbei sehr pünktlich, gemessen, ernst und geduldig sein.
§ 81. Am meisten wird das willkürliche Aufmerken für Gedächtnissachen verlangt, welchen ohnehin das Interesse, selbst wenn es entgegenkommt, nicht immer ganz zusagt. Denn die frei steigenden Vorstellungen (§ 71 u. 72) haben eine eigene Bewegung, welche das Gegebene überschreitend zu Erschleichungen führen kann. Zum Beobachten gehört einige Selbstbeherrschung, ebenso zum absichtlichen Memorieren. Hierbei kommt in Frage, welche Stelle man dem Auswendiglernen anweisen solle?
Das Auswendiglernen ist sehr notwendig, es kommt bei allen Wissenschaften in Anwendung, aber es darf nirgends das erste sein, außer wo es von selbst, ohne Anstrengung vonstatten geht. Denn wenn es bei neuen Gegenständen – die der Lehrling noch nicht falsch verbunden haben kann – Anstrengung kostet, so zeigt dies, daß die einzelnen Vorstellungen von irgendeinem Widerstande zu schnell zurückgedrängt werden, um sich untereinander zu verbinden. Man muß alsdann erst darüber sprechen, damit beschäftigen, die Gegenstände geläufiger machen, zuweilen selbst einen günstigeren Zeitpunkt abwarten. Wo noch für Klarheit des einzelnen und für Assoziation zu sorgen ist (§ 67 u. f.), da müssen diese vorangehen. Sind die Vorstellungen dadurch verstärkt worden, so wird das Auswendiglernen leichter gelingen.
Die aufgegebenen Reihen dürfen nicht zu lang sein. Drei fremde Wörter sind oft schon viel. Manchen Schülern muß man das Auswendiglernen zeigen, sie fangen sonst immer von vorn an, stocken bald und suchen vergeblich weiter zu kommen. Eine Hauptregel ist, den Anfangspunkt zu verändern. (Wäre z. B. der Name Methusalem einzuprägen, so würde man nacheinander sprechen: lem, – salem, – thusalem, – Methusalem.)
Manche muß man ermahnen, daß sie nicht suchen sollen, schnell fertig zu werden. Es kommt hier auf einen psychischen Mechanismus an, welcher Zeit braucht, und welchen der Schüler selbst ebensowenig als der Lehrer darf übereilen wollen. Erst langsam, dann schneller.
Es ist nicht immer ratsam, alle körperliche Bewegung abzuhalten. Manche lernen lautsprechend, manche abschreibend, einige zeichnend. Taktmäßiges Zugleich-Sprechen läßt sich auch hier zuweilen anwenden.
Falsche Verbindungen sind sehr zu fürchten, sie kleben an. Strenge erreicht zwar viel, aber wo das Interesse für die Gegenstände ganz fehlt, da wird erst falsch, dann gar nichts gelernt, und die Zeit geht verloren.
Der Grund des Übels liegt vielleicht bei denen, welchen das Auswendiglernen durchgehends mißlingt, zum Teil an unbekannten Eigenheiten der leiblichen Organisation. Aber er liegt auch sehr oft an der falschen Spannung, worin sie sich selbst versetzen, indem sie mit Widerwillen versuchen, was sie kaum für möglich halten. Unvorsichtiges Benehmen in den ersten Kinderjahren führt dazu, wenn gleich anfangs vom Lernen als von einer Sache der Not und Plage die Rede war, und etwa ein unbehilfliches Buchstabieren den Anfang machte. So töricht es ist, für solche Kinder, welche leicht behalten und aufsagen, noch Erleichterungsmittel zu suchen, so nötig ist Behutsamkeit, weil es auch andere gibt, die man bei den ersten Versuchen, sie zum Aufsagen, ja nur zum Nachsprechen einer bestimmten Reihe von Worten zu bringen, fürs Lernen verderben kann. Bei solchen frühen Versuchen, ob sie gegebene Reihen leicht behalten und leicht reproduzieren, ist durchaus nötig, sie in gute Laune zu setzen, die Gegenstände demgemäß zu wählen, und nur so lange fortzufahren, als sie fühlen, daß sie können, was man verlangt. Die Beobachtungen, welche sich hier darbieten, müssen das weitere Verfahren bestimmen.
§ 82. Auch nach sorgfältigem Memorieren fragt sich noch, wie lange das Gelernte werde behalten werden? Hierüber pflegt man sich, ungeachtet der bekanntesten Erfahrungen, immer von neuem zu täuschen. Aber
1. in der Tat braucht nicht alles Gelernte für immer im Andenken zu bleiben; manches leistet was es soll, indem es den nächsten Übungen vorarbeitet und eine weitere Ausbildung möglich macht. So werden kleine Gedichte für eine Zeitlang memoriert, um eine Übung im Deklamieren möglich zu machen; manche Kapitel aus römischen Schriftstellern auswendig gelernt, damit das Lateinschreiben und Sprechen besser in Gang komme. In manchen Fällen genügt es für spätere Jahre, zu wissen, wie literarische Hilfsmittel zu suchen und zu gebrauchen seien.
2. Soll jedoch das Gelernte sich auf lange Zeit, womöglich auf immer einprägen, so ist es nur ein zweideutiges Notmittel, das Nämliche immer von neuem, so oft es vergessen war, zum Memorieren aufzugeben. Der Überdruß kann größer werden als der Gewinn. Es gibt nur ein tüchtiges Mittel, und das ist Übung durch beständige Anwendung, im Zusammenhange mit dem, was wirklich interessiert, also die frei steigenden Vorstellungen des Zöglings fortwährend beschäftigt.
Danach richtet sich zu jeder Zeit die Wahl dessen, was mit sicherem Erfolge memoriert werden kann. Für nahen Gebrauch das Nötige, denn Überhäufung fördert das baldige Vergessen. Aber sehr vieles im Unterricht wie in der Erfahrung tut seine Dienste, wenn es den Geist anregt und ihn zu fernerer Beschäftigung befähigt, auch ohne genau behalten zu werden.