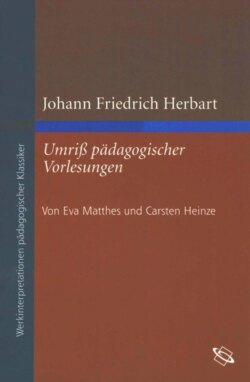Читать книгу Johann Friedrich Herbart: Umriß pädagogischer Vorlesungen - Eva Matthes - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJohann Friedrich Herbart
Einleitung
§ 1. Der Grundbegriff der Pädagogik ist die Bildsamkeit des Zöglings. Anmerkung. Der Begriff der Bildsamkeit hat einen viel weiteren Umfang. Er erstreckt sich sogar auf die Elemente der Materie. Erfahrungsmäßig läßt er sich verfolgen bis zu denjenigen Elementen, die in den Stoffwechsel der organischen Leiber eingehen. Von der Bildsamkeit des Willens zeigen sich Spuren in den Seelen der edleren Tiere. Aber Bildsamkeit des Willens zur Sittlichkeit kennen wir nur beim Menschen.
§ 2. Pädagogik als Wissenschaft hängt ab von der praktischen Philosophie und Psychologie. Jene zeigt das Ziel der Bildung, diese den Weg, die Mittel und die Hindernisse.
Anmerkung. Hierin ist auch die Abhängigkeit der Pädagogik von der Erfahrung enthalten, indem teils die praktische Philosophie schon Anwendung auf die Erfahrung in sich aufnimmt, teils die Psychologie nicht bloß von der Metaphysik, sondern von der durch Metaphysik richtig verstandenen Erfahrung ausgeht. Die bloß empirische Menschenkenntnis aber genügt der Pädagogik um desto weniger, je veränderlicher ein Zeitalter in Ansehung seiner Sitten, Gewohnheiten und Meinungen ist. Denn hierdurch verlieren allmählich die Abstraktionen aus früherer Beobachtung den Kreis, worin sie gültig waren.
§ 3. Philosophische Systeme, worin entweder Fatalismus oder transcendentale Freiheit angenommen wird, schließen sich selbst von der Pädagogik aus. Denn sie können den Begriff der Bildsamkeit, welcher ein Übergehen von der Unbestimmtheit zur Festigkeit anzeigt, nicht ohne Inkonsequenz in sich aufnehmen.
§ 4. Die Pädagogik darf jedoch auch keine unbegrenzte Bildsamkeit voraussetzen, und die Psychologie wird diesen Irrtum verhüten. Die Unbestimmtheit des Kindes ist beschränkt durch dessen Individualität. Die Bestimmbarkeit durch Erziehung wird überdies beschränkt durch Umstände der Lage und der Zeit. Die Festigkeit der Erwachsenen bildet sich innerlich fort und wird dem Erzieher unerreichbar.
§ 5. Indem nun die Erziehung anfangs an die Natur, später an den eigenen Entschluß des Zöglings anzustoßen scheint und, wenn sie ihre Grenzen nicht beachtet, wirklich anstößt, entsteht hieraus eine scheinbare Bestätigung zugleich für den Fatalismus und für die Freiheitslehre.
Anmerkung. Daher darf man sich nicht wundern, daß die von Kant ausgegangene transcendentale Freiheitslehre zugleich Fatalismus ist, nämlich in Ansehung der zeitlichen Entwickelung aller Handlungen und Gesinnungen. Bei minder scharfen Denkern aber gestalten sich die beiden entgegengesetzten Irrtümer anders, und zwar so, daß zwischen beiden die Meinung fortwährend schwankt. Denn sie kommen auf den Fatalismus, wenn sie die Menschheit historisch im großen betrachten: alsdann scheint ihnen der Erzieher selbst, samt dem Zöglinge, in einem großen Strome – nicht etwa selbsttätig schwimmend, welches richtig wäre, sondern willenlos fortgerissen. Sie kommen dagegen auf die Freiheit, wenn sie den Einzelnen betrachten, der sich äußeren Einwirkungen, und oft genug den Absichten des Erziehers, entgegenstemmt; hier können sie die Natur des Willens nicht fassen, sondern verlieren den Begriff der Natur über dem des Willens. Es ist beinahe unvermeidlich, daß jüngere Erzieher in diese durch allerlei Zeitphilosophie begünstigte Schwankung des Meinens geraten; sie haben aber schon viel gewonnen, wenn sie im Schwanken sich selbst beobachten können, ohne in das eine oder andere Extrem zu versinken.
§ 6. Das Vermögen der Erziehung darf nicht für größer, aber auch nicht für kleiner gehalten werden, als es ist. Der Erzieher soll versuchen, wieviel er zu erreichen imstande sei; aber stets darauf sich gefaßt halten, durch Beobachtungen des Erfolgs auf die Grenzen vernünftiger Versuche zurückgewiesen zu werden. Damit er nichts versäume, muß er das Ganze der praktischen Ideenlehre vor Augen haben. Damit er die Beobachtungen verstehe und richtig auslege, muß ihm die Psychologie stets gegenwärtig sein.
§ 7. In der wissenschaftlichen Betrachtung werden Begriffe getrennt, die in der Praxis stets verbunden bleiben müssen. Denn das Geschäft des Erziehers ist ein fortlaufendes, welches allen Rücksichten zugleich entsprechend immer das Künftige mit dem Vergangenen verbinden soll. Darum ist diejenige Form des Vortrags für die Pädagogik nicht genügend, welche nach der Folge der Altersstufen erzählt, was in der Erziehung eins nach dem andern zu tun sei. Nur anhangsweise zur Übersicht wird diese Form dienen; die Abhandlung der allgemeinen Pädagogik, nach den Hauptbegriffen geordnet, muß vorausgehen. Das Nächste aber ist die zweifache Begründung der Pädagogik, teils durch die praktische Philosophie, teils durch die Psychologie, wovon in der Kürze wenigstens etwas muß gesagt werden.