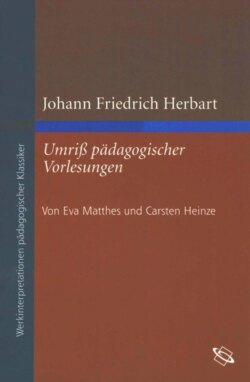Читать книгу Johann Friedrich Herbart: Umriß pädagogischer Vorlesungen - Eva Matthes - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel Von der psychologischen Begründung
Оглавление§ 20. Es ist zwar unrichtig, die menschliche Seele als ein Aggregat von allerlei Vermögen zu betrachten. Anstatt aber nach gewöhnlicher Weise durch den Zusatz: die Vermögen seien doch im Grunde nur eine Kraft, den Fehler noch zu verschlimmern, benutze man vielmehr die bekannten Namen zur Auseinandersetzung dessen, was erfahrungsmäßig nacheinander mit Übergewicht hervortritt. So wird man folgende Hauptzüge erhalten, welche zur Erinnerung an die Psychologie für den nächsten Gebrauch hinreichen.
§ 21. Nächst der Sinnlichkeit zeigt sich das Gedächtnis als ein unverändertes Wiedergeben früher gebildeter Vorstellungsreihen. Dabei ist noch kein Anfang höherer Bildung zu spüren; man muß nur bemerken, daß die Reihen nicht lang zu sein pflegen, wenn nicht infolge häufiger Wiederholung. Natürlich können die Reihen nur kurz ausfallen, solange deren Bildung, bei großer Empfänglichkeit für alles Neue, beständigen Störungen ausgesetzt bleibt.
§ 22. Schon sehr junge Kinder verraten spielend und plaudernd diejenige Selbständigkeit, welche man der Phantasie zuschreibt.
Die unbedeutendsten Spielwaren, wenn sie nur beweglich sind, veranlassen einen Wechsel und eine Verknüpfung von Vorstellungen, selbst mit Affekten begleitet, wobei der reife Mann als Zuschauer in Erstaunen gerät und wohl selbst in Sorge, es möchte sich von der Seltsamkeit so bunter Einfälle etwas festsetzen. Allein es ist nichts zu befürchten, wenn die Affekte nicht zu heftig auf den Leib wirken, und wenn sie schnell vorübergehen. Vielmehr ist lebhaftes Spielen ein erwünschtes Zeichen, besonders wenn es bei schwachen Kindern sich noch spät, dann aber kräftig, hervortut.
§ 23. Bald darauf folgt eine Zeit, wo die Beobachtung der äußeren Gegenstände das Kind zu unzähligen Fragen veranlaßt. Hier regt sich diejenige Tätigkeit, welche man Urteilskraft nennt, in Verbindung mit dem Verstande, indem das Kind strebt, das Neue unter bekannte Begriffe zu bringen und mit deren Zeichen, den bekannten Worten, zu belegen. Dabei ist das Kind noch lange nicht fähig, Gedankenreihen von abstrakter Art zu verfolgen, periodisch zu sprechen und durchgehends sich verständig zu betragen, sondern das Kindische bricht bei den geringsten Anlässen wieder hervor.
§ 24. Inzwischen äußern sich nebst den Gefühlen körperlicher Lust und Unlust auch Zuneigungen und Abneigungen gegen Personen, überdies ein scheinbar starker Wille, in Verbindung mit heftigem Geiste des Widerspruchs, falls derselbe nicht zeitig erdrückt wird.
§ 25. Das ästhetische Urteil dagegen pflegt sich anfangs sehr sparsam und flüchtig zu zeigen, und schon hierin erkennt man die Schwierigkeit, ihm dereinst sogar wider Eigenwillen und Eigennutz die Herrschaft zuzuwenden, worauf teils der höhere Kunstsinn, teils die Moralität beruht.
§ 26. Schon der Knabe, während er weniger fragt, macht desto mehr Versuche, die Dinge zu behandeln, dadurch im stillen zu lernen und sich zu üben. Allmählich wächst die Scheu vor den Erwachsenen, ihrem Tadel und ihrer Überlegenheit. Zugleich schließen sich die Knaben von gleichem Alter enger aneinander, und es ist von jetzt an schwerer, sie zu beobachten. Der Erzieher, der sie in dieser Periode erst kennenlernt, kann sich lange täuschen und erreicht selten eine völlige Offenheit.
In der Zurückhaltung nun liegt mehr oder weniger Selbstbestimmung, welche man gewohnt ist der Vernunft zuzuschreiben.
§ 27. Die Namen der Seelenvermögen machen sich von neuem um die Zeit geltend, wo ein zusammenhängender Unterricht eintritt; aber jetzt in merklich veränderter Bedeutung. Das Gedächtnis soll sich zeigen im Memorieren vorgeschriebener Reihen, ohne Auslassung und Zusatz, bald in bestimmter Ordnung, bald außer derselben; meistens in schwacher Verbindung mit älteren Vorstellungen. Phantasie wird erwartet für Gegenstände ferner Länder und Zeiten. Dem Verstande wird zugemutet, über einer geringen Unterlage von Beispielen sich allgemeine Begriffe zu bilden, zu bezeichnen und zu verknüpfen. Auf das ästhetische Urteil wird selten gewartet, sondern anstatt desselben für Befehle Gehorsam verlangt.
Eine große Nachgiebigkeit der älteren Vorstellungen, die auf gegebenen Anlaß, aber nicht weiter, sich reproduzieren und verbinden sollen, ist hierbei die Hauptbedingung. Statt aller andern Affekte wirkt im Notfall die
Furcht vor der Strafe. Aber dadurch läßt sich sehr oft nicht einmal die gewöhnliche Forderung des Memorierens erreichen, viel weniger Gehorsam ohne Aufsicht.
§ 28. Es entsteht nun der sonderbare Kontrast, daß manche Zöglinge viel Gedächtnis, viel Phantasie, viel Verstand zeigen in ihrer Sphäre, während ihnen vom Lehrer und Erzieher dessen wenig eingeräumt wird. Sie herrschen sogar als die Vernünftigsten in ihrem Kreise, sie besitzen wenigstens die Achtung ihrer Gespielen, während sie in den Lehrstunden unfähig sind. Dergleichen Erfahrungen verraten die Schwierigkeit, den Unterricht in die eigene Entwickelung gehörig eingreifen zu lassen. Zugleich aber sieht man, daß in bestimmten Vorstellungsmassen dasjenige vorgeht, was man den einzelnen Seelenvermögen zuzuschreiben pflegt.
§ 29. Wie der Mann für die Kirche, fürs häusliche Geschäft, für Gesellschaften usw. eigene Vorstellungsmassen hat, die zwar zum Teil ineinander greifen und sich gegenseitig bestimmen, aber bei weitem nicht vollständig in allen Punkten zusammenhängen, so hat schon der Knabe seine Vorstellungsmassen für die Schule, andere für den Familienkreis, andere für den Spielplatz und dergl. m. Daher vielmehr als aus absichtlicher Zurückhaltung muß man sichs erklären, wenn gesagt wird, der Knabe sei unter Fremden ein ganz anderer als zu Hause oder in der Schule.
§ 30. Es besteht aber jede Vorstellungsmasse aus Komplexionen von Vorstellungen (welche, wenn die Komplikation vollkommen ist, wie ein ungeteiltes Ganzes im Bewußtsein kommen und gehen), und aus Reihen samt deren Verwebungen (welche sich gliederweise successiv entwickeln, wenn sie daran nicht gehindert sind). Je fester die Verbindungen in diesen Komplexionen und Reihen, desto bestimmter sind die Gesetze, wonach sich die Vorstellungsmassen im Bewußtsein regen, und desto mehr Widerstand leisten sie allem, was ihrer Bewegung entgegenwirkt. Daher die Schwierigkeit, durch den Unterricht in sie einzugreifen. Sie können jedoch Zusätze annehmen, neue Verbindungen eingehen und hierdurch im Laufe der Zeit wesentlich verändert werden; ja sie verändern sich bis auf einen gewissen Punkt von selbst, wenn sie auf verschiedene Anlässe wiederholt ins Bewußtsein treten. (Man denke an das, was jemand oft und in verschiedenen Kreisen vorträgt.)
Die Vorstellungen der Dinge sind Komplexionen ihrer Merkmale. Andere, für den Unterricht wichtige Beispiele von Komplexionen geben Begriffe und Worte. Da aber aus mehreren Sprachen die Worte mit einerlei Begriff vollkommen kompliziert sein können, ohne doch untereinander ebenso innig verbunden zu sein, so bemerke man, daß, wenn der Gegenstand oder der Begriff zu verschiedenen Zeiten vorkommt, er einmal in dieser Sprache, ein andermal mit einer andern kompliziert wird. Es ist aber das wiederholte Vorstellen des Gegenstandes nicht ganz ein und dasselbe Vorstellen, wenn auch größtenteils frühere Vorstellungen sich mit späteren gleichartigen so verbinden, daß der Unterschied wenig bemerklich wird.
§ 31. Das innere Gefüge der einzelnen Vorstellungsmassen wird einigermaßen dann kenntlich, wenn die Gedanken Sprache gewinnen. Das Allgemeinste davon zeigt sich im Periodenbau. Insbesondere sind die Konjunktionen wichtig, indem sie, ohne selbst etwas Vorgestelltes auszudrücken, dem Sprechenden dazu dienen, daß er dem Hörenden einige Fingerzeige gebe, in welchem Zusammenhange, in welchen Gegensätzen, mit wieviel Entschiedenheit oder Schwankung seine Äußerungen aufzufassen seien. Denn auf Reihenform, Negation und Gewißheit läßt sich der Sinn der Konjunktionen zurückführen. Man bemerke, daß dem Verneinen das Vermissen und Verweigern, der Ungewißheit das Erwarten samt Hoffnung und Furcht verwandt sind, daß also bei den Vorstellungsmassen nicht bloß das Vorgestellte, sondern auch an Gemütszustände zu denken ist. Wie die Gemütszustände, so ist auch das Gefüge der Vorstellungsmassen lange zuvor bei Kindern vorhanden, ehe sie es in ihrer Sprache auszudrücken und dazu der Konjunktionen sich zu bedienen wissen, deren einige (das Zwar, Obgleich, Sondern, Weder-Noch, Entweder-Oder usw.) erst spät bei ihnen in Gebrauch kommen.
§ 32. Ebenso wichtig als das Innere der Vorstellungsmassen des Zöglings ist für den Erzieher der Unterschied, ob diese oder jene Vorstellungsmasse leichter oder schwerer hervortrete und im Bewußtsein stetiger verharre oder schneller verschwinde. Hierin liegen unmittelbar die Bedingungen der Wirksamkeit für Unterricht und Zucht. Das Nötigste darüber wird unten bei Gelegenheit dessen vorkommen, was von Interesse und der Charakterbildung zu sagen ist.
§ 33. Die Bildsamkeit hängt also nicht von einem Verhältnisse unter mehreren ursprünglich verschiedenen Vermögen der Seele ab, wohl aber von einem Verhältnis der schon erworbenen Vorstellungsmassen.
Anmerkung. Bei denen, die frühzeitig von verschiedenen Personen geleitet, wohl gar in verschiedenen Häusern oder Lebenslagen umhergeworfen wurden, finden sich gewöhnlich solche Vorstellungsmassen, die zueinander nicht passen und schlecht verbunden sind. Auch ist reine Hingebung von ihnen nicht leicht zu erlangen, sondern sie hegen verborgene Wünsche, empfinden Kontraste, die nicht leicht zu erraten sind, und nehmen bald Richtungen, auf welche sich die Erziehung nicht einlassen kann.
Weit bildsamer sind die, welche lange Zeit nur von einer Person (am besten der Mutter) geleitet wurden, und vor ihr sich nicht zu verstecken gewohnt sind. Es kommt dann aber darauf an, die fernere Erziehung an das Vorgefundene genau anzuknüpfen und keine Sprünge zu verlangen.
§ 34. Um nun die Bildsamkeit jedes Einzelnen genauer kennenzulernen, ist Beobachtung nötig, welche teils auf die vorhandenen Vorstellungsmassen, teils auf die leibliche Disposition zu richten ist. Dahin gehört das Temperament, insbesondere die Reizbarkeit für Affekte. Bei manchen ist Furcht, bei andern Zorn die erste natürliche Regung; Lachen und Weinen wandelt einige leicht, andere schwer an, es gibt deren, bei welchen das Gefäßsystem auf sehr geringe Anlässe sich aufgeregt zeigt.
Man beobachte ferner:
1. In den Freistunden: ob die Zöglinge noch ganz kindlich jeden sich darbietenden Gegenstand zum Spiel benutzen? oder ob sie mit wechselnder Liebhaberei die Spiele absichtlich verändern? oder ob sich bestimmte Gegenstände eines beharrlichen Strebens entdecken lassen?
2. In Bezug aufs Lernen: ob der Zögling lange oder nur kurze Reihen auffaßt? ob bei der Reproduktion viele oder wenige Mißgriffe zu begegnen pflegen? ob das Gelernte im Spiel zwanglos nachklingt?
3. Ob die Äußerungen der Zöglinge oberflächlich sind oder aus der Tiefe kommen? Dies erkennt man allmählich durch Vergleichung der Worte und Handlungen.
Bei Gelegenheit solcher Beobachtungen wird man auch noch teils den Rhythmus der geistigen Bewegungen, teils die Beschaffenheit des Gedankenvorrats beim Zöglinge wahrnehmen, und nach dem allen sowohl die Materie als die Form des Unterrichts zu bestimmen haben.
§ 35. Inwiefern durch den Unterricht bloß Kenntnisse dargeboten werden, insofern läßt sich auf keine Weise verbürgen, ob dadurch den Fehlern der Individualität und den von jenem unabhängig vorhandenen Vorstellungsmassen ein bedeutendes Gegengewicht könne gegeben werden. Sondern auf das Eingreifen in die letzteren kommt es an, was und wieviel durch den Unterricht für die Sittlichkeit möge gewonnen werden.
Die Kenntnisse müssen zum mindesten dem planmäßigen Arbeiten als Stoff zu Gebote stehen, sonst erweitern sie nicht einmal den Umfang der geistigen Tätigkeit. Höher steigt ihr Wert, wenn sie freie Beweglichkeit gewinnen, so daß die Phantasie durch sie bereichert wird. Allein ihr sittliches Wirken bleibt immer zweifelhaft, solange sie nicht entweder das ästhetische Urteil, oder das Begehren und Handeln, oder beides berichtigen helfen. Und auch hierbei sind noch nähere Bestimmungen nötig.
Im allgemeinen nimmt die Roheit ab, wenn der Unterricht den Gedankenkreis erweitert, indem die Begehrungen schon dadurch, daß sie sich in diesem Kreise ausdehnen, an einseitiger Energie verlieren. Wenn ferner der Unterricht ästhetische Gegenstände irgendeiner Art faßlich darbietet, so veredelt sich die Gemütsstimmung dergestalt, daß sie der richtigen Beurteilung des Willens, das heißt, der Erzeugung praktischer Ideen, sich wenigstens annähert.
Wenn aber das Wissen vorzugsweise zum Gegenstand des Ehrgeizes wird, so können leicht jene Vorteile durch den Nachteil überwogen werden.
§ 36. Damit der Unterricht in die vorhandenen Gedanken und Gesinnungen des Zöglings eingreife, müssen ihm alle Pforten geöffnet werden. Einseitigkeit des Unterrichts ist schon deshalb schädlich, weil man nicht mit Sicherheit voraussehen kann, was am meisten auf den Zögling wirken werde.
Die vorhandenen Vorstellungsmassen entstehen aus zwei Hauptquellen: Erfahrung und Umgang. Aus jener kommen Kenntnisse der Natur, aber lückenhaft und roh, aus dieser kommen Gesinnungen gegen Menschen, aber nicht immer nur löbliche, sondern oft höchst tadelhafte. Daß die letzteren gebessert werden, ist das Dringendste, aber auch die Naturkenntnis darf nicht vernachlässigt werden, sonst ist Irrtum, Schwärmerei, Extravaganz aller Art zu fürchten.
§ 37. Daher unterscheide man im Unterricht zwei Hauptrichtungen, die historische und die naturwissenschaftliche. Zur ersten gehört nicht bloß Geschichte, sondern auch Sprachkunde; zur anderen nicht bloß Naturlehre, sondern auch Mathematik.
§ 38. Schon um dem Egoismus entgegenzuwirken, müssen menschliche Verhältnisse den Hauptgegenstand des gesamten Unterrichts in jeder Schule, welche die Bildung des ganzen Menschen übernimmt – vom Gymnasium bis zur Dorfschule –, notwendig ausmachen. Hierauf sind die historischen und philologischen Schulstudien zu beziehen, und nur insofern ist ihnen ein Übergewicht einzuräumen.
Anmerkung. Ein anderer Gesichtspunkt für die Gymnasien, daß sie für Aufrechthaltung der Kenntnis des Altertums zu sorgen haben, ist hiermit nicht ausgeschlossen, sondern muß mit jenem vereinigt werden.
§ 39. Die mathematischen Studien – vom gemeinen Rechnen bis zur höheren Mathematik hinauf – müssen sich der Naturkenntnis und hiermit der Erfahrung anschließen, um Eingang in den Gedankenkreis des Zöglings zu gewinnen. Denn auch der gründlichste mathematische Unterricht zeigt sich unpädagogisch, sobald er eine abgesonderte Vorstellungsmasse für sich allein bildet, indem er entweder auf den persönlichen Wert des Menschen wenig Einfluß erlangt, oder noch öfter dem baldigen Vergessen anheim fällt.
§ 40. Im allgemeinen bleibt es immer unsicher, ob und wie der Unterricht wird aufgenommen und verarbeitet werden. Schon um diese Unsicherheit zu vermindern, muß für die ihm angemessene Gemütsstimmung der Zöglinge fortdauernd gesorgt werden.
Dies ist eine Aufgabe für die Zucht.
§ 41. Aber auch ohne Rücksicht auf den Unterricht hat die Zucht dahin zu sehen, daß Leidenschaften verhütet und die schädlichen Ausbrüche der Affekte vermieden werden. Zwar nach Verlauf der Erziehungsjahre bricht in dieser Hinsicht allemal die Individualität hervor; allein sie bereitet sich alsdann auch Erfahrungen, und in Verbindung mit diesen zeigt sich die Nachwirkung der Erziehung, je nachdem die letztere mehr oder weniger gelungen war, in der Art und dem Maße der Selbsterkenntnis, durch welche der Erwachsene die ihm natürlichen Fehler in Schranken zu halten sucht. Scheinbare Ausnahmen hiervon beruhen meistens auf Eindrücken, welche in sehr frühen Jugendjahren entstanden waren und lange verhehlt wurden.
In der Regel sucht sich der Mensch, sobald er freie Bewegung erlangt, in diejenige Lage des Lebens zu versetzen, die ihm frühzeitig als die wünschenswerteste erschienen war. Die Zucht muß also gemeinschaftlich mit dem Unterrichte dahin arbeiten, daß in der Richtung der Wünsche kein täuschendes Bild erscheine, sondern die Güter und Beschwerden verschiedener Stände und Stellungen der Wahrheit gemäß aufgefaßt werden.
Was die Zucht gegen die Individualität vermag, das beruhet weniger auf Beschränkungen (die nicht fortdauern können), als darauf, daß den besseren Regungen des Individuums zur frühzeitigen Entwicklung verholfen wird, wodurch sie das Übergewicht erlangen.
§ 42. Der größere Teil der Beschränkungen, welche in den Erziehungsjahren nötig sind, fällt unter einen anderen Begriff, den der Regierung. Nämlich abgesehen von der gesamten Ausbildung müssen Kinder ebenso notwendig als Erwachsene den Druck erfahren, welchen jeder einzelne von der menschlichen Gesellschaft zu erleiden hat; sie müssen in ihren Schranken gehalten werden. Dafür zu sorgen, überläßt der Staat den Familien, Vormündern und Schulen. Der Zweck der Regierung liegt in der Gegenwart, während die Zucht den künftigen Erwachsenen im Auge hat. Die Gesichtspunkte sind daher so verschieden, daß man Zucht und Regierung in der Pädagogik notwendig unterscheiden muß.
§ 43. Selbst bei den Maßregeln der Regierung kommt es darauf an, wie stark sie gefühlt werden. Die rechte Empfindlichkeit ist nur bei guter Zucht zu sichern. Ein leichter Verweis kann mehr wirken als Schläge. Regieren ist zwar das erste Nötige, wo ungezogene Kinder Unfug stiften, aber es soll sich wenn möglich mit der Zucht verbinden. Die Trennung der Begriffe dient weit mehr dem Nachdenken des Erziehers, welcher wissen soll, was er tut, als daß sie in der Praxis sichtbar werden dürfte.
§ 44. Die allgemeine Pädagogik, welcher späterhin manche besondere Betrachtungen folgen müssen, wird nun zuvörderst nach den drei Hauptbegriffen der Regierung, des Unterrichts und der Zucht abgehandelt. Was von der Regierung, als der ersten Voraussetzung des Erziehens, zu sagen nötig ist, wird zuerst beseitigt. Dann folgt die Lehre vom Unterricht, die sogenannte Didaktik. Im Vortrage der Pädagogik bekommt die Zucht den letzten Platz; denn man würde ihrer Wirkung wenig Dauer versprechen können, wenn sie vom Unterricht getrennt wäre; daher muß der Erzieher immer schon den Unterricht im Auge haben, indem er die Maßregeln der Zucht, welche in der Praxis dem Unterricht stets zur Seite geht, zum Gegenstande seines Nachdenkens macht.
Die andere übliche Form, die Pädagogik nach den Altersstufen abzuhandeln, welche für die Entwicklung der Begriffe nicht zweckmäßig ist, findet dort ihre rechte Stelle, wo man zu speziellen Betrachtungen übergehen will.