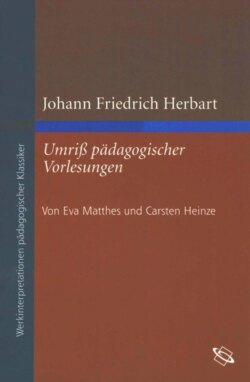Читать книгу Johann Friedrich Herbart: Umriß pädagogischer Vorlesungen - Eva Matthes - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеErster Teil
Erstes Kapitel
Von der Begründung durch die praktische Philosophie
§ 8. Tugend ist der Name für das Ganze des pädagogischen Zwecks. Sie ist die in einer Person zur beharrlichen Wirklichkeit gediehene Idee der inneren Freiheit. Hieraus ergibt sich sogleich ein zwiefaches Geschäft, denn die innere Freiheit ist ein Verhältnis zwischen zwei Gliedern: Einsicht und Wille, und es ist die Sorge des Erziehers, erst jedes dieser Glieder einzeln zur Wirklichkeit zu bringen, damit sie alsdann zu einem beharrlichen Verhältnis sich verbinden mögen. Unter dem Worte Einsicht wird zunächst die ästhetische (noch nicht moralische) Beurteilung des Willens verstanden.
§ 9. Schon hier aber darf nicht vergessen werden, daß das Streben zur beharrlichen Wirklichkeit jenes Verhältnisses nichts anderes ist, als die Moralität selbst, welches Streben in dem Zöglinge hervorzurufen weit schwieriger und jedenfalls erst später möglich ist, nachdem das eben erwähnte zwiefache Geschäft schon guten Fortgang gewonnen hat. Die bloß ästhetische Beurteilung übt sich leicht an fremden Beispielen; die moralische Zurückwendung auf den Zögling selbst geschieht dagegen nur insofern mit Hoffnung des Erfolgs, als seine Neigungen und Gewöhnungen eine Richtung genommen haben, welche jener Beurteilung gemäß ist. Sonst läuft man Gefahr, daß der Zögling die ästhetische Beurteilung des Willens, wenn er sie faßt, doch der gemeinen Klugheit wissentlich unterordnet, woraus das eigentliche Böse entsteht.
§ 10. Durchläuft man nun die übrigen praktischen Ideen, so erinnert die Idee der Vollkommenheit an Gesundheit des Körpers und Geistes, samt der Wertschätzung beider und ihrer absichtlichen Kultur.
§ 11. Die Idee des Wohlwollens ermahnt den Erzieher zuerst, alle Reizung zum Übelwollen so lange fern zu halten als sie gefährlich sein möchte. Aber auch die Achtung für das Wohlwollen muß in dem Zöglinge notwendig hinzukommen.
§ 12. Die Idee des Rechts fordert, daß der Zögling es aufgebe, zu streiten. Sie fordert überdies die Reflexion über den Streit, damit die Achtung für das Recht sich befestige.
§ 13. Die Idee der Billigkeit kommt besonders in den Fällen in Betracht, wo der Zögling eigentliche Strafe als Vergeltung des absichtlichen Wehetuns verdient hat; hier muß das Maß der Strafe scharf beobachtet und von dem Gestraften als richtig anerkannt werden.
Anmerkung. Die sogenannte pädagogische, durch natürliche Folgen witzigende Strafe darf damit nicht verwechselt werden.
§ 14. Rechtsgesellschaft und Lohnsystem im kleinen bildet sich unter mehreren Zöglingen oder Mitschülern. Damit müssen die Forderungen, welche im großen aus den nämlichen Ideen entspringen, in Einstimmung gesetzt werden.
§ 15. Das Verwaltungssystem hat einen wichtigen Bezug auf Pädagogik, indem jeder Zögling, ohne Unterschied des Standes, daran gewöhnt werden muß, sich anzuschließen, um für ein geselliges Ganzes brauchbar zu sein. Diese Forderung kann sehr viele verschiedene Gestalten, auch in bezug auf Körperbildung, annehmen.
§ 16. Vom Kultursystem ist hier noch nicht die Seite der Fachbildung, sondern der allgemeinen Bildung hervorzuheben.
Anmerkung. Die Prinzipien der praktischen Philosophie, welche im Vorstehenden kurz angedeutet worden, sind auch die Anfänge der sittlichen Einsicht für die Zöglinge selbst. Kommt der Vorsatz, hiernach den Willen zu lenken, hinzu, und gehorcht der Zögling diesem Vorsatz, so liegt in solchem Gehorsam die Moralität. Davon zu unterscheiden ist derjenige Gehorsam, welcher dem Erzieher persönlich, sei es aus Furcht oder aus Anhänglichkeit, geleistet wird, solange jener höhere Gehorsam noch nicht fest gegründet ist.
§ 17. Für das Erziehungsgeschäft tritt die Idee der Vollkommenheit zwar nicht mit einem Übergewicht, aber durch ihre ununterbrochene Anwendung vor allen übrigen heraus. Denn der Erzieher sieht in dem noch unreifen Menschen eine Kraft, welche zu stärken, umherzulenken und zusammenzuhalten seine beständige Aufmerksamkeit erfordert.
Anmerkung. Der Satz: perfice te, ist weder so allgemein, wie Wolff ihn geltend machte (als ob er der einzige Grundsatz der gesamten praktischen Philosophie wäre), noch so verwerflich, wie Kant ihn darstellte. Das Kommen zum Vollen (daher das Wort Vollkommenheit) bloß quantitativ verstanden, ist überall die nächste Aufgabe, die sich fühlbar macht, wo der Mensch sich geringer, kleiner, schwächer, enger begrenzt zeigt, als er sein könnte. Das Wachsen in jedem Sinne ist die natürliche Bestimmung des Kindes und die erste Bedingung für alles andere Löbliche, was die Zukunft von ihm erwarten läßt. Das Prinzip: perfice te, wurde indessen dadurch aus seiner wahren Bedeutung herausgedrängt, daß man die ganze Tugend dadurch zu bestimmen suchte, welches überall nicht durch irgendeine einzelne praktische Idee geschehen kann. – Von ganz anderer Art ist die gleich folgende Bemerkung, welche lediglich der pädagogischen Praxis gilt.
§ 18. Hierdurch kommt in die eigentlich moralische Bildung leicht ein falscher Zug, indem der Zögling ein Übergewicht in den Forderungen des Lernens, Übens und Leistens zu bemerken und, wofern er sie erfüllt, im wesentlichen zu genügen glaubt.
§ 19. Schon aus diesem Grunde ist es nötig, daß man die eigentlich moralische Bildung, welche im täglichen Leben fortwährend auf richtige Selbstbestimmung dringt, mit der religiösen verbinde; nämlich um die Einbildung, als wäre etwas geleistet worden, zu demütigen. Allein die religiöse Bildung bedarf auch rückwärts wiederum der moralischen, indem bei ihr die Gefahr der Scheinheiligkeit äußerst nahe liegt, wo die Moralität nicht schon in ernster Selbstbeobachtung, mit der Absicht, sich zu tadeln, um sich zu bessern, einen festen Grund gewonnen hat. Da nun die moralische Bildung nur nachfolgen kann, wo die ästhetische Beurteilung und die richtige Gewöhnung schon vorangingen (§ 9), so darf auch die religiöse Bildung ebensowenig übereilt, als ohne Not verspätet werden.