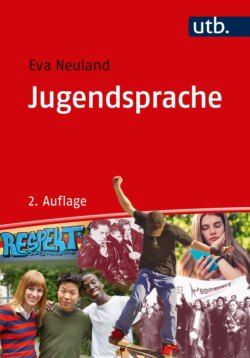Читать книгу Jugendsprache - Eva Neuland - Страница 25
3.7 Medienanalytische Forschung
ОглавлениеSchon seit Beginn der Jugendsprachforschung in Deutschland beschäftigte sich die Forschung mit dem Einfluss der MedienMedien auf den Sprachgebrauch Jugendlicher (RoggeRogge, Klaus I. 1985, HenneHenne, Helmut 1986, Schlobinski u.a. 1993). MedienanalytischeMedienanalysen Forschungsbeiträge wurden zum Gebrauch von Printmedien (z.B. Hess-LüttichHess-Lüttich, Ernest W.B. 1983, 2003 über Alternativpresse in Jugendsubkulturen), Hörfunk (z.B. BernsBerns, Jan 2003 über Radiosendungen für Hip Hop-Anhänger) und Fernsehen vorgelegt. Jugendliche werden dabei nicht als nur passive Nutzer, sondern als aktive Gestalter von neuen Medienformaten angesehen. Analysen des Sprachgebrauchs in sog. FanzinesFanzines, Fan-Magazinen für jugendliche SubkulturenSubkultur, gingen vor allem in die systematische der Beschreibung: Deutsche Jugendsprache von AndroutsopoulosAndroutsopoulos, Jannis/Scholz, Arnim (1998) ein. Dies demonstriert auch das folgende Beispiel einer Plattenkritik in einem Fanzine:
Was iss’n das???!! auweia – gitarren rock oder besser pop mit geigen und gesofte, irgendwie so schmusebaladen würd ich denken, was für schwer verliebte … also ihr verliebten dieser erde greift zu … (zur cd ihr säue!!!) und … so weiter und sofort, nee im ernst das ist nix für mich selbst zum einschlafen zu öde. Schnell weg damit, aber vielleicht hört ihr ja selber mal rein und bildet euch eure meinung – not me!
(Zit. n. AndroutsopoulosAndroutsopoulos, Jannis 1997, S. 16)
Der Medienentwicklung folgend haben in den letzten Jahrzehnten die Analysen des Umgangs Jugendlicher mit Neuen MedienNeue Medien zugenommen: Jugendliche als Internetnutzer bilden mittlerweile einen viel beachteten Forschungsschwerpunkt (u.a. AndroutsopoulosAndroutsopoulos, Jannis sowie ReinkeReinke, Marlies 2003, KleinbergerKleinberger Günther, Ulla/Spiegel, Carmen Günther/Spiegel sowie DürscheidDürscheid, Christa 2006, KotthoffKotthoff, Helga/Mertzlufft (Hrsg.) (2014) sowie Spiegel/Gysin (Hrsg.) (2016)). Die Analysen beziehen dabei medientypische Charakteristika neuer Formen von SchriftlichkeitSchriftlichkeit ein, z.B. WortbildungWortbildung in Form von Akronymen (z.B. lol, hdl), InflektivkonstruktionenInflektivkonstruktion (grins, heul, freu), Verwendung graphostilistischer Mittel (z.B. IterationIteration von Graphemen und Satzzeichen für besondere Hervorhebungen und Betonungen) sowie der Einsatz von Symbolen wie EmoticonsEmoticons.
Analysiert werden Kommunikationen in sozialen NetzwerkenNetzwerkesoziale Jugendlicher wie schülerVZ (Hellberg sowie Gysin 2014) und WhatsApp-ChatsChat (Wyss/Hug 2016), aber auch virtuelle Inszenierungen (Voigt 2014) und SelbstinszenierungenSelbstinszenierung und sprachbezogene Reflexionen zu Schreiben und Grammatik (Wagner/KleinbergerKleinberger Günther, Ulla/Spiegel, Carmen sowie Bahlo/Becker/Steckbauer 2016).
Für die medienanalytische Jugendsprachforschung stellt sich in besonderer Weise die Frage, inwieweit nicht nur allgemeine, sondern jugendtypische Charakteristika in der digitalen Kommunikation zu identifizieren sind1.