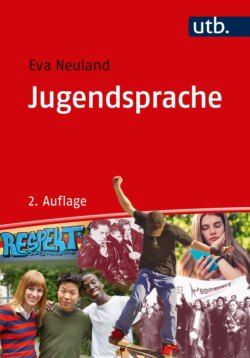Читать книгу Jugendsprache - Eva Neuland - Страница 29
4.2 Jugendsprache als Entwicklungsphänomen in der SprachbiographieSprachbiographie
ОглавлениеEine weitere wissenschaftliche Fragestellung ist auf die Jugendsprache als eine Phase der sprachlichen Sozialisation gerichtet. Dabei geht es allerdings nicht um die Vorstellung eines festen Entwicklungsablaufs innerhalb biologischer Altersgrenzen, wie sie in der psychologischen Tradition der SprachentwicklungsforschungSprachentwicklungsforschung und der AltersstilforschungAltersstilforschung noch vorherrschte1 und wie sie der in der Öffentlichkeit oft gestellten Frage zugrunde liegt, wann Jugendsprache eigentlich anfinge und wann sie aufhöre.
Jugendsprache wird in der Entwicklungsperspektive vielmehr sprachbiographisch als Teil sozialer Lebensgeschichte angesehen, wobei die Bedeutung eines besonderen Sprachgebrauchs für die SozialisationsphaseSozialisationsphase der Jugend und die mit ihr verbundene Bildung sozialer IdentitätIdentitätsoziale, insbesondere der Gruppen- und Geschlechtsrollenidentität interessiert. Die Bedeutsamkeit dieses sprachlichen Rollenhandelns spiegelt sich z.B. in den typologisierenden Bezeichnungen für Vertreter des jeweils anderen Geschlechts (wie z.B. Tussi, Macker) sowie anderer Jugendlicher (wie z.B. Aso, Proll, Spasti). Jugendliche selbst scheinen ein besonderes Gespür für den zeit- sowie lebensgeschichtlichen Wandel von Ausdrucksweisen zu haben, wenn sie sich sprachlich mit einem entsprechenden Hinweis abgrenzen: Der Ausdruck irres feeling z.B. sei peinlich teeniehaft2Neuland, Eva und nicht mehr zu gebrauchen.
Die Beschäftigung mit der Jugendsprache als einer SozialisationsphaseSozialisationsphase kann insbesondere über die funktionalen Effekte der Jugendsprache, d.h. über die Gründe für deren Bildung und Verwendung im sozialen Lebenslauf Aufschluss geben. Unter sprachbiographischer Perspektive erweist sich damit auch, dass Jugendsprache eine Passage in der individuellen SprachbiographieSprachbiographie darstellt, die mit dem Übertritt in weitere Sozialisationsphasen und -rollen (z.B.: Berufstätigkeit, Familiengründung) verblassen und abnehmen wird. Inzwischen wurden erste vergleichende Beobachtungen zu verschiedenen Lebensaltern (Häcki BuhoferHäcki Buhofer, Annelies (Hrsg.) 2003 und Sprechaltern (OBST 62/2001) vorgelegt.
Die beiden bislang angeführten Aspekte von Zeit- und Lebensgeschichte lassen sich unter dem Generationsbegriff miteinander verbinden, indem z.B. Ausdrucksformen Jugendlicher in verschiedenen historischen GenerationenGeneration miteinander verglichen werden. Dabei lassen sich auch Prozesse kulturellen WandelsWandelkultureller erfassen.3Neuland, Eva Androutsopulos demonstriert solche Veränderungen am Beispiel von WertungsausdrückenWertungsausdrücke Jugendlicher in verschiedenen Lebensphasen (Von fett zu fabelhaft 2001). Ein solcher Wandel hat auch zeitgeschichtliche Parallelen: Was in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fabelhaft war, entspricht zur Wende des 21. Jahrhunderts dem Wertungsausdruck fett.