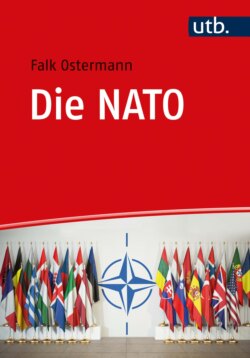Читать книгу Die NATO - Falk Ostermann - Страница 35
3.1.1 Neorealismus
ОглавлениеDer NeorealisRealismus (Neo-)mus ist eine Strukturtheorie1 internationaler Politik und zielt daher zunächst nicht auf die spezifische Erklärung konkreter außenpolitischer Entscheidungen, sondern auf das Verstehen von Gesamtdynamiken im System internationaler Politik, denen Staaten in ihrem Handeln unterworfen sind (Waltz 1996; Feng und Ruizhuang 2006, 117ff.).2 Begründet wurde die Theorieschule 1979 durch Kenneth Waltz mit seiner Theory of International Politics (Waltz 1979). Hauptvertreter sind heute der Chicagoer Professor John Mearsheimer und sein Harvard-Kollege Stephen M. Walt, der auch maßgeblich zur Theorisierung von Allianzen beigetragen hat (s. u.). In Deutschland gilt Carlo Masala, der in einem Dialog mit Waltz stand (Masala 2014), als bekanntester Verfechter des neorealistischen Erklärungsansatzes.
NeorealisRealismus (Neo-)t*innen sind MaterialisMaterialismust*innen und RationaliRationalismusst*innen. D.h., dass sie ausschließlich beobachtbare materielleMaterialismus KapazitätenKapazitäten (militärische) – das relative Verhältnis ökonomischer und militärischer FähigkeitenKapazitäten (militärische) von Staaten – als Erklärungsvariablen für internationale Politik anerkennen. Zum einen wollte Waltz mit seiner Theorie maßgeblich zu einer Verwissenschaftlichung der realistischen Schule beitragen, während es im Klassischen RealismusRealismus, Klassischer rein induktive Annahmen, z. B. zum schlechten Charakter der menschlichen Natur, gibt (Feng und Ruizhuang 2006, 6; Morgenthau 1948, Kap. 1). Daher wollte Waltz Aussagen lediglich auf Basis theoretisch fundierter Annahmen und beobachtbarer Tatsachen treffen (Waltz 1979, Kap. 1, 2; Masala 2017, 151f.). Zum anderen liegt dem NeorealisRealismus (Neo-)mus die Annahme zugrunde, dass sich Staaten als zentrale (und nach orthodoxer Meinung einzige) Akteure internationaler Politik in ihrem Handeln und ihrer Existenz in einer unabänderlichen Unsicherheitssituation begegnen. Diese Unsicherheitsbedingung internationaler Politik erwächst aus dem Fehlen einer dem Nationalstaat übergeordneten Autorität, die das Einhalten von Regelungen und Vereinbarungen verbindlich durchsetzen könnte. Daher ist das Beziehungsgeflecht dieser Staatseinheiten grundsätzlich anarchischAnarchie, anarchisch (Waltz 1979, 66ff.). Staaten sind in ihrem Handeln somit zuerst System getrieben, ohne in ihrem Handeln vom System determiniert zu sein. Das heißt, dass sie primär auf Anreize des Systems (AnarchieAnarchie, anarchisch und MachtMachtverteilung) reagieren und nicht etwa auf innenpolitische Gemengelagen oder außenpolitische Präfenzen von Parteien. Akteure können sich nach realistischer Überzeugung nie den Intentionen eines Gegners (oder zeitweiligen Partners) sicher sein. Selbst in kooperativen Interaktionen besteht die Gefahr des Hintergehens, was in existenziellen Situationen wie der Frage von FriedenFrieden oder Krieg verheerend sein könnte. Gegen diese Gefahren können sich Staaten nach realistischer Auffassung nur schützen, indem sie sich in einer auf ihren Gegner bezogenen ökonomischen und militärischen MachtMachtüberlegenheit befinden, um sich im Falle des Betrugs oder Angriffs selbst helfen (self-help mentality) zu können (Mearsheimer 1994, 9ff.; 2001, 17ff.; Masala 2017, 151). Das Handeln des Gegners muss rational erfasst werden, um das eigene Überleben zu sichern (ibid.). Durch den anarchischAnarchie, anarchischen Charakter des Systems sind Staaten somit dazu angehalten, stets machtbasiert und auf Unsicherheit reagierend zu handeln, um ihr Überleben zu sichern und ihre Interessen realisieren zu können.
Der Interessenbegriff ist im NeorealisRealismus (Neo-)mus uneinheitlich besetzt. Durch den Fokus auf AnarchieAnarchie, anarchisch und Unsicherheit besteht eine Tendenz, Staatsinteressen zu versicherheitlichen. Das heißt, dass das erste Interesse des Staates zunächst das Sichern seines Überlebens sein muss und erst danach sekundäre Ziele wie wirtschaftliche Interessen stehen sollten. Umgekehrt werden wirtschaftliche Interessen, z. B. im Rohstoffbereich, schnell unter dem Aspekt der Sicherheit gesehen, weil wirtschaftliche eine Vorbedingung für militärische Stärke darstellt. Somit sind Interaktionen zwischen Staaten stets auf relative Vorteile bezogen (Mearsheimer 1994, 20; Masala 2017, 143).3 Der NeorealisRealismus (Neo-)mus ist sich aber nicht vollends einig, welche generellen Handlungsimperative hieraus für Staaten erwachsen. Es wird daher zwischen defensivem Realismusdefensiver RealismusRealismus (Neo-) und offensivoffensiver RealismusRealismus (Neo-)em Realismus unterschieden. Joseph M. Grieco (1990) und Stephen Walt gelten als Verfechter des defensive structural realism, und Kenneth Waltz’ struktureller Realismusstruktureller RealismusRealismus (Neo-) wird ebenfalls defensiv charakterisiert (Masala 2017, 159). Defensive Realist*innen unterstreichen die Gefahren von (zu) offener Konfrontation und MachtMachtprojektion, die zu mehr Unsicherheit führen können, da Konfrontationen stets mit einem Unvorhersagbarkeitsmoment einhergehen. Daher ziehen sie ein Status quo-orientiertes Handeln von Staaten vor, bei dem Akteure Gefahren neutralisieren (balance of threatbalance of threat) und relative MachtMacht erhalten, ohne sie notwendigerweise zu maximieren (Walt 1987, 5; Elman 2008, 20ff.). MachtMacht ist dabei nur Mittel zum Zweck. Dem halten Vertreter des offensive structural realism wie Mearsheimer oder Randall Schweller (1994) entgegen, dass es im internationalen System revisionistische Staaten gibt, die mehr MachtMacht wollen, um sich selbst in eine bessere Position zu bringen. Gegen solche Akteure, die die ursprüngliche, oben beschriebene Unsicherheit erst erzeugen, helfe nur MachtMachtexpansionismus (Schweller 1994; Masala 2017, 159). Für sie balancieren Staaten nicht Gefahren, sondern MachtMacht (balance of powerbalance of power), weil hohe relative MachtMacht das Aufkommen von Gefahren im Keim erstickt. Im offensivRealismus (Neo-)en Realismus ist also die Maximierung von MachtMacht gleichbedeutend mit der Sicherung des Überlebens – MachtMacht ist ein Ziel an sich (ibid., 22ff.; s. auch Mearsheimer 2001, 21; Feng und Ruizhuang 2006, 123f.). Diese Überlegungen verdeutlichen, dass NeorealisRealismus (Neo-)t*innen – vor allem die offensiven – in ihrer Theorie besonders das Verhalten von GroßmächteGroßmacht(konfrontation)n (ChinaChina, Russland, USA) thematisieren, während die Entscheidungen von weniger mächtigen Staaten stets von der Polarität des Systems (unipolarunipolarPolarität, bipolarPolarität oder multipolar) und somit von der Anzahl der GroßmächteGroßmacht(konfrontation) bestimmt werden.4 In offensiv-realistischer Lesart ist es deshalb die beste Versicherung des Überlebens, ein regionaler HegemonHegemonie (USA) zu werden, der anderen Staaten in seinem Umfeld ihre Politiken diktieren oder zumindest sicherstellen kann, dass diese aufgrund des MachtMachtgefälles nicht gegen ihn gerichtet sind. Den mit weniger MachtMacht ausgestatteten Staaten bleibt manchmal nur die schlechtere Handlungsstrategie des bandwagoningbandwagoning, sich einem größeren Staat zur Herstellung der eigenen Sicherheit anzuschließen, was sie aber mit Freiheitseinbußen bezahlen. Daher ist bandwagoningbandwagoning niemals die bevorzugte Strategie, sondern stets die Fähigkeit zum balancingbalancing (Walt 1987, 17) – entweder von Gefahren (defensiv) oder von MachtMachtansprüchen (offensiv).