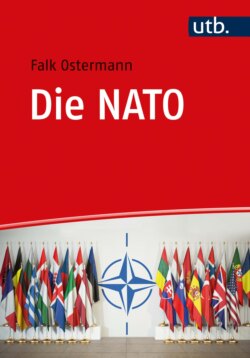Читать книгу Die NATO - Falk Ostermann - Страница 38
3.3 Die deutsche Frage: Wiederbewaffnung, NATO-Beitritt und die Folgen
ОглавлениеSeitWiederbewaffnung 1950 wurde in alliierten Kreisen die Einbeziehung der BRD in die Verteidigungsbemühungen diskutiert, sollte doch ein Teil der Verteidigung des westlichen Bündnisses auf ihrem Gebiet stattfinden, ohne dass Westdeutschland in seinem nach dem Zweiten WeltkriegZweiter Weltkrieg unbewaffneten Zustand eigene Kräfte dazu beitrug. Diese Überlegungen standen auch unter dem Eindruck eines zunehmenden gesellschaftlichen Unsicherheitsbewusstseins in der BRD mit Blick auf die Aufrüstung im Osten (Ismay 1955, 32ff.). Wenngleich IdeeIdeen (Konzept)n zur WiederbewaffnungWiederbewaffnung Westdeutschlands aufgrund der mehrmaligen Kriegserfahrungen des vergangenen Jahrhunderts auf starken Widerstand aus Frankreich stießen (Grosser 1986, 99, 108ff.; Kaplan 1984, 24f., 154ff., 160ff.; Raflik 2011, 212ff.), war die IdeeIdeen (Konzept) militärisch mit Blick auf die VorneverteidigungVorneverteidigungsdoktrin einleuchtend.
Ein Ausweg aus dem deutsch-französischen Problem wurde schließlich durch den im Oktober 1950 aufgestellten Plan des französischen Außenministers René PlevenPleven-PlanEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) gefunden, der die Gründung der Europäischen VerteidigungsgemeinschaftEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) (EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)) vorsah. In der EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) sollte eine WiederbewaffnungWiederbewaffnung Deutschlands mit 100.000 Soldat*innen (es sollte zunächst ausschließlich ein Heer geben) bei gleichzeitig kompletter Einbettung dieser Kräfte in eine multinationale KommandostrukturMilitärstruktur erfolgen (Kaplan 1984, 162f.). Die Staaten Westeuropas – Belgien, Frankreich, Italien, LuxemburgLuxemburg und die Niederlande – würden eigene Armeen behalten. Aufgrund seiner MachtMachtposition auf dem europäischen Festland wäre Frankreich eine Führungsposition zugekommen, was nach Ansicht der USA in den EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)-Plänen zu offensichtlich verankert war. Großbritannien wiederum fürchtete durch die EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) den Verlust der WestbindungWestbindung und somit der Anbindung der beiden amerikanischen Alliierten an die europäische Verteidigung (Duke 2005, 18f.). Diese und andere Punkte wurden lange kontrovers diskutiert, weil Deutschland als Gegenleistung für seine Integration in eine europäische Armee das BesatzungsstatutBesatzungsstatut (Deutschland) weitgehend aufgehoben sehen wollte, um seine eigene Souveränität wiederzuerlangen (Grau und Würz 2016; Schöllgen 2013b, 50ff.).
Während die Verhandlungen zur EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) über die kommenden Jahre weiter fortgesetzt wurden, bereiteten Frankreich zwei Entwicklungen Bauchschmerzen: Zum einen wurde deutlich, dass eine so tiefgreifende Verteidigungsintegration langfristig nicht unabhängig vom Integrationsprozess West- und Südeuropas in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) implementiert werden könnte, den Belgien, Frankreich, Italien, LuxemburgLuxemburg, die Niederlande und Westdeutschland 1952 ins Leben gerufen hatten. Damit wäre langfristig ein Verlust nationaler Souveränität in der Verteidigungspolitik einhergegangen, den das unabhängigkeitssensitive Frankreich im Verteidigungsbereich noch nicht bereit war zu gehen, sondern nur im ökonomischen (Cerny 1980; Raflik 2011; Vaïsse 2009b, 93f.). Zum anderen achtete Deutschland darauf, dass in den Verhandlungen zur EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) die WestbindungWestbindung an die USA nicht verloren ging. Bei der Ratifizierung durch den Bundestag und Bundesrat wurde dem EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)-Vertrag daher eine Präambel vorangestellt, die ebendies ausdrückte. Frankreich wollte einen derart direkten Bezug auf die USA wiederum nicht akzeptieren. Der neuen französischen Regierung aus rechten Gaullist*innen gingen somit viele Bestimmungen der EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) zu weit und die deutsche WiederbewaffnungWiederbewaffnung war eine bittere Pille, die man in Anbetracht der Vergangenheit von drei Kriegen nur schmerzlich schlucken wollte (Kaplan 1984, 25). Diese Schwierigkeiten, schlechtes Management und Verhandlungsgeschick sowie Ereignisse in Indochina, die die französische Aufmerksamkeit banden, führten schließlich zur Ablehnung des EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)-Vertrags durch die Assemblée nationale im August 1954 (Duke 2005, 26ff.; Raflik 2011, 213f.). Frankreich war in seinem MachtMachtanspruch als Mitglied des UN-Sicherheitsrats und ehemalige Weltmacht nicht bereit, sich in dieser Weise an die USA und Europa zu binden und seine Souveränität einschränken zu lassen – erwartete aber eben dies vom besiegten Westdeutschland.
Damit war die Europäisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die Lösung des deutschen Problems durch die EVGEuropäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) zunächst gescheitert. Dem britischen Außenminister Anthony EdenEden, Anthony wird daraufhin allgemein die IdeeIdeen (Konzept) zugeschrieben, Deutschland (und Italien) dem Brüsseler VertragBrüsseler Vertrag (der Westunion) beitreten zu lassen.1 Durch die 50-jährige Vertragslaufzeit der Westunion (nur 20 Jahre im NordatlantikvertragNordatlantikvertrag) war eine ausreichend lange Gültigkeit gewährleistet, um Frankreich zu beruhigen, was zudem durch schriftliche Bekenntnisse Großbritanniens und der USA zur langfristigen Truppenpräsenz untermauert wurde. Die NeunmächtekonferenzNeunmächtekonferenz2 am 28. September 1954, auf der die Londoner AkteLondoner AkteNeunmächtekonferenz verabschiedet wurde, und die Pariser VerträgePariser Verträge vom 23. Oktober 1954 regelten zusammen den Beitritt Deutschlands zur Westunion, die zur Westeuropäischen Union (WEUWesteuropäische Union (WEU)) umbenannt wurde, und die direkte Anbindung der WEUWesteuropäische Union (WEU) an die NATO (Duke 2005, 39; Georgantzis 1998, 35; Schöllgen 2013b, 50ff.). Da der SACEURSACEUR gleichzeitig den Oberbefehl über alle Truppen der WEUWesteuropäische Union (WEU) und der Alliierten in Europa erhielt, die nicht explizit ausgeschlossen waren (und Deutschland keine Truppen außerhalb Europas unterhielt), war die Einbindung der BRD in die NATO und die WEUWesteuropäische Union (WEU) somit vollumfänglich (Georgantzis 1998, 35; Grosser 1986, 137ff.) Westdeutschland brachte diese Lösung einen weiteren Zuwachs seiner Souveränität (bpb 2014; Bockenförde 2013, 36f.).3
Der Beitritt der BRD zur NATO erfolgte formal am 6. Mai 1955 nach der Ratifizierung der Pariser VerträgePariser Verträge durch Bundespräsident Theodor HeussHeuss, Theodor (nach Abstimmungen im Parlament). Der Beitritt institutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)ierte zusammen mit der Gründung des Warschauer PaktWarschauer Paktes als formales Verteidigungsbündnis der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten in Mittel- und Osteuropa den Kalten Krieg bis zu seinem Ende zu Beginn der 1990er Jahre und ließ das Streben nach der deutschen Einheit in den Hintergrund treten (Bockenförde 2013, 26). In der Folge musste Deutschland wieder Streitkräfte aufbauen. Zu diesem Zweck wurde aus der sich mit den Alliierten in Militärfragen koordinierenden Dienststelle BlankDiensstelle BlankBundeswehr, benannt nach ihrem Leiter Theodor BlankBlank, Theodor, das neue Bundesministerium für Verteidigung gegründet und BlankBlank, Theodor erster Verteidigungsminister der BRD. Die BundeswehrBundeswehr wurde formal am 12. November 1955 mit der Aushändigung der Ernennungsurkunden für 101 Soldaten gegründet. Daraufhin begann die WiederbewaffnungWiederbewaffnung Westdeutschlands, die durch die WEUWesteuropäische Union (WEU) kontrolliert wurde (bpb 2014; Georgantzis 1998, 36ff.). 1.000 freiwillige Rekruten traten ihren Dienst im Januar 1956 in Heer, Luftwaffe und Marine an. Die nächsten Jahre waren vom Aufbau von Strukturen, der Ausbildung der Soldaten und Beschaffung von Material geprägt, das vor allem von den USA geliefert wurde. Anfang 1957 waren die ersten drei deutschen Divisionen einsatzbereit und wurden der NATO zugewiesen. Der Einzug von 100.000 Wehrpflichtigen begann ebenfalls im Januar 1957 und stellte die BundeswehrBundeswehr als gemischte Berufs- und Wehrpflichtarmee auf – ein System, das bis ins Jahr 2011 beibehalten wurde (Schlaffer 2015, 176ff.). Im Laufe des Kalten KriegsKalter Krieg erreichte die BundeswehrBundeswehr eine Größe von ca. 486.000 Soldat*innen (Varwick 2007; Wehrbeauftragter 2020, 96f.).
| Entwicklung der Truppenstärke der BundeswehrBundeswehr (1957-2020) | |||||||
| 1957 | 122.400 | 1985 | 495.361 | 2000 | 318.713 | ||
| 1960 | 258.000 | 1989 | 486.825 | 2005 | 251.722 | ||
| 1965 | 437.236 | 1990 | 458.752 | 2010 | 245.823 | ||
| 1970 | 468.484 | 1991 | 476.288 | 2015 | 179.633 | ||
| 1975 | 486.206 | 1992 | 445.019 | 2020 | 184.289 | ||
| 1980 | 490.243 | 1995 | 344.960 |
Tabelle 10:
Truppenstärke der BundeswehrBundeswehr, ohne Aufwuchskräfte (Quelle: BundeswehrBundeswehr (2020), Schlaffer (2015, 180), Wehrbeauftragter (2020, 96f.), eigene Darstellung)
Abbildung 8:
Truppenstärke der BundeswehrBundeswehr 1959-2019 (Quelle: Wehrbeauftragter (2020, 96f.), eigene Darstellung)
Die neue Verteidigungspolitik der BRD sah im Rahmen der Bündnisvereinbarungen einen Verzicht auf eigene NuklearwaffenAtomwaffen und eine Fokussierung auf ein großes konventionelles Militär vor (Küntzel 1992, 19ff., 58ff.). So sollte Westdeutschland einen substantiellen Beitrag zur VorneverteidigungVorneverteidigung leisten und die Alliierten in die Lage versetzen, das Bündnisgebiet bis an die Grenzen des Warschauer PaktWarschauer Paktes an der innerdeutschen Grenze zu verteidigen, bis Verstärkung aus Westen/ Übersee eintreffen konnte. Gleichzeitig ließen sich solche FähigkeitenKapazitäten (militärische) in Anbetracht des entwaffneten Status der BRD bis 1955 natürlich nicht über Nacht herstellen. Es dauerte bis zur Mitte der 1960er Jahre, bis die Einsatzbereitschaft der BundeswehrBundeswehr hergestellt war und die VorneverteidigungVorneverteidigungslinie (s. Abb. 7) ab 1960 deutlich nach Osten verschoben werden konnte (NATO 2013). Als erste Rückfalllinie der VorneverteidigungVorneverteidigung sollten die vorteilhaften Flusssysteme in Nord- (Aller, Leine, Weser), Mittel- (Fulda, Main) und Süddeutschland (Donau) fungieren. Erst wenn diese Linie wegen sowjetischer Übermacht nicht mehr haltbar war, sollte auf die Rheinlinie zurückgefallen werden. Kugler unterstreicht auch die politische Bedeutung dieser Strategie, die letztlich die Bürger*innen der BRD davon überzeugen musste, dass ihr ganzes Territorium verteidigt werden sollte, auch wenn die wirklichen, militärisch haltbaren Sicherheitslinien letztlich weiter im Westen lagen. Es war daher auch die Strategie der westdeutschen Regierung, die Alliierten mit ihren Truppen zur Verteidigung Deutschlands Seite an Seite einzuplanen und so einen Angriff durch die Sowjetunion wirklich zu einem Angriff auf alle Bündnispartner werden zu lassen. Die NATO setzte diese IdeeIdeen (Konzept)n in ihrer VerteidigungsplanungVerteidigungsplanung um, obwohl nicht alle militärischen Argumente dafürsprachen. Ultimativ war dies also eine konventionelle AbschreckungAbschreckung (nuklear)sstrategie (Kugler 1991, 112ff.), die die NATO heute z. B. auch im Baltikum gegen Russland einsetzt (NATO 2018c). Das so aufgestellte VorneverteidigungVorneverteidigungskonzept der NATO blieb bis zum Ende des Kalten KriegsEnde des Kalten Kriegs in seinen groben Zügen erhalten. Der Beitritt der Bundesrepublik zur NATO war 1955 somit der folgerichtige Schritt der ContainmentContainment-Politik und des Marshall-PlanMarshall-Plans, der die BRD fest im freiheitlich-westlichen Politik- und Bündnissystem verankern sollte, um ideologiIdeologiesch wie politisch stark gegenüber der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten dazustehen. Die relativ kompromisslose Haltung der USA bezüglich einer Lösung der Berlin-KriseBerlin-Krise ab 1958 zeugt von der wichtigen Rolle, die Deutschland im Kampf gegen den KommunismusKommunismus und die Sowjetunion beigemessen wurde (Münger 2003, Kap. 2). Diese Absicherungspolitik, die darauf abzielte, das militärische Kapazitäts- und MachtMachtgefälle mit der Sowjetunion auszugleichen, lässt sich mit neorealistischer Theorie gut erklären. Die Staaten der Atlantischen Allianz reagierten in ihrer Außenpolitik auf die Bedrohung durch die UdSSR und bauten einen entsprechenden Sicherheits- und Verteidigungsapparat auf. Die gewählte Form der intensiven Zusammenarbeit in einem formalen und institutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)ierten Militärbündnis wurde zusätzlich durch ideologiIdeologiesche und zunehmend auch institutionelle Gründe unterstützt (s. Kap. 2, 6).
Exkurs: Die Berlin-Krise(n)
BerlinBerlin-Krise geriet aufgrund seiner Teilung zwischen den vier Besatzungsmächten (Frankreich, Großbritannien, UdSSR, USA) und seiner exponierten Lage inmitten der sowjetischen Zone (später die DDR) mehrfach zwischen die Fronten und wurde zum Zankapfel zwischen den Mächten.
Die erste Krise war die sogenannte Berlin-BlockadeBerlin-Krise vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949. Noch vor der Gründung der BRD und DDR riegelte die Sowjetunion das zwischen den vier Besatzungsmächten geteilte Berlin ab. Grundlage war ein Streit zwischen der UdSSR und den Westmächten über Reparationszahlungen Deutschlands an die Sowjetunion, die Gründung eines westdeutschen Staates aus den drei Westzonen, die dazu eingeführte Währungsunion und den WiederaufbauWiederaufbau Deutschlands. Aufgrund einer Blockadehaltung der UdSSR entschlossen sich die drei Westmächte zur Aufnahme der Westzonen in den Marshall-PlanMarshall-Plan und die o. g. Schritte, um Deutschland wirtschaftlich wieder auf eigene Beine zu stellen. Durch die dadurch entstehende Teilung Deutschlands sah die UdSSR keinen Grund mehr, mit Westberlin eine westliche Insel in seinem Territorium zu dulden und riegelte die drei Westzonen Berlins und ihre Versorgung ab. Da den Westalliierten schriftlich nur ein Luftzugang zugesichert worden war und Präsident TrumanTruman, Harry S. darüber keinen Krieg vom Zaun brechen wollte, entwickelten die Alliierten den Plan einer Luftbrücke, über die Berlin versorgt wurde. Dazu landete im Schnitt alle 90 Sekunden ein Versorgungsflugzeug in Berlin-Tempelhof. 5.000 Tonnen (teilw. 13.000 t) Lebensmittel und Treibstoff (zur Stromerzeugung) wurden so für die zwei Mio. Westberliner*innen jeden Tag transportiert. StalinStalin, Josef gab die Blockade nach 318 Tagen auf, weil sie den Westen stärker einte, als dass sie ihn spaltete, und so die eigenen Ziele konterkariert wurden (Allinson 2019; Combs 2012, 214f.; Schöllgen 2013b, 26ff.).
Die zweite Berlinkrise begann 1958, als ChruschtschowChruschtschow, Nikita erneut die Entmilitarisierung Berlins forderte, um sich der westlichen Truppen inmitten der DDR zu entledigen und die Westalliierten zu einem FriedenFriedensvertrag zu zwingen, der die DDR anerkennen, die Besatzung beenden und so die westalliierten Truppen nach Hause schicken würde. Die BRD hielt von diesem Angebot nichts, weil sie sich damit der alliierten Sicherheitsgarantien der NATO hätte entledigen müssen. Gespräche zwischen den vier Mächten führten zu keinem Ergebnis. Der neue US-Präsident John F. KennedyKennedy, John F. machte nach seinem Amtsantritt im Januar 1961 klar, dass es eine US-amerikanische militärische Präsenz in Berlin geben würde, dass Berlin einen Zugang zur BRD haben müsse und dass die Stadt selbstbestimmt leben können müsse, dass also Berliner*innen nicht erneut als Geiseln gebraucht werden dürften wie zuletzt 1948/49 (KennedyKennedy, John F.s three essentials). 1963 bekräftigte er dieses Bekenntnis mit seinem berühmten Satz „Ich bin ein Berliner!“. In der Zwischenzeit erfolgte allerdings mit dem Mauerbau vom 13. August 1961 die Abriegelung Westberlins, die auch von Seiten der UdSSR einer Absage an die IdeeIdeen (Konzept) einer baldigen deutschen Einheit unter neutralem Status gleichkam. Die Situation blieb nach dem Mauerbau angespannt und im Oktober 1961 kam es zur ebenfalls berühmten Konfrontation sowjetischer und US-amerikanischer Panzer am Checkpoint Charlie, als dort US-Soldat*innen und Diplomat*innen trotz des vereinbarten freien Grenzverkehrs kontrolliert werden sollten. ChruschtschowChruschtschow, Nikita und KennedyKennedy, John F. mussten sich persönlich einschalten, um die Situation zu entspannen. Die Situation endete schließlich, weil ChruschtschowChruschtschow, Nikita aufgrund der US-amerikanischen nuklearen Überlegenheit kein ultimatives Druckmittel in der Hand hatte. Im Herbst 1962 wurde aber als Folge der Niederlage in Berlin erneut Druck auf die Westmächte aufgebaut, als die KubaKuba(krise)krise ausbrach und so diese Unterlegenheit wettgemacht werden sollte (s. Abschnitt 3.4; Münger 2003, Kap. 2; Schöllgen 2013b, 70ff.; Wettig 2005).