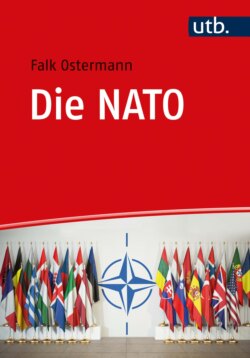Читать книгу Die NATO - Falk Ostermann - Страница 40
3.4.2 Konflikte: Kubakrise und die Debatte um flexible response
ОглавлениеDas Gleichgewicht des SchreckensGleichgewicht des Schreckens sollte nichtKuba(krise) dazu führenflexible response, dass es keine Konflikte mehr zwischen den Nuklearmächten gab. Im Herbst 1962 stand die Welt am Rand eines nuklearen Abgrunds, als die Sowjetunion damit begann, nukleare taktische Sprengkörper und MarschflugkörperMarschflugkörper (cruise missilescruise missilesMarschflugkörper)1 sowie IRBMIRBM (Nuklearwaffe)s im sozialistischen Bruderstaat in der Karibik zu stationieren (Münger 2003, Kap. 6). Die IRBMIRBM (Nuklearwaffe)s hätten die meisten US-Städte südlich einer Kreislinie von San Francisco nach Seattle treffen können, die näheren davon nur mit einer sehr geringen Vorwarnzeit (George 2013, 182). Sie stellten für die USA eine unmittelbare Gefahr und fundamentale Verletzung der Monroe-DoktrinMonroe-Doktrin dar, post mortem benannt nach dem 5. Präsidenten der USA, James MonroeMonroe, James (1758-1831, Präsident 1817-1825), nach der kein anderer (europäischer) Staat in der nord- und südamerikanischen Hemisphäre in der Lage sein sollte, die Führungsposition der USA infrage zu stellen oder Besitzansprüche zu erheben. Die Handlungen der USA und der Sowjetunion im Verlauf der KubaKuba(krise)krise (Cuban Missile Crisis) waren extrem konfrontativ und bewegten sich an der Schwelle zu offenem Krieg und nuklearer Eskalation, bevor sie Ende Oktober 1962 nach ein paar heißen Wochen zu Ende gingen (George 2013; Görtemaker 1979, 42ff.). Es ging der Sowjetunion in der Krise zweifelsohne darum, PrestigePrestige, Status gegenüber den USA zu erlangen, ihre atomare Schlagfähigkeit gegenüber dem Gegner, die technologisch noch nicht so weit entwickelt war, massiv zu erhöhen und den Erzfeind der USA, Fidel CastroCastro, Fidel, in seinem kommunistischKommunismusen Kampf zu unterstützen. Die Ereignisse in KubaKuba(krise) standen zudem nach heutiger Auffassung in Zusammenhang mit der Berlin-KriseBerlin-Krise (Münger 2003, 202ff.). Der amerikanische und westliche Widerstand gegen ChruschtschowChruschtschow, Nikitas Drohung der Isolation der Hauptstadt und einer einseitigen Veränderung des Status quo wurde von der sowjetischen Führung als vehement und kompromisslos wahrgenommen, sodass eine graduelle Eskalation auf KubaKuba(krise) in Kombination der o. g. Gründe als gute Lösung erschien (Combs 2012, 267ff.; Wettig 2005). Knorr (1990, 223) erörtert, dass KubaKuba(krise) ein „‚Drucktest‘“ der Sowjetunion für den neuen, jungen Präsidenten KennedyKennedy, John F. sein sollte.
Auch innerhalb der Allianz gab es zunehmende Uneinigkeit über nukleare Fragen (Görtemaker 1979, 56ff.). Seit 1960 holte die Sowjetunion technologisch in der Raketentechnik2 auf und war dadurch in der Lage, mögliche nukleare Angriffe auf ihr Territorium zu kontern (Kahn 1960, 24). Westdeutschland sah wegen seiner Rolle als Frontlinienstaat eine Abschwächung der nuklearen Drohung mit Argwohn, weil dies eine Verlagerung konventioneller Gefechte auf bundesdeutsches Territorium zur Folge gehabt hätte, musste aber die Konsequenzen eines möglichen nuklearen Kriegs auf eigenem Territorium bedenken (Hellmann 2007, 608; Küntzel 1992, 54ff.). Gleichzeitig begannen nach chinesischChinaen Nukleartests (1964) 1965 die UN-Verhandlungen zum AtomwaffenAtomwaffensperrvertrag (NPTAtomwaffensperrvertrag (NPT), s. dazu nächster Abschnitt), sodass insgesamt Unsicherheit entstand, wie ernst es die USA mit der nuklearen Garantie meinten (Bockenförde 2013, 40f.; Snyder 1961, 7). Charles de Gaullede Gaulle, Charless Bonmot, dass „Kein US-Präsident bereit sein wird, Chicago für Lyon einzutauschen“ (Pedlow 1997, XXI), drückte die Stimmung vieler aus (Yost 1984, 29ff.; Kahn 1960, 15ff.). Durch die Entwicklung der Wasserstoffbombe hatte sich die Zerstörungskraft von AtomwaffenAtomwaffen vervielfacht, sodass eine thermonukleare Antwort auf kleinere Auseinandersetzungen nicht mehr adäquat erschien. Gerade mit Blick auf die Situation in Berlin nach dem Bau der Mauer 1961 wurde über die richtige Staffelung einer Eskalation mit der Sowjetunion nachgedacht, z. B. durch den Einsatz kleinerer, taktischer NuklearwaffenAtomwaffen (Brodie 1959, 261ff., 337ff.). Der amerikanische Verteidigungsminister Robert McNamaraMcNamara, Robert, ein wichtiger Akteur in der KubaKuba(krise)krise, stellte aber heraus, dass KubaKuba(krise) gezeigt habe, dass NuklearwaffenAtomwaffen zwar wichtig seien, sie letztlich aber im Hintergrund von Auseinandersetzungen verblieben, in denen konventionelle Kräfte zunächst über Erfolg oder Misserfolg entscheiden würden (Pedlow 1997, XXII; s. auch Görtemaker 1979, 71f.; Snyder 1961, 63ff.). Gleichzeitig baute die Sowjetunion jedoch konsequent ein auf Europa zielendes, nukleares Drohungs- und Kriegspotentials auf (u. a. mit den SS-20-SS-20-RaketeRaketen, die zum NATO-DoppelbeschlussNATO-Doppelbeschluss führten, s. Exkurs). Somit trat die Nuklearfrage für die alliierte Verteidigungsstrategie für Europa nicht vollends in den Hintergrund, zumal die NATO seit Mitte der 1960er Jahre kaum vergleichbare nukleare KapazitätenKapazitäten (militärische) in Europa positionierte (Heuser 1995; Nuti et al. 2015; Yost 1984, 33ff., 87ff.).
Auf Basis dieser verschiedenen Überlegungen und Szenarien entstand ab 1962 die neue Doktrin der flexible responseflexible response. Nach dieser Nukleardoktrin wurde ein Atomangriff durch die NATO zwar nicht mehr ausgeschlossen, aber die IdeeIdeen (Konzept) war nun, dass „ein Angriff nun zunächst auf demselben Niveau beantwortet werden sollte, auf dem der Gegner angegriffen hatte“ (Bockenförde 2013, 40). Diese Strategie trug der neuen Situation Rechnung, dass im Falle eines alliierten Erstschlags ab den 1960er Jahren auch mit einer massiven nuklearen Antwort der Sowjetunion gerechnet werden musste, die ihre Raketenentwicklung vorangetrieben hatte.3 Außer Frankreich, das von der Strategie der massiven Vergeltungmassive Vergeltung nicht abweichen wollte, weil die durch flexible responseflexible response erhöhte Einsatzschwelle von NuklearwaffenAtomwaffen unvereinbar mit der eigenen AbschreckungAbschreckung (nuklear)sdoktrin gegenüber der UdSSR war (Kugler 1991, 57f.; Rühl 1997; Yost 1984, 54ff., 154f.), schlossen sich nach und nach alle Alliierten dieser Sichtweise an. Sie wurde jedoch erst nach dem französischen Austritt aus der integrierten Militärstruktur im Jahr 1967 offizielle Doktrin (Kugler 1991, 59; Combs 2012, 270f.). Letztlich verletzt flexible responseflexible response nicht die AbschreckungAbschreckung (nuklear)sprinzipien, weil in Anbetracht des engen und hochbevölkerten potentiellen europäischen Schlachtfelds auch ein begrenzter Einsatz von NuklearwaffenAtomwaffen schnell dieselben entgrenzten Folgen hätte haben können wie ein totaler Atomkrieg. Somit verschoben sich die Gefahren, genauso wie die Handlungsoptionen, wieder deutlicher in den konventionellen Bereich (Brodie 1959, 341). Auch das neue Strategische Konzept der Allianz aus dem Januar 1968 (MCMilitärkomitee 14/3, NATO 1968) trug dieser größeren Flexibilität in der militärischen Strategie der NATO Rechnung und formulierte wieder stärker konventionelle Antworten auf die Sicherheitsherausforderung durch die UdSSR. Durch die Einrichtung der Nuklearen Planungsgruppe im Dezember 1966 innerhalb der NATO-Militärstruktur wurde zudem ein neues Forum geschaffen, in dem Nuklearfragen auch unter Teilhabe der zwölf nichtnuklearen Mitglieder (und ohne Frankreich) besprochen werden konnten (Kugler 1991, 61f., 63ff.). Die 1968er Strategiedokumente waren flexibel genug, um bis zum Ende des Kalten KriegsEnde des Kalten Kriegs nicht mehr verändert werden zu müssen (Pedlow 1997, XXIIIff.). Es entwickelte sich nach 1968 dann eine größere EntspannungEntspannung(spolitik)sphase in der Blockkonfrontation, die sich durch erste Schritte hin zur RüstungskontrollRüstungskontrollee und AbrüstungAbrüstung ausdrückte. Der im Namen der NATO vom belgischen Außenminister Pierre HarmelHarmel, Pierre verfasste HarmelHarmel-Bericht-Bericht machte durch den Beschluss des NACNordatlantikrat (NAC) vom Dezember 1967 die Dualität aus Verteidigung/AbschreckungAbschreckung (nuklear) und EntspannungEntspannung(spolitik) zur offiziellen NATO-Strategie (Görtemaker 1979, 58ff.).
Exkurs: Der französische Rückzug aus der integrierten NATO-Militärstruktur 1966/67
Frankreich war ein starker Verfechter einer Politik nationaler AutonomieSouveränität, Autonomie (Grosser 1986, 223), die es sowohl aus historischem Antrieb als ehemalige Welt- und Kolonialmacht – seine letzte Kolonie Algerien gab Frankreich erst 1962 ab – mit demokratisch-universalistischem Führungsanspruch (grandeurgrandeur (Frankreich), Cerny 1980; Godin und Chafer 2006) als auch tagespolitischen, strategischen Gründen verfolgte. Frankreich positionierte sich nach dem Ende des Zweiten WeltkriegZweiter Weltkriegs klar im westlichen Lager, stand aber dem US-amerikanischen Führungsanspruch, den es als kulturgleichmachend und paternalistisch empfand, kritisch gegenüber, nicht zuletzt wegen des SuezSuez(krise)debakels und der US-amerikanischen Unterstützung für den Dekolonisierungsprozess. Charles de Gaullede Gaulle, Charles wandte sich daher strikt gegen eine Abhängigkeit von den USA (Grosser 1986, 191, 254 et al.) und wollte der Blockkonfrontation entkommen, die die US-Amerikaner*innen nach französischem Verständnis in den 1960er Jahren anheizten. De Gaulle widersetzte sich zunehmend der tiefgreifenden militärischen Integration in den NATO-Strukturen und zog bereits 1959 und 1963 französische Einheiten aus alliierten Marineverbänden ab (Vaïsse 2009a). Versuche zur Wiederbelebung eines amerikanisch-britisch-französischen Triumvirats zum Erreichen mehr außenpolitischer Koordination liefen ins Leere. Auch in Nuklearfragen waren Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten mit den USA an der Tagesordnung. Frankreich schlug (neben anderen Alliierten) ebenfalls US-Pläne zur Errichtung einer multilateralen Atomstreitmacht (MLF) aus, bei der ein Teil des Nukleararsenals der Verbündeten unter alliiertes Kommando gestellt worden wäre (Combs 2012, 269f.; Grosser 1986, 245ff.; Kugler 1991, 47ff.; Schmidt 1997, 115ff.; Vaïsse 2009b, 167ff.).
Die Divergenzen über die NATO-Integration, atomare Fragen und die Blockkonfrontation wurden schließlich so groß, dass de Gaullede Gaulle, Charles im Juni 1966 beschloss, der integrierten Militärstruktur – nicht aber der Allianz selbst, als dessen Teil er Frankreich unvermindert ansah – den Rücken zu kehren. Er zog in der Folge Luft- und Armeeeinheiten aus Deutschland ab und französische Offiziere verließen die gemeinsamen alliierten Stäbe, sodass beide nicht mehr unter direktem NATO-Oberbefehl standen. Daraufhin mussten US-amerikanische Truppen Stützpunkte in Frankreich und ihr EUCOM-Hauptquartier bis April 1967 verlassen und die NATO ihre politischen und militärischen Hauptquartiere aus Frankreich nach Brüssel und Mons (Belgien), verlegen.
Frankreich war durch diesen Schritt in der Lage, sich einen größeren AutonomieSouveränität, Autonomie- und Handlungsspielraum gegenüber den USA zu verschaffen, die nun neben der NATO auch bilateral mit Frankreich verhandeln mussten, um Einigkeit für die Verteidigung des nordatlantischen Raumes herzustellen. Frankreich kooperierte weiterhin auf militärischer und politischer Ebene mit der Allianz, konnte dies aber mit mehr Entscheidungsfreiheit tun (Vaïsse 2009b, 185ff.). Ironischerweise trug es so auch zu einer noch stärkeren Stellung der USA in der Militärstruktur bei. Diese vorteilhafte Position behielt Frankreich bis zum Ende des Kalten Krieges bei und blieb ihr auch darüber hinaus trotz erheblicher Einflusseinbußen nach dem Ende der Blockkonfrontation (Bertram 1997; Meimeth 1997; Menon 2000) bis ins Jahr 2009 treu, als es unter Präsident SarkozySarkozy, Nicolas in die Militärstruktur zurückkehrte (Fortmann et al. 2010; Ostermann 2019b). Zur Reintegration s. Exkurs in Kap. 4.3.