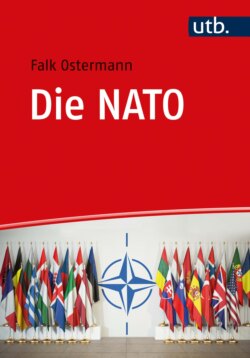Читать книгу Die NATO - Falk Ostermann - Страница 36
3.1.2 Neorealistische Allianztheorie und die NATO
ОглавлениеInRealismus (Neo-) ihrer SkepsisAllianztheorie gegenüber der Relevanz von Institutionen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben Realist*innen dennoch die Rolle von Allianzen theorisiert, die Staaten zum Zweck der Abwehr eines Feindes gründen. Stephen M. Walt hat mit seinem 1987er Buch The Origins of Alliances eine umfassende Studie vorgelegt, die das Zustandekommen, Bestehen und die Auflösung von Allianzen in historischer Perspektive betrachtet. Walt definiert Allianzen als formelle oder informelle Sicherheitsarrangements zwischen Staaten, die auf Gegenseitigkeit beruhen und exklusiv gegen andere Akteure gerichtet sind, von denen eine Gefahr für die Mitglieder ausgeht (Walt 1987, 12; 1997; s. auch Wallander und Keohane 1999, 23ff.). Walt führt fünf Erklärungen für das Zustandekommen von Allianzen an:
1 balancingbalancing: Staaten verbündeten sich gegen eine Gefahrenquelle;
2 bandwagoningbandwagoning: Ein Staat verbündet sich mit der Gefahrenquelle, um Appeasement zu betreiben oder als Sieger dazustehen;
3 ideologiIdeologiesche Gemeinsamkeiten: eine Allianz wird auf Basis gemeinsamer Prinzipien gegründet, um die Legitimität des eigenen Handelns zu steigern;
4 Bereitstellung von Gütern: Allianzgründung erfolgt, weil ein Staat gemeinsame Güter bereitstellt (z. B. militärische FähigkeitenKapazitäten (militärische)), die ein anderer Staat nicht hat. Abhängigkeitsbeziehungen (Dankbarkeit, Gefolgschaft) werden geschaffen oder gute Absichten kommuniziert;
5 Einflussnahme von außen verändert die öffentliche Meinung (z. B. durch Propaganda) oder politische Positionen von Personen in einem anderen Land (Walt 1987, Kap. 2).
In seinen ursprünglichen Überlegungen sah Walt vor allem die balancingbalancing- und bandwagoningbandwagoning-Logiken als bestimmend für Allianzgründungen an, während er den anderen drei Erklärungen nur eingeschränkte Gültigkeit attestierte. Im Bereich der IdeologiIdeologiee gäbe es sowohl trennende als auch einende Aspekte (z. B. würde die Zusammenarbeit mit oder unter autoritären Staaten eher konfliktiv, die unter liberalLiberalismusen Republiken eher einend verlaufen). Die Bereitstellung von Gütern als Grund, eine Allianz einzugehen, funktioniere nur, wenn der Anbieter des Gutes (z. B. Sicherheit) ein Monopol innehabe (nur er kann Sicherheit für den Käufer garantieren) und der annehmende Staat bedroht sei, der Anbieter jedoch nicht. Und schließlich sah er den Grund der innenpolitischen Beeinflussung von vielen gesellschaftlichen Kontextfaktoren im Zielland abhängig. Insgesamt wies Walt somit den Erklärungen 3-5 nur einen mittelbaren, intervenierenden Einfluss auf Allianzgründungen zu. Niemals sei das ideologiIdeologiesche Argument wichtiger als die Sicherheit eines Staates. Der primäre Grund, in eine Allianz einzutreten, sei daher immer in der Herstellung von Sicherheit und Überleben zu suchen (Walt 1987, 33ff.). Gemein ist den verschiedenen Ansätzen der AllianztheorieAllianztheorie die Betonung des nichtdauerhaften Charakters von Allianzen. Sie sehen auf militärischen Beistand zielende Bündnisse als spezifische Antworten auf konkrete Probleme, die beim Wegfall dieser Probleme erhebliche Kosten, vor allem für den HegemonHegemonie (USA), erzeugen können (buck-passing, s. Mearsheimer 1990, 15f.; Mearsheimer und Walt 2016).
Der Wandel internationaler Politik nach dem Ende des Kalten Krieges hat zu Anpassungen der realistischen AllianztheorieAllianztheorie geführt. Mearsheimer hat der NATO im Jahr 1990 den Untergang prophezeit, weil die Bedrohung durch die Sowjetunion nicht mehr bestand und das wiedervereinigteWiedervereinigung (deutsche) Deutschland bald seine neuen MachtMachtmöglichkeiten ausspielen würde (Mearsheimer 1990). Bekanntlich ist weder das eine noch das andere eingetreten: Die NATO feierte im Jahr 2019 ihren 70. Geburtstag und Deutschland setzte seine zurückhaltende ZivilmachtZivilmacht (Deutschland)-Außenpolitik unbeeindruckt von der Verbesserung seiner MachtMachtposition fort (Duffield 1999; Maull 2007). Walt überdachte daraufhin seine Theorie und räumte vier Aspekten größere Bedeutung ein: Erstens müsse man die identitäIdentitättsstiftende Rolle von gleichgerichteter IdeologiIdeologiee zwischen Staaten höher bewerten. Mit dieser Neubewertung bezieht er sich u.a. auf die Forschung zu Sicherheitsgemeinschaften von Karl W. Deutsch (Deutsch et al. 1968 [1957]; Deutsch 1970 [1954]; Adler und Barnett 1998).1 Politische Debatten wie die um ein globales Concert of DemocraciesConcert of Democracies (Alessandri 2008; Balladur 2008) oder eine Global NATOGlobal NATO (Adam 2007; Daalder und Goldgeier 2006; Bunde und Noetzel 2010; Clarke 2009; McCain 2008; Müller 2008, 45f.; Alessandri 2008) spiegeln letztlich die Rolle und Bedeutung von IdeologiIdeologiee für die Allianz wider. Zweitens wirke sich ein hoher InstitutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)ierungsgrad – also das Vorhandensein von Gremien, Bürokratie und Prozessen – auf das Fortbestehen von Bündnissen aus. Drittens könnten mächtige innenpolitische Eliten ein Interesse an der Aufrechterhaltung einer Allianz haben. Viertens könnte eine stark ungleiche Kostenverteilung zu Ungunsten eines wohlwollenden HegemonHegemonie (USA)en (Layne 2006, 17, mit Bezug zu Ikenberry), der daraus Vorteile zieht, ein stabilisierender Faktor sein (Walt 1997, 164ff.; ähnlich McCalla 1996, 456ff.). Die USA nehmen die Rolle des wohlwollenden HegemonHegemonie (USA) seit 1949 ein und haben sie trotz alle Konflikte in der Allianz um die Lastenverteilungburden-sharing aufrechterhalten. Erst unter TrumpTrump, Donald J. ist die NATO in einen manifesten Konflikt hierüber geraten, ohne die Rolle völlig abzulegen (s. Kap. 7.4). Auch Mearsheimer (1994, 13) unterstreicht die Relevanz von HegemonHegemonie (USA)ie für Allianzen, zieht daraus aber im Gegensatz zu Walt den Schluss, dass Allianzen immer auf einer balance of powerbalance of power-Logik beruhten, die in diesem Fall dem stärkeren Partner die Möglichkeit gibt, die Allianz in seinem Sinne zu prägen, wenn er bereit ist, dafür die Kosten zu tragen. Walts 2009er Aufsatz zu Alliances in a Unipolar World (Walt 2009) geht noch stärker auf die Folgen eines extrem übermächtigen HegemonHegemonie (USA)en wie den USA ein – eine Situation, die es so bisher in der Weltpolitik noch nicht gab. Er streicht heraus, dass Allianzen unter unipolarPolaritäten Bedingungen einerseits dem Unipol/ HegemonHegemonie (USA)en selbst quasi unbeschränkte Freiheit in seinen Politiken ermöglichen (s. auch Rösch 2016) und alliierte wie andere Staaten gleichzeitig dieser Übermacht kritischer gegenüberstehen. Gleichzeitig wird Gegenmachtbildung schwieriger. Auch intra-Allianzdynamiken seien kompliziert, weil Mitgliedstaaten weniger Verhandlungsgewicht als zu bipolarPolaritäten Bedingungen haben, in denen der HegemonHegemonie (USA) auf Kooperation angewiesen ist.
Diese Tendenzen und Probleme der NATO sind unserer Tage erkennbar, reichen aber bis zu ihrer Gründung zurück. Die für den BeistandsfallBündnisfall des NordatlantikvertragNordatlantikvertrags (Art. 5Bündnisfall) gefundenen Formulierungen stellen einen Kompromiss zwischen einer von europäischen Staaten gesuchten militärischen Beistandspflicht und einer nordamerikanischen Vorsicht gegenüber Beistandsautomatismen dar (Grosser 1986, 96f.; Ismay 1955, Kap. 2; Raflik 2011, 210). Der BeistandsartikelBündnisfall bewegt sich somit auf einer feinen Linie zwischen impliziter Verpflichtung zur Hilfe und Wahrung nationaler Selbstbestimmung. Er ist daher im Endeffekt ein im Vertrauen gegebenes Versprechen. Es lässt sich aus neorealistischer Sicht somit eine gewisse Vorsicht erkennen, sich zu fest an andere Staaten und ihre Handlungen zu binden, die den eigenen Interessen entgegenlaufen könnten. Die Formulierungen des NordatlantikvertragNordatlantikvertrags schützen die Verbündeten vor militärischen Abenteuern einzelner Mitglieder, indem sie durch die theoretische Möglichkeit der Nichtausrufung des BündnisfallBündnisfalls zur Vorsicht anhalten. Die geografischen Einschränkungen der Vertragsgültigkeit gehen in eine ähnliche Richtung. Praktisch bleibt dadurch vor allem der HegemonHegemonie (USA)ialmacht USA als militärisch eigenständigem Akteur ein größerer Freiheitsraum erhalten. Dieser Raum führt zu Situationen, in denen US-amerikanische Strategien mehr oder weniger unverändert auf die Allianz übertragen werden, z. B. bei Diskussionen um nukleare oder konventionelle Verteidigungsstrategien während des Kalten KriegsKalter Krieg (s. Kap. 3.4). Vor allem Frankreich kritisierte deshalb US-Paternalismus scharf (s. Exkurse). Diese historischen Ereignisse und Debatten legen Zeugnis davon ab, dass die starke Rolle der USA in der Allianz gleichzeitig unabdingbar, notwendig und problematisch war. So beobachtete Kugler im Jahr 1991:
„The United States made many tactical errors in Alliance management and perhaps a few strategic blunders. Often it behaved too unilaterally, without due regard for Allied sensitivities and the need for advance consultation. Sometimes, it sought too much, too quickly. And its larger visions for West European integration and transatlantic relations often were curiously blind to the goals of key allies, especially France. In later years, the United States was able to correct many of these shortcomings by behaving more patiently within NATO and by treating France with greater respect.“ (Kugler 1991, 141).
NATO-Handlungen gingen also häufig von US-Initiativen aus bzw. waren durch die überlegenen US-amerikanischen militärischen FähigkeitenKapazitäten (militärische) geprägt, die der Allianz ihren Stempel aufdrückten (Nötzel und Schreer 2009, 212f.). Die vertraglichen Regelungen und die Allianzpraxis sind also nicht völlig frei von relativen MachtMachtverhältnissen zwischen den Partnern. Aber vor allem während des Kalten KriegsKalter Krieg war die Kehrseite der Medaille stets auch die Sicherstellung der Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses, die klar im Blick der USA stand und im Interesse der europäischen Alliierten lag (Kugler 1991, 143; Nötzel und Schreer 2009, 212f.). Somit kann die Zusammenarbeit in der Atlantischen Allianz auch als ein Fall gesehen werden, in dem im Feld Sicherheit kompatible, wenngleich nicht immer konfliktfreie Interessen vorliegen (Keohane 1988, 380ff.; 1984, Kap. 6), die gleichzeitig durch MachtMachtbeziehungen beeinflusst werden. Die USA sind durch ihre militärisch wie institutionell herausgehobene Position in der NATO zwar in der Lage, eine Agenda entlang ihren Vorstellungen zu verfolgen, die Akzeptanz dieser Agenda und ihre Umsetzung sind aber von der Kooperation der Alliierten und dem Konsensprinzip abhängig. Dies macht deutlich, dass wahrscheinlich mehr Wirkmechanismen am Entstehen (und dem Ende) von Allianzen beteiligt sind, als Mearsheimer einräumt, und sich somit die revidierte, dem InstitutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)mus und LiberalisLiberalismusmus annähernde Version der Walt’schen AllianztheorieAllianztheorie als besseres Erklärungsgerüst anbietet (McCalla 1996). Die neorealistische AllianztheorieAllianztheorie hält uns aber zur Vorsicht an, in IdeologiIdeologieen und InstitutionalisInstitutionalismus (Neoliberaler)ierung nicht die einzigen Triebfedern von Militärbündnissen zu sehen.