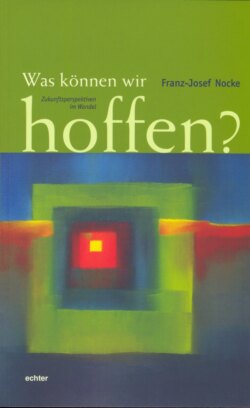Читать книгу Was können wir hoffen? - Franz-Josef Nocke - Страница 12
Erschrecken
ОглавлениеDiese optimistische Sicht wurde in Frage gestellt durch ein Erschrecken, das allerdings erst in einem sehr langsamen Prozess das öffentliche Bewusstsein erreichte: das Erschrecken über die bis dahin unvorstellbaren Ausmaße, in denen die Verfolgung und Vernichtung des jüdischen Volkes in Deutschland zwischen 1933 und 1945 betrieben worden war. Für viele der Opfer war ihr Geschichtsbild zerbrochen, nicht wenige rangen um ihren Glauben an einen mächtigen Gott. „Nie werde ich diese Nacht vergessen“, schrieb Elie Wiesel, der als Jugendlicher nach Auschwitz kam, „die erste Nacht im Lager, die aus meinem Leben eine siebenmal verriegelte lange Nacht gemacht hat… Nie werde ich die Augenblicke vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten, und meine Träume, die das Antlitz der Wüste annahmen.“4 Hans Jonas, dessen Mutter in Auschwitz umkam, ging die alten Hoffnungsmotive Israels durch, die einmal gegenüber geschichtlichem Elend Lebensperspektiven geboten hatten, das Exodus-Motiv von Gottes starkem Arm, das prophetische Motiv von Schuld und Heimsuchung, das makkabäische Motiv von Zeugenschaft und Martyrium, aber: „Nichts von all dem verfängt mehr bei dem Geschehen, das den Namen ‚Auschwitz‘ trägt.“5
Es brauchte aber Jahrzehnte, ja mehrere Generationen, bis dieses Erschrecken in größeren Teilen der deutschen Bevölkerung und auch der christlichen Kirchen6 und ihrer Theologie7 ankam. Wo es aber ankam, wuchsen Fragen, nicht nur nach dem, was im Menschen steckt, sondern auch nach dem Lauf der Geschichte und nach der Möglichkeit einer innergeschichtlichen Hoffnung. Wenn es eine Geschichte eines solchen sich immer mehr steigernden und fast selbstverständlich rezipierten Hasses geben konnte, und wenn die gewachsenen technischen und logistischen Möglichkeiten in den Dienst eines totalen Vernichtungswillens gestellt werden konnten, wie kann man dann von Fortschritt reden?