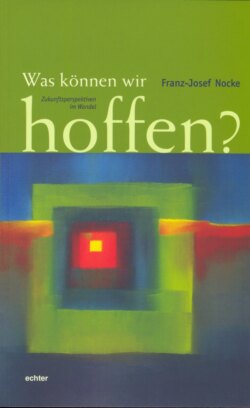Читать книгу Was können wir hoffen? - Franz-Josef Nocke - Страница 20
„Die letzten Dinge“
ОглавлениеDie neuscholastische Theologie des 19. Jahrhunderts, die bis um die Mitte des 20. Jahrhundert als die klassische katholische Schultheologie galt, wollte möglichst genau sein. Wenn sie in der Eschatologie von den „letzten Dingen“ sprach, klangen ihre Aussagen nicht wie dichterische Visionen, sondern wie ein sachlich distanzierter Bericht über bestimmte „Ereignisse“ in der Zukunft und über die nach diesen Ereignissen eintretenden „Zuständlichkeiten“.3 Lehrbücher der Eschatologie aus dieser Epoche lesen sich wie geographisch exakte Reiseführer in ein fremdes Land, und wie Fahrpläne, in denen die Stationen der Zukunft chronologisch genau verzeichnet sind. Man suchte physikalisch genau das Ende der Welt zu erklären, den „Weltbrand“, der als „Verbrennung der Erde und ihres Lufthimmels“ zu verstehen sei. Man machte sich Gedanken über den Zeitpunkt des Jüngsten Gerichts (vor oder nach dem Weltbrand?), über seinen Ort (im Tale Josaphat?), über den Wortlaut der Urteilssprüche, über die Dauer der gesamten Gerichtsveranstaltung, über die biologische Beschaffenheit des Auferstehungsleibes usw.4
Die neuscholastischen Theologen beriefen sich auf die Bibel und die kirchliche Tradition; aber mit ihrem Drang zur Genauigkeit unterschieden sie sich doch sehr von den Kirchenvätern, welche mit den biblischen Bildern spielerisch allegorisierend umzugehen wussten. Im Hintergrund dürfte, wenn auch unbewusst, das in der späten Neuzeit dominierend gewordene Ideal der „exakten“ Naturwissenschaften gestanden haben, das zu einem gewissen Minderwertigkeitskomplex bei den Geisteswissenschaften und zu entsprechenden Kompensationsversuchen beitrug.