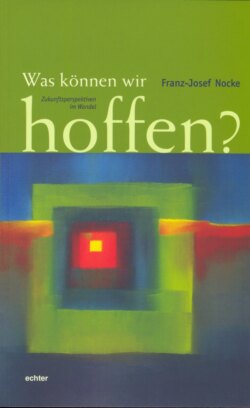Читать книгу Was können wir hoffen? - Franz-Josef Nocke - Страница 21
Bildersprache
ОглавлениеDemgegenüber hat die neuere Theologie (wie auch andere geisteswissenschaftliche Disziplinen) die spezifische Aussagekraft von Metaphern, Symbolen und Bildern wiederentdeckt. Für die Eschatologie ist die Unterscheidung zwischen exakter Informationssprache und offener Bildersprache besonders wichtig.
Zunächst einmal wegen der Herkunft der Eschatologie. Karl Rahner betonte in seinen „Überlegungen zur Hermeneutik eschatologischer Aussagen“ den Ursprung christlicher Zukunftserwartungen in den Erfahrungen der Gegenwart:
„Wir projizieren nicht von einer [etwa visionär geschauten] Zukunft etwas in die Gegenwart hinein, sondern wir projizieren unsere christliche Gegenwart in der Erfahrung des Menschen mit sich, mit Gott […] und in Christus auf seine Zukunft hin, weil der Mensch eben seine Gegenwart gar nicht anders verstehen kann denn als das Entstehen, das Werden, als die Dynamik auf eine Zukunft.“5
Das bedeutet sprachlich: Erfahrungen der Gegenwart werden zu Bildern der erhofften Zukunft. So ist es ja auch mit der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu. Nirgends findet sich im Neuen Testament eine Definition dessen, was mit „Reich Gottes“ gemeint sei. Jesus lädt Menschen ein, mit ihm zu gehen und auf dem Weg mit ihm Erfahrungen zu machen. Sie erfahren, wie kranke Menschen geheilt, wie Gedrückte aufgerichtet, wie Geängstigte ermutigt werden, wie Menschen, die unfähig zur Kommunikation sind (Taube, Stumme, Blinde), oder die durch ihre Krankheit oder ihre gesellschaftliche Rolle ausgeschlossen sind (Aussätzige, Zöllner, Prostituierte), in die Gemeinschaft zurückgeholt werden. Sie erleben, wenigstens anfangshaft, einen neuen Umgang miteinander, Versöhnung und Zusammenführung bislang Verfeindeter, Geschwisterlichkeit statt Herrschaftsansprüche. Sie erleben sogar die Entmachtung des Todes. Sie erfahren verwundert, dass Jesus diese erstaunlichen Veränderungen nicht nur selbst bewirken kann, sondern dass er sie auch ihnen zutraut, als er sie in die Dörfer und Städte Israels schickt, und sie merken, dass sie wirklich dazu fähig werden. So fängt für sie das Reich Gottes an. So spüren sie die das Leben und die Welt verändernde Nähe Gottes.
Als sie nach der Ermordung Jesu die neue Lebendigkeit des Auferstandenen erfahren, da wächst ihnen die Gewissheit, dass dieses Reich Gottes Zukunft hat. Sie können ihren Glauben an Jesus mit den alten Hoffnungsbildern Israels verbinden: mit dem Bild vom Brot und Wein in Überfluss, vom friedlichen Nebeneinander der wilden Tiere, vom festlichen Friedensfest der Völker… Ihnen wird klar, dass alles bisher Erlebte erst ein Anfang war. Sie haben eine Zukunft vor Augen, in der die kleinen Saatkörner groß aufgehen werden. Sie können von dieser Zukunft eigentlich nur sprechen, indem sie von den kleinen Körnern reden. Sie können nicht anders als in Bildern sprechen. Aber diese Bilder sind keine geheimen Rätselworte, sondern sie erzählen von Erfahrungen: von Heilungen, Tischgemeinschaften, Auferstehungen.
So ist es mit der Sprache der Hoffnung. Es geht ja primär nicht um Informationen, sondern um Lebensperspektiven. Nicht eine ferne Zukunft soll detailliert und genau beschrieben werden, nicht himmlische oder höllische Landschaften sollen exakt dargestellt werden, als wären sie von Geographen vermessen, sondern dem Lebensweg soll eine Richtung gegeben werden: In welcher Richtung ist etwas zu erwarten? Welche Schritte zählen? Deshalb nennen wir die Eschatologie heute auch lieber nicht „Lehre von den letzten Dingen“, sondern „Theologie der Zukunft“ oder „Theologie der Hoffnung“. Hoffnungsperspektiven werden in Bildern aufgebaut.
Aber man sollte nicht sagen: „Ach, nur Bilder!“, als wären diese weniger wert als sachliche Informationen. Es kommt auf den Gegenstand an. Frage ich jemanden nach dem Weg, nach der Abfahrt des Zuges oder nach dem Preis für eine Ware, dann brauche ich eine Sachinformation. Die Tugend der Informationssprache ist ihre Genauigkeit: Bei Entfernungen, Uhrzeit, Preisen u.ä. geht es um Zahlen. Geht es aber um die Liebe oder um die Hoffnung, dann ist eine andere Sprache eher angebracht. Wenn ein Freund seiner Freundin verspricht, nicht von ihrer Seite zu gehen, wenn sie ihm sagt, sie wolle mit ihm ihr Lebenshaus bauen, dann sagen sie einander mehr, als wenn sie exakte Prognosen über den geographischen Ort ihres künftigen Wohnsitzes machten oder präzise finanzielle Regelungen miteinander absprächen.
Bildersprache ist auch nicht das bloße Ergebnis einer Verlegenheit, etwa: weil man es nicht genauer sagen kann; sie hat vielmehr ihre eigenen spezifischen Stärken. Bilder sind einerseits konkret und von daher fähig, an gegenwärtige Erfahrungen und Erwartungen anzuknüpfen; andererseits eignet der Bildersprache eine gewisse Offenheit. Die Bilder können in andere übergehen, sich selbst transzendieren, die Erwartungen können sich weiten, ohne dass die Kontinuität der Hoffnungs- und Verheißungsgeschichte verloren ginge. In diesem Sinne ist auch die Verwandlung biblischer Hoffnungsbilder interessant. Die Bibelwissenschaft spricht von „Motivtransposition“: Aus der Verheißung von Weideplätzen in der Abrahams-Geschichte wird die Verheißung eines Landes, in dem Milch und Honig fließen, in der Exodus-Geschichte. Der erste Exodus (aus Ägypten) wird durch einen noch großartigeren, zweiten Exodus (aus Babylon) übertroffen, der Bundesschluss am Sinai durch die Verheißung eines größeren, neuen Bundes.
Hoffnungsbilder leisten außerdem noch etwas Wichtiges: Sie sprechen mit dem Vorstellungsmaterial der Gegenwart von der erhofften Zukunft, und so verbinden sie Zukunft und Gegenwart miteinander. So wird die erhoffte Zukunft z. B. mit dem Bild eines festlichen Hochzeitsmahles geschildert. Damit werden konkrete irdische Ereignisse wie die Hochzeit, das Mahlhalten, das Miteinander-Teilen zu Vorzeichen einer guten Zukunft – und gewinnen so nochmals eine besondere Bedeutung.
Auch das Wort „Auferstehung“ ist ja ein Bildwort: Jemand, der liegt, erhebt sich. Das tun wir jeden Morgen. Das Aufstehen kann aber auch zum Bild für einen psychischen Vorgang werden. Wir sagen: Ich war „down“, „ganz unten“, wusste nicht, wie ich wieder auf die Beine kommen sollte. Da hat mich jemand „aufgerichtet“. Manche sprechen sogar ausdrücklich von einer „Auferstehung mitten im Leben“. Sie deuten damit an, dass sie einen Zusammenhang zwischen Rettungserfahrungen in diesem Leben und der Auferstehung aus dem Tod am Ende dieses Lebens sehen.6