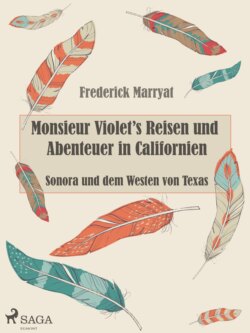Читать книгу Monsieur Violet's Reisen und Abenteuer in Californien, Sonora und dem Westen von Texas - Фредерик Марриет - Страница 12
Neuntes Kapitel.
ОглавлениеDie Bemerkungen, die ich über die Shoshonen zu machen gedenke, lassen sich eben so gut auch auf die Comanchen, Apachen und Arrapahoes anwenden, da sie nur Unterabtheilungen und Sprösslinge des ursprünglichen Stammes sind. Die Wakoes, die von andern Reisenden noch nicht erwähnt, ja noch nicht einmal gesehen wurden, werde ich nachher beschreiben.
Es ist hier wohl der Ort, anzudeuten, dass die Shoshonen, obgleich sie mit den Comanchen und Apachen stets im Frieden leben, doch seit geraumer Zeit gegen ihre andern Abkömmlinge, die Arrapahoes, desgleichen auch gegen sämmtliche Dahcotah- und Algonquins-Stämme, die Krähen, die Kickarees, die Schwarzfüsse, die durchbohrten Nasen und andere, Krieg führten.
Was nun erstlich die Religion der Schlangenindianer betrifft, so wirft diese höchst interessante Frage vielleicht mehr Licht auf ihren Ursprung, als aus ihren Ueberlieferungen, Sitten und Gebräuchen erholt werden kann. Soweit ich die Indianer kenne, glaube ich, dass sie vielleicht nicht so religiös, jedenfalls aber weit gewissenhafter sind, als die meisten Christen. Sie glauben Alle an einen einzigen Gott, den Manitou, den sie als den Urheber alles Guten verehren; sie sind jedoch der Ansicht, die menschliche Natur sey zu niedrig, um mit dem „Herrn über Alles“ zu verkehren, weshalb sie in der Regel die Elemente und sogar gewisse Thiere zu ihren Vermittlern wählen, etwa wie dies bei den Katholiken ihren Heiligen gegenüber der Fall ist.
Der grosse Manitou wird von allen wilden Stämmen Nordamerika’s gleichförmig verehrt, und nur der vermittelnde Geist wechselt, obgleich Letzteres nach der Wahl des Einzelnen geschieht und keine nationale Grundzüge dabei stattfinden. Die Kinder lehrt man den „Kishe Manito“ (den Allmächtigen) kennen, weiter nicht. Erst wenn der Knabe in das Jünglingsalter übergeht, wählt er sich eine eigene Gottheit, eine Art Penaten, den er in seinen Träumen kennen lernt. Wenn ein junger Mensch seine Absicht kund gibt, den Geist aufzusuchen, so tragen ihm seine Eltern auf, drei Tage zu fasten; dann nehmen sie ihm Bogen und Pfeile weg und schicken ihn weit hinaus in die Wälder, in’s Gebirge oder in die Prairieen, damit er daselbst die Heimsuchung erwarte.
Ein leerer Magen und Unthätigkeit in der einsamen Wildniss sind gewiss geeignet, wache Träume hervorzurufen. Der junge Mensch denkt an Wasser, Büffel oder Fisch, wenn er hungrig und durstig ist, an Feuer und Sonnenschein aber, wenn er friert. Bisweilen trifft er mit einem Gewürm zusammen, und seine Einbildungskraft verarbeitet derartige natürliche Ursachen oder Erscheinungen so lange, bis sie ganz davon erfüllt ist.
In dieser Weise werden Feuer, Wasser, Sonne, Mond, ein Stern, ein Büffel oder eine Schlange, Gegenstände seiner Gedanken, und natürlich träumt er auch von dem, über was er zuvor gebrütet hat.
Er kehrt dann nach Hause zurück, gräbt auf einen Stein, ein Stück Holz oder auf eine Haut die Gestalt des „Geistes,“ den sein Traum gewählt hat, trägt ihn beständig auf dem Leibe und redet ihn an als einen Fürsprecher, durch den seine Gelübde gehen müssen, ehe sie den furchtbaren Herrn aller Dinge erreichen können.
Einige unter den Indianern erhalten durch ihre Tugenden und ihre regelwässige Lebensweise das Privilegium, sich unmittelbar an den Schöpfer zu wenden, und werden dann in den Bund eingeführt, an dessen Spitze die Ceremonienmeister und die Vorsteher der geheiligten Hütten stehen, welche Novizen aufnehmen und Würden ertheilen können. Ihr Ritus ist geheim, und nur die Mitglieder können Zugang finden. Diese Priester sind, wie vordem die der Isis und Osiris, sehr gelehrt und besitzen erstaunliche Kenntnisse von der Naturgeschichte; desgleichen verstehen sie sich gut auf Astronomie und Botanik, bewahren die Ueberlieferungen und grossen Ereignisse der Stämme auf und bedienen sich gewisser Hieroglyphen, die sie in die geheiligten Hütten malen — eine Zeichenschrift, welche ausser den Angehörigen ihrer Kaste Niemand zu entziffern vermag. Die Wenigen, welche auf ihren Wanderungen von einer Schlange „geträumt“ und sie zu ihrem „Geiste“ gemacht haben, werden unabänderlich „Aerzte“. Die Indianer fürchten dieses Gewürm und bringen es mit dem bösen Geiste in Verbindung, obgleich es in den westlichen Thälern, mit Ausnahme der Gebirge an dem Columbia-Flusse, wo man auf eine Menge Klapperschlangen trifft, keine giftigen Arten gibt. Als „Kishe Manito“ (der gute Gott), in der Gestalt eines Büffels auf die Erde kam, um die Leiden der rothen Menschen zu erleichtern, wurde er von dem bösen Geiste, „Kinebec“ (Schlange) bekämpft. Dieser Theil ihres Glaubensbekenntnisses ist fast ausschliesslich im Stande, den Braminenursprung zu beweisen.
Der „Arzt“ flösst den Indianern Ehrfurcht und Schrecken ein; er ist zwar geachtet, hat aber weder Freunde, noch Weiber oder Kinder. Er verkehrt mit dem bösen Geiste, ist der Mann der dunkeln Thaten, holt seine Kenntnisse von der Erde und aus den Felsklüften, weiss Gifte zu mischen, und ist der einzige, der den „Anim Teki“ (Donner), nicht fürchtet. Mit seinen Zauberformeln kann er Krankheiten heilen, aber auch tödten. Sein Blick ist der Blick der Schlange; er macht das Gras welken, bannt Vögel und Thiere, verwirrt das Gehirn des Menschen und schleudert Furcht und Düster in dessen Herz.
Die Weiber der Shoshonen, der Apachen und Arrapahoes, wie überhaupt aller, die der Shoshonenrace angehören, sind in Betreff ihres Körperbaus den Squaws der östlichen Indianer weit überlegen. Ich kann sie nicht besser schildern, als wenn ich sage, dass sie mit den Araberweibern die grösste Aehnlichkeit haben. Von Person und in ihrem Hauswesen sind sie sehr reinlich, und da alle ihre Stämme sowohl männliche als weibliche Sklaven haben, so wird der Wuchs eines Shoshonenweibes nicht durch schwere Arbeit verkümmert, wie dies bei den Squaws der östlichen Stämme der Fall ist. Gegen ihre Gatten sind sie sehr treu, und ich glaube zuversichtlich, dass jeder Angriff auf ihre Keuschheit vergeblich seyn würde. Sie reiten so rüstig als die Männer und sind in dem Gebrauch der Bogen und Pfeile gut erfahren. Ich war einmal Zeuge, wie ein sehr schönes, zehnjähriges Shoshonen-Mädchen, die Tochter eines Häuptlings, während ihr Pferd in vollem Galopp einherjagte, mit ihrem Geschosse im Laufe von ein paar Minuten neun wilde Truthühner tödtete, auf welche sie Jagd machte.
Ihr Anzug ist eben so geschmackvoll, als züchtig. Er besteht aus einem weiten Hemde von weicher Hirschhaut, mit knapp anliegenden Aermeln, das fast immer blau ader roth gefärbt ist; darüber befindet sich vom Gürtel an ein anderes Gewand, das vier oder sechs Zoll über das Knie hinunterfällt und aus Schwanenflaum, Seide oder Wolle gefertigt ist. Sie tragen Beinkleider von dem nämlichen Materiale, aus welchem das Hemd besteht, und bedecken ihre zierlichen, kleinen Füsse mit schön gearbeiteten Moccasfins. Ausserdem tragen sie noch eine Schärpe von reichem Gewebe und lassen ihre weichen, langen Rabenhaare, die sie gewöhnlich mit Blumen, bisweilen aber auch mit sehr werthvollen Juwelen zieren, in üppiger Fülle über die Schultern niederwallen. Ihre Hand- und Fussgelenke sind von Spangen umgeben, und wenn man einem dieser jungen und anmuthigen Geschöpfe begegnet, wie es mit leuchtenden Augen und aufgeregtem Gesichte der Jagd obliegt, so wird man unwillkürlich an die Schilderungen erinnert, die uns Ovid von den Nymphen der Diana gibt10).
Obgleich die Weiber an den tieferen Mysterien der Religion keinen Theil nehmen, so wird es doch einigen gestattet, sich der Gottheit zu weihen und ein Keuschheitsgelübde abzulegen, wie die Vestalinnen des Heidenthums oder die Nonnen in den katholischen Klöstern. Sie kleiden sich wie die Männer von Kopf bis zu Fuss in Leder und malen ein Bild der Sonne auf ihre Brust. Diese Weiber sind Kriegerinnen, ziehen aber nie in’s Feld, sondern bleiben immer zurück, um die Dörfer zu beschützen. Sie leben einsam und sind gefürchtet, werden aber nicht geliebt; denn der Indianer hasst Alles, was sich eine ungebührliche Gewalt anmasst, die von der Natur angewiesenen Schranken überschreitet oder die ihm angewiesene Bestimmung nicht erfüllt.
Die schönen Sommerabende verwenden die jungen Indianer auf Liebeswerbung. Hat einer seine Wahl getroffen, so gibt er seinen Eltern davon Kunde, welche sofort das Weitere auf sich nehmen. Man bringt Geschenke vor die Thüre der Schönen; werden sie nicht angenommen, so ist die Sache abgethan und der junge Mann muss sich irgendwo anders umsehen; im andern Falle folgen Gegengeschenke zum Zeichen des Einverständnisses. Letztere bestehen in der Regel aus weiblichen Arbeiten, Hosenbändern, Gürteln, Moccasins. Dann findet eine Zusammenkunft zwischen den Eltern statt; sie schliesst mit einer Rede des Brautvaters, welcher seine „Taube“, „Lilie“, „Flüsterstimme des Windes“ oder wie fie sonst heissen mag, lobt. Sie ist eine gute Tochter gewesen, und wird deshalb auch ein gehorsames Weib seyn; ihr Blut ist das eines Kriegers — sie wird ihrem Gatten edle Kinder gebähren und ihnen singen von seinen grossen Thaten u. s. w. u. s. w. Endlich kommt der Vermählungstag heran. Ein Mahl aus Wurzeln und Früchten wird bereitet, und alle Verwandten sind gegenwärtig, den Bräutigam ausgenommen, dessen Waffen, Sättel und sonstige Habe hinter der Schönen aufgestellt siud. Die Thüre der Hütte ist offen und die Schwelle mit Blumen geschmückt. Um Sonnenuntergang stellt sich der junge Mann mit grosser Würde in seinem Benehmen ein. Hat er neben dem Mädchen Platz genommen, so fangen die Gäste an zu essen, ohne zu sprechen; sobald jedoch von den Müttern ein Zeichen gegeben wird, stehen sie auf, um sich zu entfernen. Nun kreuzt das Brautpaar die Hände, und der Bräutigam redet jetzt zum erstenmale, indem er fragt: — „Treu der Hütte, treu dem Vater, treu seinen Kindern?“ Sie antwortet leise: „Treu, stets treu, in Freude und Leid, im Leben und im Tode“ — „Penir, penir-asha, sartir nú cohta, lebeck nú tanim.“ Dies ist die letzte Formel und die Ceremonie jetzt beendigt. Sie mag sehr einfach und vielleicht lächerlich erscheinen, mir aber kam sie beinahe erhaben vor. Die Ansichten sind Früchte der Erziehung und der Gewohnheiten.
Der Gatte bleibt ein ganzes Jahr bei seinem Schwiegervater, an den er seine Jagdbeute, sowohl Häute, als Wildpret abtragen muss. Nach Ablauf dieser Periode ist seine Dienstzeit vorüber, und er kann dann mit seiner Gattin entweder zu seinem eigenen Vater zurückkehren, oder sich eine Hütte bauen. Der Jäger bringt sein Wild nach Hause, wenn es nicht zu schwer ist, und damit ist sein Geschäft zu Ende; das Weib zieht die Haut ab, trocknet sie und salzt das Fleisch ein. Ist übrigens der Gatte ein Jäger ersten Ranges und somit seine Zeit kostbar, so ziehen das Weib selbst oder weibliche Verwandte von ihr aus, um die Beute an Ort und Stelle aufzusuchen. Wenn ein Mann stirbt, trauert die Wittwe zwei bis vier Jahre; ein Gleiches thut der Mann, wenn seine Gattin stirbt, nur ist er hiezu nicht so streng verpflichtet, als das Weib, und es trifft sich oft, dass er nach Ablauf von zwei Jahren seine Schwägerin heirathet. Die Indianer halten dies für natürlich und sind der Meinung, ein Weib werde sorgfältiger gegen die Kinder ihrer Schwester seyn, als gegen die Kinder einer Fremden. Unter den bessern Klassen verlobt man die Kinder schon in einem Alter von einigen Monaten; dergleichen Zusagen sind heilig und werd en nie gebrochen.
Gegen den Mord haben die Indianer im Allgemeinen sehr strenge Gesetze, die sich unter den Stämmen so ziemlich gleich verhalten. Sie zerfallen in zwei gesonderte Abtheilungen — Mord, begangen von einem Angehörigen des Volkes, und Mord, begangen von einem Fremden.
Begeht ein Einheimischer einen Mord an einem Stammesgenossen, so entweicht oder er überliefert sich der Gerechtigkeit. Im letzteren Falle tödtet ihn der nächste Verwandte des Erschlagenen öffentlich und in Gegenwart aller Krieger. Hat sich der Mörder geflüchtet, so wird er nicht verfolgt, sondern sein nächster Verwandter hat für die That einzustehen und muss die Strafe derselben erleiden, wenn er innerhalb einer gegebenen Frist den eigentlichen Uebelthäter nicht beigeschafft hat. Eine solche richterliche Tödtung wird schnell vermittelst eines Tomahawkhiebes vollstreckt. Oft bemüht sich der Häuptling, die betreffenden Theile zu veranlassen, dass sie die Friedenspfeife mit einander rauchen; gelingt dies, so hat Alles ein Ende — wo nicht, so muss ein Opfer fallen. Dies ist ein strenges Gesetz, das nicht selten viel Unheil zur Folge hat. Die Blutrache hat sich oft von Generation auf Generation vererbt, und Mord folgte aus Mord, bis endlich eine der feindlichen Familien den Stamm verliess.
Ohne Zweifel ist es derartigen Umständen zuzuschreiben, dass grosse Familien oder Gemeinschaften von Wilden, welche die gleichen Grundzüge tragen und die nämliche Sprache reden, sich in so viele gesonderte Stämme getheilt haben. Die Shoshonen erzeugten die Comanchen, Apachen und Arrapahoes, während später von den Comanchen wieder die Tonquewas, von den Apachen die Lepans und die nun ausgestorbenen Texas11), von den Arraphoes aber die Nahawoes ausgingen. Unter den Nadowessiern oder Dahcotahs ist die Spaltung noch grösser gewesen; aus ihnen bildeten sich die Konsas, die Mandans, die Tetons, die Yangtongs, die Sassitongs, die Olla-gallahs, die Sionen, die Wallah-wallahs, die Cayusen, die Schwarzfüsse und endlich die Winnebagoes.
Von der Algonquin-Raçe sind nicht weniger als einundzwanzig verschiedene Stämme ausgegangen: die Micmacs, die Etchemins, die Abenakis, die Sokokis, die Pawtucket, die Pokanokets, die Narragansets, die Pequods, die Mohegans, die Lenilenapen, die Nanticoken, die Powatans, die Shawnees, die Miamis, die Illinois, die Chippewas, die Ottawas, die Menomonier, die Sacs, die Füchse und die Kickapoos, welche sich später wieder in mehr als hundert Nationen zertheilten.
Kehren wir jedoch wieder zu den Gesetzen über den Mord zurück. Es trifft sich oft, dass der Neffe oder der Bruder des Mörders sein Leben zur Sühne anbietet. Nicht selten werden namentlich von den ärmeren Familien derartige Selbstopferungen angenommen, obschon dieser Verwandte nicht dem Tode geweiht wird, sondern nur sein Verhältniss zu seinen früheren Angehörigen aufgeben muss; er wird eine Art Sklave oder Vasall für Lebenszeit unter den Hinterbliebenen des Erschlagenen. Bisweilen, jedoch nur in sehr seltenen Fällen rettet der Schuldige sein Leben durch ein eigenthümliches, sehr altes Gesetz. Wenn der Ermordete eine Wittwe mit Kindern hinterlässt, so kann diese den Verbrecher als ihr Eigenthum ansprechen: er wird dem Namen nach ihr Gatte — das heisst, er muss jagen und für den Unterhalt der Familie sorgen.
Ist der Mörder aus einem feindlichen Stamme, so wird ohne Verzug der Krieg erklärt; gehört er jedoch einem befreundeten Volke an, so wartet man drei oder vier Monate ab, ob die Häuptlinge nicht kommen, um sich zu entschuldigen und Ersatz anzubieten. Im letztern Falle bringen sie Geschenke und legen dieselben an der Thüre des Berathungshauses nieder, in welchem sich auf der einen Seite die Verwandten des Erschlagenen, auf der anderen die Häuptlinge und Krieger des Stammes, in der Mitte aber die Gesandten befinden. Von diesen eröffnet Einer die Ceremonie, indem er eine Friedensrede hält, während ein Anderer den Verwandten die Pfeife anbietet. Wird sie nicht angenommen und hegt der grosse Häuptling des Stammes eine besondere Achtung gegen die andere Nation, so steht er auf und bietet selbst das Columet der Versöhnung an. Weigern sich die Verwandten noch immer, so werden sämmtliche Kinder des Ermordeten bis auf den Säugling herab, in die Hütte gerufen, und man reicht jetzt die Pfeife zum drittenmale herum. Wenn nun ein Kind, wäre es auch nur ein paar Monate alt, das Calumet berührt, so betrachten die Indianer dies als eine Entscheidung des Maniton; die Pfeife geht im Kreise, die Geschenke werden hereingebracht und zu den Füssen der Kläger niedergelegt. Andernfalls aber kann nur das Leben des Mörders den Stamm zufrieden stellen.
Wenn die Häuptlinge des Stammes, welchen der Mörder angehört, ihr Dorf verlassen, um Versöhnung zu stiften, so bringen sie das verlangte Opfer, das wohl bewaffnet ist, mit sich. Steht ber Mörder als Mensch und Krieger in hoher Achtung, so folgen ihm die Häuptlinge seines Stammes mit einer grossen Anzahl von Leuten, welche, ehe sie in die Berathungshütte treten, ihre Gesichter bemalen: die Farbe ist bei Einigen schwarz mit grünen Flecken, bei Andern ganz grün, nach Weise der Friedenspfeife, welche stets eine grüne Färbung hat.
Die Verwandten des Ermordeten stehen auf der einen Seite der Hütte, die Krieger des andern Stammes ihnen gegenüber. In der Mitte befindet sich der Häuptling, neben dem der Träger der Friedenspfeife und der Mörder steht. Der Häuptling hält sodann eine Rede und nähert sich mit dem Pfeifenträger und dem Mörder den Verwandten des Erschlagenen; er bittet sie, jeden insbesondere, von der dargebotenen Pfeife zu rauchen und wendet sich, wenn ihn der Eine zurückgewiesen hat, an den Andern.
Diese ganze Zeit über steht der wohlbewaffnete Mörder an der Seite des Häuptlings, rückt langsam näher und hat stets seinen Bogen oder Karabiner angelegt, um auf jeden der Verwandten zu schiessen, der es versuchen sollte, ihm an’s Leben zu gehen, ehe die Pfeife von der Gesammtheit zurückgewiesen wurde. Ist dies endlich geschehen, und wünscht der Häuptling den Frieden, oder kümmert er sich nicht viel um den Mörder, so gestattet er mit seinen Leuten, dass der Letztere getödtet werde; im Gegentheile aber erheben sie das Schlachtgeschrei, vertheidigen das Leben ihres Stammesgenossen und von nun an beginnt der Kampf zwischen den beiden Völkern.
Gewöhnlich nimmt man aber die Friedenspfeife an, ehe man es also zum Aeussersten kommen lässt.
Ich komme nun auf die Waffen und die Ausrüstung der Shoshonenkrieger, bemerke übrigens zu gleicher Zeit, dass sich Alles, was ich darüber sage, auch auf die Apachen, die Arrapahoes und die Comanchen beziehen lässt, indem sich die Shoshonen vor Letzteren nur durch ihre grössere Geschicklichkeit auszeichnen. Der Shoshone ist immer beritten und sitzt fest auf einem kleinen, leichten, selbstgefertigten Sattel ohne Steigbügel, von denen sie keine Freunde sind. Nur die Häuptlinge und berühmten Krieger führen diese Zugehör als ein Merkmal der Auszeichnung, um so mehr, da die Sättel mit Bügeln in der Regel Trophäen sind, die von einem besiegten Feinde gewonnen werden.
In dem Schmuck ihrer Pferde zeigen sie so viel Geschmack, wie die Mexikaner, die Krähen oder die östlichen Indianer, denn sie glauben, dass die natürliche Schönheit und Anmuth des Thieres durch bunten Prunk an Harmonie verlieren würde. Das einzige Merkmal von Auszeichnung, das sie an ihren Rossen anbringen (und zwar nur die Häuptlinge), besteht in ein paar Adlerfedern an der Zaumrosette unter dem linken Ohre. Der Shoshone behandelt sein Pferd wie einen Freund, hätschelt es, pflegt es und misshandelt es nie; es ist daher immer in einem vortrefflichen Zustande und bildet mit seinen stolzen Augen und seiner majestätischen Haltung das Ideal eines schönen, anmuthigen Thieres. Der elegante Putz und die zierliche Gestalt eines Shoshonenreiters harmonirt wunderbar mit dem wilden, stolzen Aeussern seines Rosses.
Der Shoshone lässt seine schön gekämmten Locken in dem Winde flattern und drückt sie nur durch eine dünne, metallene Krone an seinen Kopf, in welcher dieselben Federn stecken, wie an der Rosette seines Thieres. Diese Krone besteht entweder aus Gold oder Silber, und diejenigen, welche derartige Metalle nicht zu erschwingen vermögen, fertigen sie aus Schwanenflaum oder Hirschhaut, zur Zierde die Stacheln des Stachelschweins benützend. Die Arme sind bloss und die Handgelenke mit Spangen von dem Materiale der Krone umgeben. Der Körper ist vom Halse bis zum Gürtel mit einem kleinen Hemde von weichem Hirschleder gehüllt, das sich faltenlos anschmiegt. Vom Gürtel an bis zum Knie wallt ein weites Uebergewand aus schwarzem, braunem, rothem oder weissem Wollenoder Seidenstoffe, den der Indianer zu Monterey oder St. Franzisco aus den Händen der Valparaiso- und Chinahändler bezieht; seine Füsse sind vom Knöchel an bis zur Hüfte mit Beinkleidern aus Hirschleder bedeckt, das mit vegetabilischen Säuren roth oder schwarz gefärbt und mit Menschenhaaren zusammen genäht ist, welche an der Aussenseite umherfliegen oder sich in Zöpfe verschlingen. Ueber den Knöcheln befinden sich wieder metallene Spangen, der Fuss selbst aber steckt in einem eleganten Moccasin, bisweilen mit schönen, runden, erbsgrossen Scharlachmuscheln verziert, die man unter den fossilen Ueberresten des Landes findet.
Das Obergewand ist durch einen Gürtel um den Leib befestigt; die Squaws fertigen denselben gewöhnlich aus den zarten Fasern den Seidenbaums, einer Abart der Wollenstaude, welche stets mit langen, fast untastbaren, aber doch sehr starken Fäden bedeckt ist. Diese werden zusammengewoben und schön gefärbt. Zuverlässig würden solche Schärpen, die zwölf bis fünfzehn Fuss Länge haben, von den Pariser und Londoner vornehmen Damen zu grossen Preisen bezahlt werden, denn ich habe oft ein derartiges Gewebe in meine Hand eingeschlossen, ohne dass ihr Umfang merklich dadurch vergrössert worden wäre.
In dem Gürtel steckt links das Messer und rechts der Tomahawk. Bogen und Köcher hängen an drei Zoll breiten Schwanenflaumriemen über die Schultern, während die lange, mit reichem Schnitzwerk und blanker Kupfer- oder Eisenspitze versehene Lanze horizontal an der Seite des Pferdes getragen wird. Wer einen Karabiner besitzt, befestigt denselben auf der linken Seite an einen Ring und Haken; der Schaft reicht bis an den Gürtel und die Mündung ragt ein wenig über das Knie vor.
Die jüngeren Krieger, die keine Karabiner besitzen, führen statt derselben ein kleines Bündel von Wurfspiessen (die Ierrids der Perser), mit denen sie sehr gut umgehen können, denn ich habe oft gesehen, dass sie eine derartige Waffe auf zehn Schritte Entfernung einem Büffel zwei Fuss tief in die Seite zu werfen im Stande sind. Zu Vervollständigung ihrer Angriffsrüstung gehört noch der Lasso, ein fünfzehn Fuss langer Lederriemen von der Dicke eines kleinen Fingers, der von dem Sattelknopfe herunterhängt. Dies ist eine schreckliche Waffe, gegen die man selbst mit einer Flinte nicht gut ankämpfen kann, denn der Lasso fliegt mit der Schnelligkeit des Gedankens, und ein Versuch, sich umzuwenden und Feuer zu geben, reicht zu, um das unvermeidliche Geschick herauszufordern. Das einzige Mittel, der verhängnissvollen Schlinge zu entgehen, besteht darin, dass man die Zügel des Pferdes über den Kopf erhebt und sowohl Lanze als Karabiner diagonal von den Körper hält, zugleich aber auch mit der Rechten das Messer fasst, um es augenblicklich benützen zu können.
Wenn unter solchen Vorsichtsmassregeln der Lasso einem über den Kopf fällt, muss er ausgleiten und der Wurf ist verloren; ist man aber behend genug, mit dem Messer die Schleife zu durchschneiden, während sie zurückgezogen wird, so gewinnt man den Vortheil oder steht doch wenigstens mit dem Gegner gleich, auf den man sich werfen kann, da er zu besserer Handhabung des Lasso Bogen, Lanze und Büchse zurückgelassen oder doch zu sehr befestigt hat, nm sie in kurzer Zeit gebrauchen zu können. Seine einzige Waffe besteht also in dem Messer und dem Tamahawk, und wenn man will, kann man jetzt seinen eigenen Lasso brauchen. In diesem Falle wendet sich die Stellung, obschon ein derartiger Kampf die grösste Gewandtheit fordert.
Es trifft sich oft, dass ein Indianer, wenn ihm sein Lasso durchschnitten ist und der Feind gegen ihn anrückt, in vollem Galopp Büchse und Lanze von dem Boden, wo er sie fallen liess, wieder aufnimmt, und dann ist natürlich der Sieg in seinen Händen. Es gelang mir einmal, einem derartigen Lasso-Ueberfalle zu entgehen. Ich wurde von einem Krähenindianer verfolgt, der seine Schlinge dreimal vergeblich nach mir schleuderte; bei dem vierten Wurfe zerschnitt ich sie, wandte mich gegen ihn um, jagte ihm nach und erschoss ihn mit einer von meinen Pistolen. Die Schlinge bildete bei jedem Wurfe einen vollkommenen Kreis, dessen Mittelpunkt genau über meinen Kopf fiel; der Durchmesser reichte von dem Halse bis zu dem Schweife meines Pferdes, und hätte ich nicht Büchse, Lanze, Bogen und Köcher weggeworfen, so wäre ich unvermeidlich auf den Boden gezogen worden. Alle westlichen Indianer und Mexikaner sind in Handhabung dieser Waffe ausserordentlich gut erfahren.
Vor der Ankunft des Fürsten Seravalle hatten die Shoshonen Schilde, legten dieselben aber bald als eine unnütze Belästigung ab. Die Geschicklichkeit, welche auf eine geeignete Handhabung dieser Schutzwaffe verschwendet wurde, hat jetzt einem besseren Gebrauche der Lanze Platz gemacht. Ich zweifle, ob in den Tagen der Turniere die tapferen Ritter ihren Damen eine grössere Gewandtheit zeigen konnten, als ein Shoshone im Kampfe gegen einen Arrapahoe oder eineu Krähen entwickelt.12)
Das bewunderungswürdigste Kunststück eines Shoshouen, eines Comanchen oder Apachen, besteht übrigens in der Leichtigkeit, womit er sich bei einem Angriff auf einen Feind längs seines Pferdes herunterhängt und so dem Gegner ganz unsichtbar macht; will ihm dann der Letztere eine Wunde beibringen, so muss es durch den Leib des Thieres geschehen. Trotz dieser schwierigen und gefährlichen Lage wissen sie übrigens doch ihre Waffen mit Gewandtheit und Sicherheit zu benützen. Die Art, wie sie ihr Gleichgewicht behaupten, ist sehr einfach; sie stecken ihren rechten Arm bis zur Schulter in die Schlingen des Lasso, der, wie gesagt, an dem Sattelknopf oder um den Hals des Pferdes hängt; ihre Füsse finden einen Haltpunkt in den zahlreichen Schleifen aus Hirschleder, die vom Sattel herunterfallen. In dieser Weise bleibt ihnen der linke Arm zu Handhabung des Bogens frei; den rechten können sie soweit benützen, um den Pfeil anzuziehen, und nun ersehen sie ihre Gelegenheit, ohne so leicht ihres Zieles zu verfehlen, wenn sie nicht bereits verwundet sind. Ich bemerkte bereits oben, dass die Shoshonen auf den Rath des Fürsten Seravalle ihre Schilde bei Seite legten; aber dieser, ihr väterlicher Freund, lehrte sie auch die europäische Reitertaktik. Sie hatten Verstand genug, die Vortheile einzusehen, die daraus zu erzielen waren, und verbanden dieselbe so gut, wie möglich, mit ihrer eigenen.
Die Shoshonen greifen nun schwadronenweise mit der Lanze an, bilden Carrées, wenden mit wunderbarer Genauigkeit und führen viele schwierige Manöver aus. Da sie jedoch ihrer eigenen Kriegsweise nicht entsagt haben, so bietet es einen höchst auffallenden Anblick, wenn man etwa fünfhundert Pferde mit tapferen Burschen im Sattel zum Kampfe anspringen und auf ein gegebenes Signal alle Reiter verschwinden sieht, während die Rosse in geschlossener Linie gleichsam aus eigenem Antrieb auf die feindlichen Krähen loszuspringen scheinen.
Ich habe vielleicht schon zu lange bei den Sitten und Gebräuchen dieses Volkes verweilt, kann mir es aber donnoch nicht versagen, meinen Lesern noch einen Beleg von den Kenntnissen zu geben, welche die höheren Klassen besitzen. Wie oben bemerkt, sind sie gute Astronomen, und ich kann ebensogut beifügen, dass sie aus der Anschauung merkwürdige geometrische Kenntnisse gewonnen haben. Ich fragte einmal einen jungen Häuptling, wie er die Höhe einer prächtigen Fichte anschlage. Es war Nachmittags gegen drei Uhr. Er begab sich nach dem Ende des von der Fichte geworfenen Schattens, steckte einen Pfeil in den Boden und mass dann sowohl die Länge desselben, als die Länge des von ihm geworfenen Schattens: ferner mass er den Schatten der Fichte, bildete aus dem Pfeile und den beiden Schatten eine Proportion und machte mir das Resultat namhaft. So handhabte er die Regel de Tri, ohne sie zu kennen.
Das merkwürdigste Beispiel trug sich jedoch zu, als wir einen breiten, reissenden Strom kreuzen wollten, bei welcher Gelegenheit es nöthig wurde, zum Anhaltspunkte für Ross und Reiter ein Seil hinüberzuwerfen. Es fragte sich nun, wie lang das Seil seyn müsse, das heisst, wie breit der Fluss sey. Ein alter Häuptling ritt vor, um die Aufgabe zu lösen, und that dies in folgender Weise. Er ging nach dem Ufer des Flusses und bezeichnet sich eine Stelle als Mittelpunkt; dann wählte er auf der andern Seite des Ufers rechts und links zwei Bäume, die dem Augenmass nach gleichweit von ihm abstanden. Als dies geschehen war, ritt er von dem Flusse zurück, bis er einen Punkt erreichte, der, wie ihm sein Gesicht sagte, mit den gedachten Bäumen ein gleichseitiges Dreieck bildete. Verzeichnen wir hier zur Erläuterung eine Figur:
Er hatte in dem vorstehenden Umrisse die Bäume A und B gewählt, war nach E zurückgegangen und hatte hier seine Lanze eingesteckt. Dann ritt er in der Richtnng ED zurück, bis die Strecke dem Augenmass nach AE gleich war, und befestigte in D wieder eine Lanze. Das gleiche Verfahren beobachtete er mit EC, und in C wurde die dritte Lanze eingesteckt. Da nun die Entfernung von F zu E gerade so gross seyn musste, als die von E zu G, so brauchte er nur den Raum zwischen dem Flussufer und E zu messen, und diese von EG abzuziehen, um die gewünschte Flussbreite zu erhalten.
Ich glaube nicht, dass diese Berechnung, die sich als vollkommen richtig erwies, länger als drei Minuten währte; auch darf man dabei nicht vergessen, dass das ganze Verfahren im Angesichte des Feindes stattfand. Kehren wir übrigens zu meiner Geschichte zurück.