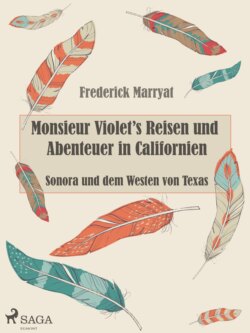Читать книгу Monsieur Violet's Reisen und Abenteuer in Californien, Sonora und dem Westen von Texas - Фредерик Марриет - Страница 14
Eilftes Kapitel.
ОглавлениеZu Anfang des Herbstes, einige Monate nach dem Tode meines Vaters, jagte ich mit meinen zwei Kameraden Gabriel und Roche in den Prairieen des Südens östlich von der Buona Ventura. Wir hatten eines Abends eine gute Jagd gehabt und waren sehr aufgeräumt. Meine beiden Freunde hatten ein Thema begonnen, über das sie sich nie erschöpfen konnten: der Eine sprach von den. Wundern und Sehenswürdigkeiten seiner Vaterstadt Paris, während der Andere mit der ihm angeborenen Beredtsamkeit die Schönheiten seiner Heimath schilderte und alte irische Legenden erzählte, welche mir ebenso seltsam als hochpoetisch vorkamen.
Da sahen wir uns plötzlich durch einen Haufen von sechszig Arrapahoes umzingelt. An Widerstand oder Flucht war natürlich nicht zu denken. Sie behandelten uns jedoch ehrenhaft und begnügten sich, uns scharf zu bewachen und unsere Flucht zu verhindern. Sie wussten, wer wir waren, und obgleich mein Pferd, mein Sattel und meine Büchse an sich schon eine schöne Beute für jeden Häuptling gewesen wäre, so wurde uns doch nichts abgenommen.
Ich kannte den Führer und redete ihn folgendermassen an:
„Was habe ich dem Morgenstern der Arraphoes gethan, dass ich gefangen und bewacht werde, wie ein Schaf der Wachinangoes?“
Der Häuptling lächelte und legte seine Hand auf meine Schulter.
„Die Arraphoes,“ entgegnete er, „lieben den jungen Owato Wanisha und seine blassgesichtigen Brüder, denn sie sind grosse Krieger und können ihre Feinde schlagen mit schönen blauen Feuern vom Himmel. Die Arrapahoes wissen Alles; sie sind ein weises Volk. Sie wollen Owato Wanisha in ihren eigenen Stamm nehmen, damit er ihnen seine Geschicklichkeit zeige und sie zu Kriegern mache. Er soll genährt werden mit den fettesten und süssesten Hunden. Er wird ein grosser Krieger seyn unter den Arrapahoes. So wollen es unsere Propheten. Ich gehorche dem Willen der Propheten und des Volkes.“
„Aber,“ antwortete ich, „mein Maniton wird mich nicht hören, wenn ich ein Sklave bin. Der Blassgesichts-Manitou hat nur Ohren für freie Krieger. Er wird mir sein Feuer nicht leihen, wenn nicht Zeit und Raum mein Eigenthum sind.“
Der Häuptling unterbrach mich:
„Owato Wanisha ist kein Sklave, kann nie ein Sklave seyn. Er ist bei seinen guten Freunden, welche über ihn wachen, sein Feuer anzünden, ihre schönsten Decken in seinem Zelte ausbreiten und es mit dem besten Wilde aus den Prairieen füllen werden. Seine Freunde lieben den jungen Häuptling, aber er muss ihnen nicht entfliehen wollen, sonst macht der böse Geist die jungen Arrapahoes trunken, wie einen viehischen Krähen, und regt sie auf, dass sie in ihrer Thorheit das Blassgesicht tödten.“
Da wir vorderhand nichts versuchen konnten, fügten wir uns in unser Schicksal und liessen uns auf einem langen, traurigen Wege bis an die östlichen Ufer des westlichen Rio Colorado führen, wo wir in einem der zahlreichen und schönen Arrapahoedörfer anlangten. Hier verbrachten wir den Winter in einer Art ehrenvoller Gefangenschaft. Ein Fluchtversuch würde das Signal zu unserem Tode oder doch zu strengerer Bewachung gegeben haben. Rings umher waren weite, sandige Wüsten, von den Clubs oder Piusen bewohnt, einem grausamen Volksstamme, unter dem sich sogar Kannibalen befinden. Ueberhaupt sind die meisten Stämme am Colorado Menschenfresser, und selbst die Arrapahoes machen hievon bei gewissen Gelegenheiten keine Ausnahme. Einmal trafen wir auf ein verlassenes Lager der Clubmänner und fanden daselbst die Ueberreste von ungefähr zwanzig Körpern, deren Knochen augenscheinlich mit so viel Hochgenuss abgenagt waren, als vielleicht ein Fasanenflügel von einem europäischen Epicuräer. Der Winter entschwand uns düster genug, was wohl Niemand wundern wird. Ausser einigen schönen Hainen, die man hie und da wie Oasen in der Sahara findet, ist der ganze Strich schrecklich uneben und unfruchtbar. Vierzig Meilen über dem Golf von Californien hört der Colorado auf, schiffbar zu seyn, und bietet siebenhundert Meilen weit, bis zu seinen Quellen hinauf, nichts als eine ununterbrochene Reihe rauschender Wasserfälle, die durch eine Kette von fünf oder sechshundert Fuss hohen, senkrechten Felsen begränzt sind, während es sonst den Anschein hat, als sey das ganze Land rings umher bis in den Mittelpunkt von heftigen vulkanischen Eruptionen erschüttert worden.
Endlich war der Winter vorüber, und mit den ersten Wochen des Frühlings erneuerte sich unsere Hoffnung auf Rettung. Die Arrapahoes liessen in ihrer Wachsamkeit nach und boten uns sogar an, wir sollten sie auf einem Ausfluge nach dem Osten begleiten. Wir gingen natürlich mit Freuden darauf ein und gelangten so in die schönen Prairieen von Nord-Sonora. Das Glück begünstigte uns. Die Arrapahoes verfolgten eines Tages eine Spur von Apaches und Mexikanern, um sie zu überraschen und zu tödten, fielen aber in eine Schlinge, so dass ihrer Viele zu Grunde gingen.
Wir trugen kein Bedenken, unsere bisherigen Herren zu verlassen, sondern spornten unsere rüstigen Rosse und fanden bald, dass unsere Befreier eine Abtheilung von Beamten waren, die von Monterey nach Santa Fé reisten und als Geleite zweiundzwanzig Apachen nebst zwölf oder fünfzehn Cibolerosfamilien mitgenommen hatten. Ich kannte die Beamten und freute mich sehr, Nachrichten von Californien zu erhalten. Isabella war noch so schön als je, aber nicht mehr so leichtherzig. Padre Marini, der Missionär, hatte sich nach Peru eingeschifft, und die ganze Stadt Monterey lachte, tanzte, sang und liebte noch immer, wie zu der Zeit, da ich sie verlassen hatte.
Die Beamten gestatteten bereitwillig, dass ich sie nach Santa Fé begleitete, von wo aus ich mit der nächsten Caravane leicht nach Monterey zurückkehren konnte.
Ein Wort über die Ciboleros dürfte nicht uninteressant seyn. Jedes Jahr begeben sich grosse Abtheilungen von Mexikanern, einige mit Maulthieren, andere mit Ochsenkarren, in die Prairieen, um ihre Familien mit Büffelfleisch zu versorgen. Sie betreiben ihre Jagd meistens zu Pferd; ihre Waffe besteht in dem Pfeil, in der Lanze oder bisweilen auch in einem Gewehre, während sie ihre Beute auf die Karren oder Maulesel laden. Sie finden es nicht schwer, ihr Fleisch auch mitten im Sommer zu erhalten, indem sie es in dünne Schnitten zerlegen, in der Sonne ausbreiten, oder in der Eile wohl auch das ganze Thier braten.
Während des Einpöckelns befolgen sie oft die indianische Gewohnheit, das Fleisch mit den Füssen zu treten; sie sagen, dies trage zur Erhaltung bei.
Hieraus gewinnen wir einen merkwürdigen Beleg für die ausserordentliche Reinheit der Atmosphäre in jenen Gegenden. Neben dem Wagen ist von einer Ecke bis zur andern eine Leine gezogen, an der die Fleischstücke hängen bleiben, bis sie eingepackt werden können. Dies geschieht ohne Salz, und doch geht das Fleisch nur selten in Fäulniss über.
Sehr interessant ist die optische Täuschung, welche die feine und durchscheinende Atmosphäre dieser Hochebene bietet. Man könnte fast glauben, man blicke durch ein Fernglas, denn die Gegenstände erscheinen oft kaum in dem vierten Theile ihrer wahren Entfernung — häufig aber auch viel grösser und namentlich weit höher. Ich habe oft Antilopenhaufen für Triebe von Elennthieren oder wilden Pferden gehalten, in grösserer Entfernung sogar für Reiter, was nicht selten zu einem blinden Lärm Anlass gab. Eine Büffelheerde auf einer fernen Ebene zeigt sich oft so, dass ein ungewohntes Auge sie für einen grossen Wald halten könnte.
Eine höchst wunderbare, mitunter aber auch sehr quälende Erscheinung ist die Mirage, oder, wie sie gewöhnlich von den mexikanischen Reisenden genannt wird, „das lügende Wasser.“ In den dürren Ebenen, wo ein Teich so gelegen käme, werden oft sogar die erfahrenen Prairiejäger durch derartige Phänome getäuscht. Der durstige Wanderer erblickt nach stundenlangem Placken unter einem sengenden Himmel endlich einen Weiher — ja, es muss Wasser seyn — es sieht zu natürlich aus, als dass hier eine Täuschung obwalten könnte. Er beschleunigt seine Schritte in der süssen Vorahnung eines erfrischenden Trunkes, aber wie er näher kömmt, weicht das Truggebilde zurück, oder verschwindet ganz; steht er dann endlich auf der muthmasslichen Stelle desselben, so möchte er seinen eigenen Augen misstrauen, wenn er nichts als trockenen Sand unter seinen Füssen findet. Erst nach vielen Täuschungen verzichtet er auf solche Wasserspuren und lässt vielleicht auch einen wirklichen Teich unbeachtet, weil er abermals genarrt zu werden fürchtet.
Die Theorie derartiger trügerischer Wassergebilde, so weit ich davon Kunde erhielt (!), hat mich nie befriedigt. Gewöhnlich schreibt man sie einer Refraktion zu, durch welche ein Abschnit des Himmelsgewölbes unter den Horizont geworfen wird; ich bin übrigens überzeugt, dass sie eine Wirkung der Reflektion sind. Ein Gas, das wahrscheinlich der erhitzten Erde und ihren vegetabilischen Stoffen entströmt, schwimmt über den Hochebenen und besitzt hinreichende Dichtigkeit, um, wenn es in schiefer Richtung betrachtet wird, die jenseitigen Gegenstände zu reflektiren; in dieser Weise gibt der gegenüberliegende Theil des Himmels der Gasmasse, in welcher er sich wiederspiegelt, das Aussehen des Wassers.
Einen Beweis für meine Behauptung gibt der Umstand, dass ich oft bemerkt habe, wie die fernen Erdhügel und Bäume, welche jenseits der Mirage, in der Nähe des Horizonts, lagen, in dem „Teiche“ deutlich umgekehrt erschienen. Wäre nun das Phänomen ein Resultat der Refraktion, so müssten sich diese Gegenstände auch unter der scheinbaren Oberfläche aufrecht zeigen.
Ueberhaupt bemerkt man auf diesen Ebenen viele sonderbare athmosphärische Naturspiele, die dem Forscher ein reiches Feld für interessante Untersuchungen geben würden.
Wir hatten eine sehr angenehme Reise, obgleich wir mitunter schwer vom Hunger heimgesucht wurden. Gabriel, Roche und ich waren jedoch zu glücklich, um darüber Klage zu führen.
Wir machten eben erst eine bittere und lange Sklaverei abgeschüttelt und waren ausserdem der magern, zähen Hunde herzlich satt, welche den Winter über die einzige Nahrung der Arrapahoes sind. Die Apachen, welche von unsern Thaten gehört hatten, zeigten uns grosse Achtung; indess verdankten wir doch ihre Geneigtheit vornemlich der Geschicklichkeit unsers Irländers auf der Violine. Ein mexikanischer Beamter, der im letzten Herbst von Monterey nach Santa Fé abberufen worden war, hatte nämlich ein derartiges Instrument am ersteren Orte zurückgelassen. Da es eine schöne, alt-italienische Geige war, die ohne Zweifel einen bedeutenden Werth besass, so hatte der Eigenthümer einen der Beamten gebeten, sie mitzubringen, und so befand sie sich nun bei dem übrigen Gepäcke auf einem Cibolero-Wagen. Wir bemerkten dies bald und trösteten uns, wenn wir nichts zu essen kriegen konnten, mit Musik. So müde wir auch waren, konnten wir doch in unsern Standquartieren noch stundenlang tanzen — „wenigstens die Blassgesichter“ — bis der arme Roche vor Erschöpfung kaum mehr seine Finger zu rühren vermochte.
Endlich wurden wir unseres erzwungenen Fastens enthoben und konnten nun mit Verachtung auf die bescheidenen Stachelbirnen niederblicken, die so manchen langen Tag unsere einzige Nahrung gewesen waren. Täglich kamen uns jetzt Heerden von fetten Büffeln in den Wurf, und wir verfolgten rüstig die stämmigen Prairieenherren. Einer davon stiess jedoch mein Pferd zu todt und würde ohne Gabriels sicher gezielte Kugel wahrscheinlich auch meinen Abenteuern ein Ende gemacht haben, denn thörichterweise hatte ich meine Büchse gegen Bogen und Pfeile vertauscht, um meine Geschicklichkeit zu zeigen. Diese Eitelkeit kam mich theuer zu stehen, denn obgleich der Bulle ein schönes Thier war, und sieben Pfeile in seinem Halse stecken hatte, verlor ich doch eines der besten Pferde des Westens, und auch mein rechtes Bein wurde bedeutend verletzt.
Da ich in Erfahrung brachte, wir träfen unmittelbar auf unserem Wege eine grosse Republik von Prairiehunden,14) so ging ich mit meinen beiden Begleitern voraus, um ihre Niederlassung zu besuchen. Wir hatten dabei einen doppelten Zweck im Auge, denn erstlich gedachten wir, einen dieser Freistaaten, von denen die Prairiereisenden so viel erzählt haben, in Augenschein zu nehmen, und zweitens wollten wir uns einen hübschen Braten holen, da das Fleisch dieser Thiere vortrefflich schmeckt.
Sechs oder sieben Meilen weit führte uns unser Weg an den Seiten eines sanftansteigenden Gebirges hin. Auf der Höhe angelangt, fanden wir ein schönes Tafelland ausgebreitet, das nach allen Richtungen hin meilenweit reichte. Der Boden schien ungemein reich zu seyn und war üppig mit Musquit-Bäumen bewachsen. Das krause Musquito-Gras gehörte zu der süssesten und nährendsten Art, und die Hunde, die einzig hievon leben, schlagen ihre Stätte nur an solchen Orten auf, wo es in Hülle vorhanden ist.
Nachdem wir diese schöne Prairie erreicht hatten, gelangten wir bald zu den Aussenposten des Hundestaates. Ein paar einzelne Thiere lungerten umher und brachten durch ihr kurzes, scharfes Kläffen ihre ganze Stammgenossenschaft in Aufruhr.
Das erste Gefahrsignal, von den Vorposten aus gegeben, reichte bald bis in den Mittelpunkt der Stadt, und nun sah man in allen Richtungen nichts als ein hurtiges Trappeln dieser quecksilbernen und aufregbaren Ortsbürger, indem jeder nach seiner Hütte oder seinem Loche eilte. So weit das Auge reichen konnte, breitete sich die Stadt aus, und in allen Richtungen war das Schauspiel das gleiche. Wir ritten gemächlich weiter, bis wir auf dem bevölkerteren Theile der Ansiedelung angelangt waren, wo wir Halt machten und uns, nachdem wir unseren Pferden zum Zwecke des Weidens die Zügel abgenommen hatten, zu einem regelmässigen Angriffe auf die Ortsbürgerschaft anschickten.
Die Löcher standen nicht mehr als fünfzehn Schritte von einander und hatten nach verschiedenen Richtungen wohlbetretene Pfade; ja, ich glaubte sogar, in Anlegung der Strassen eine gewisse Regelmässigkeit entdecken zu können.
Wir setzten uns auf einen Aufwurf unter dem Schatten eines Musquitbaums und betrachteten mit Musse das vor uns liegende Schauspiel. Unsere Ankunft hatte sämmtliche Thiere in unserer unmittelbaren Nachbarschaft nach ihrer Wohnung getrieben, aber einige hundert Ellen weiter sass auf dem kleinen Erdhügel vor einer Höhle ein Thier auf seinen Hinterbeinen und blickte ruhig umher, um sich von der Ursache des kürzlichen Getümmels zu überzeugen. Hie und da verliess ein einzelner Bürger, der wagehalsiger war, als sein Nachbar, seine Wohnung, um einen Kameraden zu besuchen; er mochte wohl mit demselben ein paar Worte zu sprechen haben, und trappelte dann wieder zurück, so schnell ihn seine Beine tragen konnten.
Da wir uns ganz still verhielten, so bemerkten wir endlich, dass einige unserer nähern Nachbarn ihre Köpfe vorsichtig aus ihren Löchern steckten und mit pfiffigem Spähen umherschauten. Endlich tauchte hin und wieder ein Hund aus seiner Wohnung auf, hockte auf seinen Lugaus, schüttelte den Kopf und begann zu kläffen.
Wir bewachten drei Stunden die Bewegungen dieser Thiere, und langten gelegentlich eines davon mit unsern Büchsen ab. Unsere Ausbeute betrug nicht weniger, als neun Stück. Ich muss hier eines im höchsten Grade sonderbaren Umstandes erwähnen, welcher Zeugniss ablegt von dem geselligen Tone dieser Thiere und von der Liebe, die sie zu einander hegen.
Eines davon hatte sich auf einen Erdhaufen vor seinem Loche gesetzt und bot uns ein schönes Ziel, während der Kopf eines Kameraden, der wahrscheinlich zu schüchtern war, um sich weiter auszusetzen, aus dem Eingange hervorguckte. Eine wohlgerichtete Kugel streifte dem ersten Hunde den ganzen obern Theil des Schädels ab und schmetterte ihn zwei oder drei Fuss von seinem Posten todt nieder. Während wir wieder luden, kam der andere keck heraus, ergriff seinen Kameraden bei einem Beine, und hatte ihn, ehe wir an dem Loche anlangten, vollkommen aus unserm Bereiche gezogen, obgleich wir’s versuchten, ihn mit den Ladstöcken herauszulangen.
Es lag Gefühl in dieser Handlungsweise, — so zu sagen etwas Menschliches, was die Thiere in meiner Achtung hob, und ich schoss später nie wieder einen Präriehund, wenn ich nicht durch äussersten Hunger dazu getrieben wurde.
Der Prairiehund ist von der Grösse eines Kaninchens, etwas schwerer und gedrungener vielleicht, hat aber viel kürzere Beine. Dem Aeussern nach hat er Aehnlichkeit mit dem Erdschweine des Nordens, obgleich er ein wenig kleiner ist, als das Letztere. Die Prairiehunde sind gesellig und leben nie allein, wie andere Thiere, sondern finden sich stets als ganze Dörfer oder grosse Ansiedelungen. Wenn man sie nicht stört, sind sie ein wildes, fröhliches, unruhiges Völklein, das stets auf dem Zuge ist. Sie scheinen ein besonderes Vergnügen daran zu haben, ihre Zeit zu verplaudern und von Loch zu Loch bei ihren Gevattern Besuche zu machen; wenigstens möchte man dies aus ihrem Treiben glauben. Alte Jäger sagen, wenn sie einen guten Ort für ein Dorf finden und kein Wasser zur Hand haben, so graben sie einen Brunnen, um die Bedürfnisse der Gemeinde zu befriedigen.
Bei mehreren Gelegenheiten kam ich ihren Dörfern, ohne bemerkt zu werden, so nahe, dass ich ihre Bewegungen heobachten konnte. In einer dieser Ansiedelungen sah ich im Mittelpunkte einen sehr grossen Hund, der vor seiner Thüre oder am Eingange seines Bau’s sass und, so viel ich aus seinem eigenen Treiben und dem seiner Nachbarn entnehmen konnte, der Präsident, Schuldheiss oder Häuptling zu seyn schien; jedenfalls war er der „grosse Hund“ des Platzes.
Ich bewachte wenigstens eine Stunde die Bewegungen dieser kleinen Gemeinde, während welcher Zeit der erwähnte grosse Hund wenigstens ein Dutzend Besuche von seinen Kameraden erhielt, welche eine Weile Halt machten, mit ihm plauderten und dann wieder nach ihrem Wohnsitze eilten. Diese ganze Zeit über wich er keinen Augenblick von seinem Posten, und es kam mir vor, als bekunde er in seinem Benehmen eine gewisse Würde, welche ich bei denjenigen, die sich mit ihm unterhielten, nicht entdecken konnte. Ich will nicht behaupten, dass diese Besuche Geschäftssachen betrafen oder etwas mit der Regierung des Dorfes gemein hatten, indess gewann es doch ganz einen derartigen Anschein. Wenn Thiere mit Schlussvermögen begabt sind, oder ihren gesellschaftlichen Verband durch systematische Gesetze zu regeln vermögen, so möchte man dies von den Prairiehunden behaupten.
In verschiedenen Theilen des Dorfes sah ich die Angehörigen hüpfen, scherzen, sich besuchen und hin und wieder Purzelbäume in ihre Löcher machen; mit Einem Worte, sie schienen alle Arten von Kurzweil zu treiben. Ich bemerkte auch eine besondere Art von Eulen unter ihnen, die sich jedoch den Spielen nicht anschlossen, obgleich sie mit den Hunden auf einem guten Fuss zu seyn schienen und in denselben Löchern aus- und eingingen, als wären sie Familienangehörige, oder doch wenigstens Gäste. Auch Klapperschlangen wohnen in diesen Dörfern, obgleich die unter den Mexikanern herrschende Ansicht, als ständen sie auf geselligem Fusse mit den Hunden, ganz lächerlich und grundlos ist.
Die Schlangen möchte ich als Landstreicher betrachten, die sich nicht so leicht von den regelmässigen Einwohnern abschütteln lassen und die Wohnungen der Hunde benützen, weil sie anderswo keine gemächlichere Quartiere finden können. Wir erlegten eine derartige Bestie in der Nähe eines Baues; sie hatte ein frischgeworfenes Hündlein im Leibe, obschon ich nicht glaube, dass sie über ausgewachsene Thiere Herr zu werden im Stande ist.
Die von uns besuchte Stadt war mehrere Meilen lang und wenigstens eine Meile breit. Rund umher und in der Nachbarschaft befanden sich kleine Dörfer, gleichsam als Vorstädte. Wir zündeten ein Feuer an und kochten drei der erlegten Thiere. Das Fleisch war ungemein süss, zart und saftig, ungefähr wie das des Eichhörnchens, aber fetter.