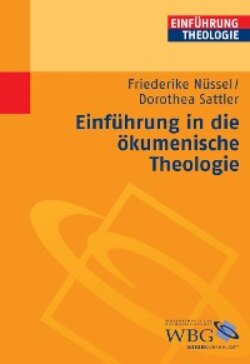Читать книгу Einführung in die ökumenische Theologie - Friederike Nüssel - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Die Geschichte der Ökumene im Spiegel der Begriffsgeschichte
Оглавлениеhellenistisch-römische Bedeutung
Mit dem Begriff ,Ökumene‘ wird in kirchlichen und wissenschaftlich-theologischen Kontexten in erster Linie das Streben nach Überwindung der Trennungen zwischen den verschiedenen christlichen Kirchen und Konfessionen assoziiert. Außerhalb des kirchlichen Lebens, des Religionsunterrichts und der theologischen Lehre und Forschung ist der Begriff dagegen vielfach unbekannt. Das war nicht immer so. Der Begriff ,Ökumene‘ hat im Verlauf der Christentumsgeschichte eine Reihe von Bedeutungsverschiebungen erlebt, in denen sich grundlegende Entwicklungen des Christentums selbst spiegeln. Zur Entstehungszeit des Christentums gehört das griechische Wort ,oikumene‘ (abgeleitet von griech.: oikeo – wohnen bzw. griech.: oikia – Haus; siehe zum Sprachgebrauch Michel/23: 159 – 161) zum gängigen profanen Sprachgebrauch und bezeichnet die bewohnte Erde oder auch die ganze Welt. Diese profangriechische Bedeutung liegt auch der Verwendung in der Septuaginta und im Neuen Testament zugrunde (vgl. z. B. Mt 24,14, wo es heißt, der ganzen bewohnten Erde solle das Evangelium verkündigt werden). Vielfach schwingt dabei die hellenistisch-römische Zuspitzung mit. Denn unter dem Eindruck der Eroberungen Alexanders des Großen wird im Hellenismus die ,oikumene‘ mit der griechischen Welt identifiziert und von der Welt der Barbaren unterschieden. Diese Differenzierung spiegelt sich in der Apostelgeschichte (Apg 17,6; 19,27; 24,5), aber auch in Röm 10,18 und Hebr 1,6. Die Ausbreitung des römischen Imperiums auf griechischsprachige Gebiete wiederum führt dazu, dass ,oikumene‘ schließlich mit dem römischen Imperium gleichgesetzt wird. Diese Bedeutung findet man bei Lukas, insbesondere zu Beginn der Weihnachtsgeschichte in Lk 2,1.
Kirche als die neue Ökumene
Da mit der Verkündigung Jesu vom Reiche Gottes im Christentum eine spezifisch christliche Weltdeutung verbunden ist, weitet sich im christlichen Sprachgebrauch zugleich das Bedeutungsspektrum von ,oikumene‘. In Lk 4,5 und Apk 12,9 heißt es, die Reiche dieser oikumene seien der Macht des Teufels anheim gefallen. Dieser bösen und vergänglichen Welt gilt nach Lk 17,26; Apg 17,31; Apk 3,10; 16,14 das Gericht. Neben dieser negativen Konnotation des Begriffs ,oikumene‘ kennt der Hebräerbrief auch eine positive christliche Deutung, in der die christliche Hoffnung durch die Vorstellung einer ,oikumene mellusa‘, einer zukünftigen Welt Gottes (Hebr 2,5) interpretiert wird. Durch den Rückgang der apokalyptisch-endzeitlichen Naherwartung im 2. Jahrhundert n. Chr. kann diese eschatologische Rede von der ,oikumene‘ im christlichen Sprachgebrauch jedoch nicht bestimmend werden. Stattdessen rückt die Erfahrung der Ausbreitung des Christentums in der heidnischen Umwelt in den Vordergrund. Sie wird zunächst als Verbreitung der Kirche Gottes über die ganze Ökumene beschrieben. Gegenüber dieser Differenzierung zwischen Kirche und Ökumene erscheint bei Origenes und Basilius die Kirche als die neue ,oikumene‘, die durch das Evangelium geheiligt ist. Dieser Linie folgend etabliert sich im christlichen Sprachgebrauch des 3. und 4. Jahrhunderts für ,oikumene‘ die Bedeutung der über den ganzen Erdkreis verbreiteten Kirche.
konstantinische Wende
Mit der Anerkennung des Christentums als Staatsreligion unter Kaiser Konstantin können die Rede von der Kirche als der neuen Ökumene und die ältere griechisch-römische Bedeutung zusammengeführt werden. ,Ökumene‘ bezeichnet im offiziellen kirchlichen Sprachgebrauch nunmehr das christliche Imperium. Damit verbunden wird die Einheit der Kirche zu einem zentralen Anliegen des Römischen Reiches. Zur Beilegung von Lehrstreitigkeiten im Christentum werden nunmehr ökumenische, d. h. für die gesamte Ökumene des Reiches verbindliche Konzilien einberufen. Mit den Lehrentscheiden der ökumenischen Konzilien können dabei auch die der offiziellen kirchlichen Lehre verpflichteten Theologen als Lehrer der Ökumene bezeichnet werden. In diesem Sinne wird im 6. Jahrhundert dem Patriarchen von Konstantinopel der Titel „ökumenischer Patriarch“ zuerkannt. Nach dem Tod Gregor des Großen, der sich noch gegen entsprechende Titel wehrt, werden die Päpste als ökumenische Bischöfe bezeichnet.
ökumenische Konzilien
Auf den ersten beiden ökumenischen Konzilien in Nizäa 325 und in Konstantinopel 381 werden ausgehend von der Frage nach dem angemessenen Verständnis der Gottheit Jesu Christi zunächst trinitätstheologische Grundaussagen getroffen und im Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel festgehalten. Damit gewinnt das Bekenntnis die Funktion, die Zugehörigkeit zur christlichen Reichskirche zum Ausdruck zu bringen. Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel von 381 gilt bis heute den meisten Kirchen als das ökumenische Bekenntnis. Es ist trinitarisch gestaltet und bekennt die Wesensgleichheit des Sohnes und des Geistes mit dem Vater und damit die volle Gottheit von Sohn und Geist. Im Gefolge der ersten beiden ökumenischen Konzilien kommt es jedoch zu neuen Auseinandersetzungen zwischen alexandrinischer und antiochenischer Tradition über die Frage, wie angesichts der vollen Gottheit des Sohnes das wahre Menschsein Jesu Christi adäquat auszusagen sei. Diese Fragen werden auf dem dritten und vierten ökumenischen Konzil ausgetragen. Das dritte ökumenische Konzil von Ephesus 431 lehnt die adoptianistische Vorstellung des Nestorius ab und lehrt auf der Linie alexandrinischer Christologie gegen Nestorius, dass Maria als Theotokos (Gottesgebärerin) zu gelten habe. Das vierte ökumenische Konzil von Chalcedon 451 sucht weitere Streitigkeiten über die Frage nach dem Verhältnis von Gottheit und Menschheit Jesu Christi zu schlichten. Es gelangt zu einem Bekenntnis, das einerseits doketische Vorstellungen abwehrt und mit der wahren Gottheit Jesu Christi auch seine wahre Menschheit betont, andererseits die Einheit der Person Jesu Christi herausstellt.
Kirchenspaltung im Osten
Während die ersten beiden ökumenischen Konzilien in der gesamten Christenheit anerkannt werden, stoßen die dogmatischen Entscheidungen von Ephesus und insbesondere von Chalcedon auf Widerstand bei einer Reihe von Kirchen am östlichen Rande des byzantinischen Reichs bzw. außerhalb desselben. Es kommt zur ersten großen Kirchenspaltung in der Geschichte des Christentums. In der Folgezeit formieren sich die sog. orientalisch orthodoxen Kirchen ostsyrischer und westsyrischer Liturgietradition. Zu den Kirchen der ostsyrischen Tradition gehören die Heilige Apostolische und Katholische Assyrische Kirche des Ostens und einige indische Kirchen. Zur Familie der Kirchen mit westsyrischer Liturgie gehören die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien (,Jakobiten‘), die Malankarische Orthodoxe Syrische Kirche, die Koptische Orthodoxe Kirche, die Äthiopische Orthodoxe Tewahedo Kirche und die Armenische Apostolische Kirche. Mit der Abspaltung der orientalischen Kirchen ist der ökumenische Anspruch der Reichskonzilien erstmals strittig geworden.
Spaltung zwischen West und Ost
Doch nicht nur am Rande des Reichs, sondern auch innerhalb der Reichskirche führen die christologischen Lehrentscheidungen zu neuen Auseinandersetzungen über das Verständnis der beiden Naturen Christi, die auf dem fünften und sechsten ökumenischen Konzil in Konstantinopel 553 und 680 ausgetragen werden. Ein weiteres ökumenisches Konzil in Nizäa 787 wendet sich den Konsequenzen dieser Lehrentscheidungen für die Frage der Bilderverehrung zu und erlaubt diese ausdrücklich. Im Laufe der Jahrhunderte wird dabei die schon in den ersten Jahrhunderten aufbrechende Distanz zwischen Rom und Konstantinopel, in deren Hintergrund kulturelle Unterschiede stehen, durch den Ausbau des römischen Primatsanspruchs und durch einzelne Schismen vertieft (Acacianisches Schisma 484 – 519, Photianisches Schisma 867 – 879). Theologisch bietet vor allem die im Westen vorgenommene Einfügung des ,filioque‘ in den Text des Glaubensbekenntnisses von Nizäa-Konstantinopel massiven kontroverstheologischen Konfliktstoff. Die über Jahrhunderte angestauten kirchenpolitischen und theologischen Spannungen bilden die Voraussetzung dafür, dass die wechselseitige Exkommunikation zwischen Patriarch Michael Kerullarios und Kardinal Humbert im Jahre 1054 sich zum Schisma zwischen Ost- und Westkirche ausweitet und durch die Ereignisse im vierten Kreuzzug zementiert wird. In der Folgezeit wird vor allem von Rom aus eine Reihe von Unionsbemühungen unternommen, insbesondere auf dem Konzil von Lyon 1274 und auf dem Konzil von Florenz 1439. Mit dem Scheitern dieser Versuche richten Rom und Konstantinopel ihre Einigungsbemühungen vermehrt auf die orientalisch orthodoxen Kirchen. Rom gelingt eine Reihe von Kirchenunionen, wobei aber die Bildung dieser Unionen meistens mit Spaltungen der jeweiligen Kirche vor Ort verbunden ist.
verbindliche Lehre?
Mit der Kirchenspaltung zwischen Ost und West und dem Zusammenbruch des byzantinischen Reichs verliert der Begriff ,Ökumene‘ zwangsläufig seine reichskirchliche Dimension. Bestimmend bleibt nunmehr allein das Verständnis der ,oikumene‘ als der katholischen Kirche Gottes für alle Menschen. Doch wer zu dieser Kirche gehört, das ist nicht mehr nur zwischen Reichskirche und orientalischen Kirchen, sondern zwischen der lateinischen Kirche des Westens und den Ostkirchen strittig. Als konstitutiv für die Zugehörigkeit zur Ökumene als der Kirche Gottes gilt dabei jeweils die Übereinstimmung mit den Bekenntnissen der ökumenischen Konzilien. Doch welche Konzilien als ökumenisch gelten können, ist strittig. Während die orthodoxen Kirchen nur die ersten sieben ökumenischen Konzilien als ökumenisch anerkennen, zählt die Römisch-Katholische Kirche bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 21 ökumenische Konzilien.
Kirchenspaltung im Westen
An der Zahl der ökumenischen Konzilien, die in der römischen Kirche im Mittelalter abgehalten werden, lässt sich ersehen, dass im Westen – weit mehr als im Osten – immer neue Kontroversen über Fragen der kirchlichen Lehre und Praxis sowie der Autorität innerhalb der Kirche und im Verhältnis zum Staat aufbrechen, die einer verbindlichen Klärung bedürfen. Die größte ökumenische Herausforderung entsteht der lateinischen Christenheit mit der reformatorischen Kritik Martin Luthers, die am Buß- und Ablasswesen anhebt, dann aber auch eine große Anzahl weiterer römischer Lehren betrifft. Sie ist fundiert in Luthers theologischer Grundeinsicht, dass im Evangelium Gottes die Rechtfertigung allein aus Glauben ohne alle Werke verheißen ist. Die öffentliche Auseinandersetzung Luthers mit der römischen Kirche begann mit der Eröffnung des Inquisitionsverfahrens 1518. Nach der Bannandrohungsbulle von 1520 folgte mit der Bannbulle 1521 die Exkommunikation Luthers. Nachdem auf dem Wormser Reichstag auch die Reichsacht über ihn verhängt wurde, war Luther auf den Schutz seines Landesherren Kurfürst Friedrich des Weisen angewiesen. Die kirchlichen und reichsrechtlichen Maßnahmen konnten nicht verhindern, dass sich in vielen Territorien des Reichs Anhänger der Reformation sammelten. Das Zentrum der lutherischen Reformation wurde Wittenberg. Weitere Zentren bildeten sich in der Schweiz um Huldreych Zwingli in Zürich und um Johannes Calvin in Genf.
Augsburger Religionsfriede
Der Versuch der reformatorischen Fürsten, auf dem Augsburger Reichstag 1530 mit der ,Confessio Augustana‘ eine Anerkennung und Duldung der Reformen zu erwirken und damit eine Kirchenspaltung zwischen Anhängern der Reformation und Anhängern der Papstkirche zu verhindern, scheiterte. Die Kirchenspaltung wurde schließlich mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 für die Anhänger der CA durch das Prinzip „cuius regio eius religio“ reichsrechtlich umgesetzt, nachdem sowohl eine Reihe von Religionsgesprächen als auch die Rekatholisierungsversuche Karls V. gescheitert waren. Bereits ab 1529 führten Differenzen in der Abendmahlsfrage überdies zur separaten Entwicklung der lutherischen Reformation, die weite Teile Skandinaviens und des Baltikums erreichte, und der von Zwingli und Calvin geprägten reformierten Gestalt der Reformation, die in der Schweiz, in Frankreich, in Schottland und in manchen deutschen Gebieten Fuß fasste. In England realisierte sich die Reformation in der Bildung der Anglikanischen Nationalkirche. Damit war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an die Stelle der durch die römische Kirche bestimmten westlichen Kircheneinheit eine Vielzahl von Kirchentümern getreten, die in der Folgezeit mit der Gründung zahlreicher Freikirchen weitere Abspaltungen erlebten.
konfessionelles Zeitalter
Die Frage, was für die Christenheit allgemein verbindlich bzw. ökumenisch ist, findet in den westlichen Kirchentümern nunmehr eine Reihe von unterschiedlichen Antworten. Im lutherischen Konkordienbuch von 1580 werden das apostolische, das nizänische und das athanasianische Glaubensbekenntnis als die „tria symbola catholica sive oecumenica“ (BSLK, S. 19) bezeichnet. Darüber hinaus gelten in den meisten aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen die Konzilien der ersten fünf Jahrhunderte als ökumenisch. Zwar kann im Rekurs auf die reformatorische Tradition auch die Einheit der Kirche im Sinne der vom Heiligen Geist auf Erden erleuchteten und versammelten Christenheit als ,Ökumene‘ bezeichnet werden. Doch bestimmend ist im sog. konfessionellen Zeitalter nicht die Sicht auf die Christenheit als ganze. Im Vordergrund steht vielmehr die Wahrung der Konfessionsgrenzen.
Erweckungs- und Missionsbewegungen
Demgegenüber entwickelt sich Ende des 17. Jahrhunderts im Pietismus ein neues Verständnis von ,Ökumene‘. Denn das Interesse des Pietismus gilt der Verbreitung lebendiger christlicher Frömmigkeit über die nationalen und konfessionellen Grenzen hinweg. Diese erscheinen nicht mehr als Barrieren zwischen Heil und Unheil. Vielmehr kann z. B. der Begründer der Herrnhuter Brüdergemeine Graf Zinzendorf die verschiedenen Konfessionen als Erziehungsformen Gottes zur Wiedergeburt und Herzensfrömmigkeit verstehen. Diese überkonfessionelle Ausrichtung auf die Gemeinschaft aller bekehrten Christen gewinnt in der Erweckungsbewegung und in der Missionsbewegung im 19. Jahrhundert breite Wirkung und schlägt sich auch im Ökumeneverständnis nieder. Zuerst setzt sich die 1795 gegründete London Missionary Society dafür ein, dass das Evangelium nicht in konfessioneller Form verkündet werden solle, und erhebt Ökumenizität zu ihrem Prinzip. 1846 wird in London die Evangelische Allianz gegründet, die sich als ein ökumenischer Zusammenschluss der wahren Gläubigen über alle konfessionellen und nationalen Grenzen hinweg versteht. Wichtig für die Verbreitung dieses überkonfessionellen Verständnisses von Ökumene werden sodann der 1855 gegründete Christliche Verein Junger Männer (CVJM bzw. YMCA), der 1893 gegründete Weltbund der weiblichen Jugend (WMCA) und der 1895 gegründete Christliche Studentenweltbund. Hier wird jeweils eine über Konfessionsgrenzen, nationale Grenzen und Klassengrenzen hinausreichende Gesinnung als „ökumenisch“ bezeichnet und propagiert. Dieser Sprachgebrauch bestimmt auch die internationale Missionskonferenz im Jahre 1900 in New York, die sich ökumenisch nennt, weil sich ihr Plan auf das gesamte Gebiet des bewohnten Erdballs richtet. Mit diesem Sprachgebrauch ist die globale Weite des ursprünglichen profangriechischen Verständnisses von ,oikumene‘ wieder im Blick.
ökumenischer Aufbruch
Aus der Missionsbewegung und ihren Konferenzen erwächst zugleich eine entscheidende Initiative für den ökumenischen Aufbruch im 20. Jahrhundert. Denn in den Missionen im 19. Jahrhundert machen die Kirchen die Erfahrung, dass die konfessionellen Spaltungen und deren Reproduktion an den Missionsorten ihren missionarischen Auftrag erheblich behindern. So entwickelt sich das Bestreben, die Abgrenzung und Konkurrenz der Kirchen zugunsten eines gemeinschaftlichen Miteinanders zu überwinden. Mit dem Interesse an überkonfessionellem Einsatz für die Mission verbindet sich somit die Aufgabe, nach der Gemeinschaft der getrennten Kirchen zu streben. In diesem Sinne verwendet der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom erstmals den Begriff ,Ökumene‘, um das Werk der Versöhnung und Einigung bisher getrennter Kirchen zu bezeichnen. Söderblom ist einer der bedeutendsten Wegbereiter der Ökumene in diesem Sinne und wird nicht zu Unrecht zuweilen auch als Kirchenvater der modernen ökumenischen Bewegung bezeichnet (vgl. dazu Möller/24: 14).