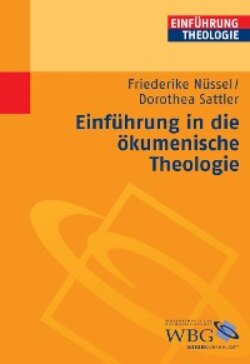Читать книгу Einführung in die ökumenische Theologie - Friederike Nüssel - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
a) Geschichte der ökumenischen Theologie
ОглавлениеKontroverstheologie
Im theologischen Fächerkanon ist der Aufgabenbereich ,Ökumenische Theologie‘ sowohl in der evangelischen wie in der katholischen Theologie an die Stelle der älteren Disziplinen der ,Kontroverstheologie‘ bzw. der ,Polemik‘ getreten. Die Disziplin der Kontroverstheologie bzw. Polemik wiederum ist im Gefolge der Reformation entstanden, weil durch die Glaubensspaltung in der theologischen Ausbildung die Notwendigkeit gegeben war, die konfessionellen Lehrdifferenzen zu bestimmen und zu begründen. Wegweisend waren auf katholischer Seite zunächst die theologischen Loci von Melchior Cano von 1563 und die kontroverstheologisch ausgerichteten Lehren des Trienter Konzils. Sodann spielte eine besondere Rolle der Jesuitenorden mit seinem Collegium Romanum, an dem eine Professur unter dem Titel ,De controversiis‘ eigens der Kontroverstheologie gewidmet war. Ihr berühmtester Inhaber Robert Bellarmin (1567 – 1587) prägte die katholische Kontroverstheologie nachhaltig mit seinem dreibändigen Hauptwerk „Disputationes de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos“ (Ingolstadt 1586 – 93). Nach der jesuitischen Studienordnung war die Kontroverstheologie allerdings nicht für alle Studierenden bestimmt, sondern nur für die, die eine Tätigkeit in gemischtkonfessionellen Gebieten aufnehmen sollten. Bedeutende Vertreter evangelischer Kontroverstheologie waren Martin Chemnitz mit seinem „Examen Concilii Tridentini“ (1566 – 1573), Johann Gerhard mit seinen „Loci theologici“ (1610 – 1621) sowie Abraham Calov (1612 – 1686). Allerdings etablierte sich in der evangelischen Theologie bald die Bezeichnung ,Polemik‘ für die kontroverstheologische Aufgabe, wobei mit diesem Terminus analog zu den anderen Disziplinenbezeichnungen die spezifische Vorgehensweise in diesem Aufgabenfeld der Theologie markiert wurde.
Pietismus und Aufklärung
Im Zuge von Pietismus und Aufklärung trat das Interesse an der Verteidigung der konfessionellen Differenzen in den Hintergrund. Im Pietismus entwickelte sich ein überkonfessionelles Bemühen um eine lebendige christliche Frömmigkeit und deren Verbreitung. Daneben stellte die rationale Kritik der Aufklärungsphilosophen die christlichen Konfessionen vor die Aufgabe, die Wahrheit der christlichen Religion zu verteidigen. So stand nicht mehr die Begründung der konfessionellen Lehrunterschiede, sondern die Frage nach Wesen und Wahrheit des Christentums im Zentrum theologischer Argumentation. Das hatte Konsequenzen für Kontroverstheologie und Polemik. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wandelte sich ihre Streitbarkeit in einen irenischen, vergleichenden Umgang mit den konfessionellen Differenzen.
Friedrich Schleiermacher
So fasste im frühen 19. Jahrhundert Friedrich Schleiermacher in seiner „Kurze(n) Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen“ (1811) die Polemik zusammen mit der Apologetik als Teil der philosophischen Theologie, die das eigentümliche Wesen des Christentums zu bestimmen sucht. Während es nach Schleiermacher in der Apologetik um die Eigenart des Christentums im Unterschied zu anderen frommen Gemeinschaften bzw. Kirchen geht, zielt die Polemik nach innen auf die Bestimmung von Fremdartigem im Christentum in Gestalt von Ketzerei und Spaltungen (vgl. Schleiermacher/40: 160 – 163). Um den konfessionellen Gegensatz geht es in der Polemik dabei nur noch indirekt, indem die polemische Aufgabe in den getrennten Kirchen faktisch auf je eigene Weise vorgenommen werden kann (vgl. Schleiermacher/40: 163).
katholische Restauration und Kulturprotestantismus
Auf katholischer Seite sorgte vor allem Johann Adam Möhler für eine neue Qualität der herkömmlichen Kontroverstheologie, indem er in seiner zuerst 1832 erschienenen „Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten“ die Lehrunterschiede nach den jeweiligen öffentlichen Bekenntnisschriften vergleichend darstellte. Auf die Kritik an dieser Darstellung durch den evangelischen Theologen Ferdinand Christian Baur reagierte Möhler 1834 mit „Neue(n) Untersuchungen der Lehrgegensätze zwischen den Katholiken und Protestanten“. Diesem Werk wiederum stellte Karl August von Hase 1862 ein „Handbuch der protestantischen Polemik gegen die Römisch-Katholische Kirche“ entgegen, das ebenfalls viele Auflagen erfuhr. In der Folgezeit verschärften sich die Gegensätze zwischen Katholizismus und Protestantismus einerseits durch die innerkatholische Restauration, die im Ersten Vatikanischen Konzil gipfelte, zum anderen durch den Kulturprotestantismus.
theologischer Aufbruch nach dem Ersten Weltkrieg
Die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges führten in der evangelischen Theologie zu einer grundlegenden Neuorientierung. Zum einen entstand die sog. Dialektische Theologie, deren wichtigste Vertreter Karl Barth, Emil Brunner, Friedrich Gogarten und Rudolf Bultmann waren (vgl. Neuner/36, Bd. 2: 70 – 89; 124 – 144). Zum anderen suchte eine Reihe von Theologen wie vor allem Karl Holl, Werner Elert, Paul Althaus und Emanuel Hirsch in einer modernen Aufnahme lutherischen Denkens einen neuen Aufbruch in der Theologie. Beiden Richtungen gemeinsam war die scharfe Kritik an der liberalen Theologie und der kulturprotestantischen Sicht des Christentums. An der Profilierung protestantischer Theologie in Abhebung vom Katholizismus, die das 19. Jahrhundert bestimmt hatte, wurde dabei jedoch festgehalten.
Ökumenischer Arbeitskreis
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich unter dem Einfluss der ökumenischen Bewegung in den verschiedenen Feldern theologischer Forschung ein breites Bestreben, die herkömmlichen Lehrdifferenzen kritisch zu hinterfragen. Prägende Bedeutung für die katholische und die evangelische Theologie gewann dabei der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen (ÖAK). Wie schwierig die ökumenische Lage vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war, kann man daran ersehen, dass die Bildung eines gemeinsamen ökumenischen Kreises aus evangelischen und katholischen Theologen zunächst nicht möglich war, weil von römisch-katholischer Seite keine ökumenischen Arbeitsbeziehungen aufgenommen werden durften. Daher formierten sich zunächst zwei Kreise, eine ökumenische Arbeitsgemeinschaft evangelischer Theologen (geleitet von Bischof Stählin und Edmund Schlink) und eine vom Erzbischof von Paderborn gebildete ökumenische Arbeitsgemeinschaft katholischer Theologen. Beide Kreise hielten regelmäßig Treffen am gleichen Ort ab, bevor die Kirchen der Gründung eines gemeinsamen Kreises zustimmten (vgl. Schwahn/41: 17 – 24, bes. 21).
Rechtfertigungslehre
Wichtige Anstöße für die Entwicklung ökumenischer Theologie erwuchsen außerdem aus der Auseinandersetzung katholischer Theologen mit Karl Barth. Bahn brechend war hier einerseits die Arbeit über Karl Barths Theologie von Hans Urs von Balthasar, andererseits das Buch über Barths Rechtfertigungslehre von Hans Küng. Küng formulierte dabei bereits 1957, „daß in der Rechtfertigungslehre, aufs Ganze gesehen, eine grundsätzliche Übereinstimmung besteht zwischen der Lehre Karl Barths und der Lehre der Katholischen Kirche“ (Küng/33: 269, vgl. auch 274). Dass auch schon die hochscholastische Gestalt der Gnadenlehre und die reformatorische Rechtfertigungslehre keinen unüberbrückbaren Gegensatz darstellen, zeigte 1967 Otto Hermann Pesch in seiner vergleichenden Darstellung der Rechtfertigungslehre von Thomas von Aquin und Martin Luther (vgl. Pesch/39).
Ökumenische Aufgaben seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil
Durch das Zweite Vatikanische Konzil gewannen die ökumenisch-theologischen Ansätze zur Überwindung der Lehrdifferenzen erhebliche Schubkraft (vgl. I. 3. c, Unterpunkt 3). Welche Lehrunterschiede zwischen den Kirchen wirklich kirchentrennende Bedeutung haben, wie diese Lehrunterschiede genau zu verstehen und möglicherweise zu überwinden sind – diese Fragen gehören seither zum zentralen Thema ökumenischer Theologie. Darüber hinaus widmet sich ökumenisch-theologische Forschung aber auch den Aufgaben, die von Anfang an die ökumenische Bewegung bestimmt haben, also den Aufgaben auf dem Feld der Mission, den friedensethischen, sozial- und individualethischen Aufgaben, den Problemen der Diskriminierung und Verfolgung sowie den Fragen der Bildung und Erziehung.
ökumenische Theologie an den Universitäten
Angesichts des wachsenden ökumenisch-theologischen Forschungsbedarfs sind in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an verschiedenen katholisch-theologischen und evangelisch-theologischen Fakultäten Institute für Ökumenische Theologie (Heidelberg, München, Münster, Tübingen) eingerichtet worden. In solchen Kontexten entstanden theologische Entwürfe, in denen das ökumenische Anliegen integraler Bestandteil ist, wie die Systematische Theologie Wolfhart Pannenbergs.