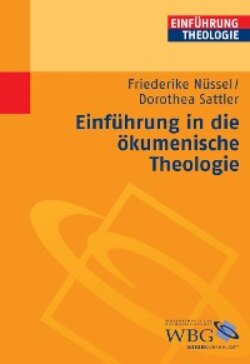Читать книгу Einführung in die ökumenische Theologie - Friederike Nüssel - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
d) Rekonfiguration der ökumenischen Bemühungen heute
Оглавлениеgegenwärtige Herausforderungen
Es ist offenkundig: Die weltweit vielfältigen ökumenischen Bemühungen bedürfen einer neuen Anstrengung zur Koordination. Nach fruchtbaren Jahrzehnten der Annäherung im 20. Jahrhundert – getragen vorrangig von den Kirchen reformatorischer Tradition – steht die Ökumenische Bewegung vor neuen Herausforderungen. Nicht zuletzt die schwindende Finanzkraft der christlichen Kirchen in Europa nötigt, oder besser ermutigt zu weitreichenden Reformen. Bei der Sichtung der bestehenden ökumenischen Initiativen sind mehrere Kriterien der Differenzierung möglich: Nationale Gremien unterscheiden sich von internationalen, bilaterale Gespräche von multilateralen, historisch-theologische Erkenntniswege von diakonisch motivierten Projekten. An jedem Lebensort hat die Ökumene eine andere Gestalt, die maßgeblich auch durch die leitend handelnden Personen mitbestimmt wird.
Ein klares Profil scheint die Ökumenische Bewegung in Deutschland nur gewinnen zu können, wenn die Komplexität der weltweiten Ökumene an den Lebensorten der Gläubigen in Deutschland stärker bewusst wird. Sich in einer weltweiten christlich-ökumenischen Gemeinschaft zu wissen ist eine Aufgabe, auf die viele Christen in Deutschland noch nicht vorbereitet sind.
Angesichts der gegenwärtigen Kommunikationsmittel besteht die Möglichkeit, sich von jedem beliebigen Ort der Welt aus über andere Regionen zu informieren und auch Anteil zu nehmen an den Freuden und Leiden der Menschen andernorts. Doch wer handelt so? Die Welt könnte ein Dorf sein, in dem jede von jedem weiß. In der Wirklichkeit erscheinen unter Christinnen und Christen weltweit die Kenntnisse über spezifische Lebensbedingungen andernorts recht gering. Woran mag das liegen? Es wird vielfältige Antwortversuche auf diese Frage geben.
Der Prozess der Rekonfiguration (vgl. Rekonfiguration/25), den der aus dem Amt scheidende Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Konrad Raiser, im Jahr 2003 angeregt hat, lädt zu einer Neubesinnung auf die Rahmenbedingungen der Ökumenischen Bewegung ein. Diese Reflexion intendiert eine arbeitsteilige Entlastung durch stärkere Koordinierung besonders auf internationaler und auch bereits schon auf nationaler Ebene. Den vielen nationalen Räten von Christinnen und Christen soll dabei mehr Bedeutung geschenkt werden. Es erscheint zunehmend nicht mehr möglich, die vielfältigen ökumenischen Initiativen weltweit in einen organisatorischen Zusammenhang zu bringen. Eine Regionalisierung der Ökumenischen Bewegung steht an. Auf dieser Basis kann nach neuen Formen der konfessionellen Kooperation gesucht werden, bei der die lokale Nähe (und damit die Möglichkeit der Begegnung) möglicherweise größere Bedeutung hat als die Frage nach der konfessionellen Identität in einer weltweiten Gemeinschaft.
Vielgestalt der Ökumene
Auch für diejenigen, welche sich hauptberuflich mit Fragen der Ökumene befassen, ist es eine Herausforderung, die Vielgestalt ökumenischer Vorgänge in die eigenen Überlegungen einzubeziehen. Theologisch ausgerichtete, meist bilateral zusammengesetzte Gremien erarbeiten Dokumente, die nicht selten wenig Resonanz finden. Ökumenische Materialien für die Gemeindearbeit werden bereit gestellt, deren theologische Basis manchmal Anlass zu Rückfragen bietet. Kirchentage und Katholikentage sind ohne ökumenische Dimension nicht mehr denkbar. Die Kirchenleitungen veröffentlichen wichtige gemeinsame Schreiben etwa zu sozialethischen Themenbereichen. Es gibt in Deutschland allerdings keine Institution, welche all die genannten, um viele weitere Bereiche zu erweiternden Formen der Ökumene koordiniert. Es existiert jedoch eine Einrichtung, die insbesondere auf multilateraler ökumenischer Ebene in Deutschland sehr wertvolle Dienste der Zusammenschau tut: die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK).
die ACK
Die ACK entspricht auf bundesdeutscher Ebene anderen nationalen Räten von Christinnen und Christen, die weltweit im Kontext der Ökumenischen Bewegung im 20. Jahrhundert entstanden sind: In einzelnen Regionen der Welt erklären Kirchen und christliche Gemeinschaften ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit insbesondere in jenen Fragebereichen, die sie gemeinsam betreffen. Vorrangige Kennzeichen dieser Form der ökumenischen Kooperation sind: (1) die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit allen christlichen Denominationen, die im gemeinsamen Lebensraum vertreten sind, und damit verbunden die ausdrückliche Wertschätzung der multilateralen Ökumene; (2) die Begrenzung der Zielsetzung auf Initiativen, die ohne Veränderung der ekklesialen Rahmenbedingungen in der Ökumene am Ort realisierbar erscheinen; (3) die Konzeption und Begleitung von Projekten, welche die christlichen Kirchen gemeinsam in einen tätigen Dialog mit anderen religiösen oder gesellschaftlichen Gruppierungen bringen. Wie in der gesamten modernen Ökumenischen Bewegung im 20. Jahrhundert feststellbar, ist auch die Geschichte der ACK mit Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs verbunden. Gerade in Deutschland wuchs in dieser Zeit die Einsicht in die Sinnhaftigkeit einer institutionalisierten Form der Ökumene, durch welche die ermutigenden und bereichernden Begegnungen in den Zeiten des gemeinsamen Widerstands gegen die nationalsozialistische Diktatur weiterwirken. Den äußeren Anstoß zur Bildung eines nationalen Kirchenrats gab der sich zeitgleich formierende Ökumenische Rat der Kirchen in einem Schreiben an die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) im Jahr 1946. Ebenso wie weltweit, waren auch in Deutschland die Kirchen reformatorischer Tradition in dieser Phase der Ökumenischen Bewegung die Vordenker und die Organisatoren der weiteren ökumenischen Entwicklungen. Erste Gespräche wurden mit einzelnen Freikirchen geführt. Sie mündeten in die Gründung einer „Arbeitsgemeinschaft“ zunächst zwischen Christinnen und Christen evangelischen Bekenntnisses am 10. März 1948 in Kassel. Gründungsmitglieder sind neben der EKD der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden/Baptisten (BEFG), die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK), die Arbeitsgemeinschaft deutscher Mennonitengemeinden (AMG), das katholische Bistum der Alt-Katholiken sowie die Evangelische Brüder-Unität/Herrnhuter Brüdergemeine. Zum ersten Vorsitzenden wurde Pastor Martin Niemöller gewählt. Bei der Gründung wurde eine Form der Kooperation vereinbart, die – entsprechend dem Leitbild des ÖRK – die ekklesiologischen Differenzen unberücksichtigt ließ. Eine nachhaltig gestellte Frage im Blick auf die ACK ist bis heute, ob die Bezeichnung „Arbeitsgemeinschaft“ den ekklesialen Status der Zusammenarbeit der Kirchen nicht zu wenig berücksichtigt. Andererseits zeigt die Erfahrung, dass der von Beginn an ausgesprochene Verzicht auf das Ziel einer Klärung der ekklesiologischen Differenzen erst den Weg frei machte für eine weitreichende Zusammenarbeit in den Bereichen, in denen dies ohne weitere Vorklärungen bereits möglich ist.
Bereits 1949, bald nach der Gründungsversammlung, traten die Heilsarmee und die Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen der ACK bei. Die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil veränderte Sichtweise der Ökumenischen Bewegung in der römisch-katholischen Lehrtradition ermöglichte es, in nationalen Kontexten eine Intensivierung der ökumenischen Zusammenarbeit vorzusehen. Bedingt durch die politische Teilung Deutschlands, konnten seit 1963 die Delegierten aus den Kirchen der damaligen DDR nicht mehr an den Sitzungen teilnehmen. 1970 wurde die „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der DDR“ (AGCK) gegründet. Die ACK im Osten und Westen Deutschlands schloss sich 1991 wieder zusammen. Im Jahr 1974 entschieden sich die Römisch-Katholische Kirche und die Griechisch-Orthodoxe Metropolie für eine Mitgliedschaft in der ACK. Weitere Orthodoxe Kirchen folgten. 1998 trat die Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler Gemeinden der ACK bei. Heute, im Jahr 2007, gibt es 16 Mitgliedskirchen der ACK (Äthiopisch-Orthodoxe, Anglikaner, Mennoniten, Armenisch-Orthodoxe, Baptisten, die Heilsarmee, Evangelisch-Altreformierte, die Herrnhuter Brüdergemeine, die EKD, Methodisten, Alt-Katholische, Koptisch-Orthodoxe, den Verband der Diözesen der Orthodoxen Kirche in Deutschland, die Römisch-Katholische Kirche, die Selbständig Evangelisch-Lutherische Kirche und Syrische-Orthodoxe), vier Gastmitglieder (das Apostelamt Jesu Christi, den Bund Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland, die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten und den Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden) sowie drei Gruppierungen im Status von Ständigen Beobachtern (die Quäker, die Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Kreise und das Evangelische Missionswerk in Deutschland). Allein die Aufzählung der Vielzahl der in der ACK repräsentierten Konfessionsgemeinschaften lässt erahnen, wie mühsam es ist, in Einzelfragen Konvergenzen zu erreichen. Zugleich geschieht durch Begegnungen auf multilateraler Ebene eine Erweiterung des ökumenischen Erfahrungsraums.
Organisationsstruktur
Die ACK ist ein eingetragener Verein, dem Kirchen und christliche Gemeinschaften beitreten können. Die Mitgliedskirchen entsenden Delegierte in die Mitgliederversammlung, die einen Vorstand wählt, den ein/eine Vorsitzende/r leitet. In der Ökumenischen Centrale in Frankfurt befindet sich die Geschäftsführung der ACK. Sie koordiniert in den Zeiten zwischen den Mitgliederversammlungen die Tätigkeiten in Ausschüssen oder Arbeitsgruppen und realisiert die internationale Präsenz der ACK. Der Deutsche Ökumenische Studienausschuss (DÖStA) ist ein multilateral zusammengesetztes Gremium von Theologen und Theologinnen, das Arbeitsbereiche der ACK theologisch vertieft und zudem in einer gewissen Eigenständigkeit Studienprojekte durchführt. In den zurückliegenden Jahren standen dabei eine Auslegung des Glaubensbekenntnisses von Nizäa-Konstantinopel, Fragen der Ekklesiologie, Überlegungen zu Fragen der ökumenischen Bildung und das Verständnis der Rechtfertigungsbotschaft aus multilateraler Perspektive im Mittelpunkt der Beratungen. Neben der Fortführung vieler Einzelprojekte der ACK (Mitarbeit bei den vom ÖRK ausgerufenen Dekaden zur Solidarität der Kirchen mit den Frauen und zur Überwindung der Gewalt; Aufrufe zur Stärkung der missionarischen Ökumene) lässt sich insgesamt die Tendenz zu einem verstärkten interreligiösen und multikulturellen Dialog erkennen (vor allem in den Projekten „Lade deinen Nachbarn ein“ und „Weißt du, wer ich bin?“). Nicht alle Mitgliedskirchen favorisieren dies in gleicher Weise. Von anhaltender Bedeutung wird die Frage sein, wie sich die Unterzeichnung der Charta Oecumenica durch Vertreter der Mitgliedskirchen der ACK im Rahmen des ersten Ökumenischen Kirchentags in Berlin 2003 konkret in Deutschland auswirken wird. Eine Eigenart der ACK in Deutschland ist es, die Ausbildung eines verzweigten Netzes von regionalen und örtlichen Untergliederungen ausgebildet zu haben, das für eine Verbreitung und Konkretisierung der bundesweiten Anregungen Sorge trägt. Zudem sind einzelne regionale Einrichtungen – neben anderen vor allem diejenigen in Baden-Württemberg und Bayern – darum bemüht, vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Situation Anregungen etwa in Gestalt von Arbeitshilfen zu geben, die auch überregional zur Förderung des ökumenischen Anliegens beitragen.
Zukunftsperspektiven
Die Zukunft der multilateralen Ökumene in Deutschland ist eng mit dem Fortbestand der ACK verbunden. Nicht zuletzt Finanznöte gefährden derzeit dieses Anliegen. Weltweit betrachtet, bilden manche Kirchen und christlichen Gemeinschaften, die in Deutschland einen Minderheitenstatus haben, die konfessionelle Mehrheit. Verständnis für die jeweiligen Eigenarten der Christen und Christinnen unterschiedlicher Konfession kann nur in Begegnungen wachsen.