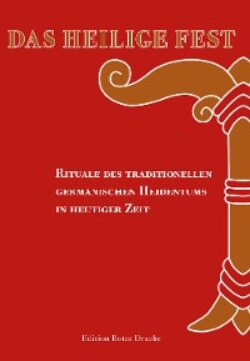Читать книгу Das Heilige Fest - Fritz Steinbock - Страница 19
Die Gabe will stets Vergeltung
ОглавлениеNeben bluostrar gab es im Althochdeutschen für ein heidnisches Opfer auch das Wort gelt oder gilt, das manchmal davon unterschieden wurde: Die Franken mussten bei der christlichen Taufe allem them bluostrum indi den gelton, allen Blótar und Opfern, abschwören – sie dürften genau zwischen bluostrar für Trank- und gelt für Speise- und Sachopfer unterschieden haben. Im sächsischen Taufgelöbnis ist dagegen mit nur einem Wort von allum diobolgeldae, allen „Teufelsopfern“, die Rede.
Gelt, gotisch gild, hängt mit vergelten zusammen, die nordische Form gildi bedeutet direkt „Rückzahlung, Vergeltung“. Ein Opfer an die Götter wurde von den germanischen Völkern als eine Vergeltung für ihre Wohltaten aufgefasst und unterscheidet sich vom römischen Brauch nach der Formel do ut des – „Ich gebe, damit du gibst“ – wohl darin, dass im Vordergrund nicht die Bitte um kommende, sondern der Dank um erwiesene Segnungen steht, folgt ansonsten aber derselben Logik. Opfern unterliegt den Regeln des Gabentauschs, die auch innerhalb der menschlichen Gesellschaft gelten. Die Edda bestätigt dies durch den Vers: „Die Gabe will stets Vergeltung.“
Der vorangehende Satz „Besser nicht gebetet als zuviel geboten“ ist vordergründig eine Warnung. Man soll die Götter nicht durch übertriebenen Dank beschämen und bei Bitten nicht versuchen, sie durch große Opfer ungebührlich in die Pflicht zu nehmen. Der Hintergrund ist, dass das Opfer genauso gesehen wurde wie das Geschenk unter Menschen, das in der germanischen Kultur mehr als nur ein Dank für erbrachte Leistungen, Zeichen der Wertschätzung oder wie auch bei den Indianern ein Maß für die Ehre der Edelmänner war, die an ihrer Freigiebigkeit gemessen wurden.
Geschenke und Gegengeschenke wurden auch bewusst eingesetzt, um gegenseitige Bindungen herzustellen und zu festigen. Ein Gefolgsherr band seine Männer nicht nur durch einen Treueeid an sich, sondern auch durch reichliche Geschenke. Ebenso wurden Ehen durch Mitgift und Morgengabe und Bündnisse zwischen Sippen und Stämmen durch den Austausch von Geschenken besiegelt. Verwandte brachten bei Besuchen Geschenke mit und erhielten welche, Freunde, die nicht verwandt waren, tauschten Geschenke aus, und Blutsbrüder festigten ihren Bund auch durch ein Geschenk.
Die Bedeutung von Geschenken ging so weit, dass Männer, die sie einander gegeben hatten, zueinander nicht mehr „frei“ standen, das heißt sie durften einander nicht mehr schaden. Der Gabentausch hatte zwischen ihnen Frieden geschaffen, denn mit dem Geschenk geht vom einen zum anderen auch das Heil über, das jemand hat und das allen Dingen anhaftet, die von ihm kommen, zumindest allen bedeutenden. Man gibt damit nicht bloße Gegenstände, sondern einen Teil von sich selbst, ja sogar vom Wichtigsten, das man hat.
Deshalb hat es eine tiefe Bedeutung, wenn man das Opfer als ein Geschenk an die Götter definiert. Aus dem Geist der germanischen Kultur verstanden, bedeutet das sehr viel mehr als alle denkbaren anderen Deutungen. Es ist eine Bindung zwischen Göttern und Menschen, die unsere Verwandtschaft und Freundschaft immer wieder erneuert und mehr und mehr stärkt, und es ist ein Fluss des Heils, der ihres und unseres zu einem Heil zusammenschweißt.