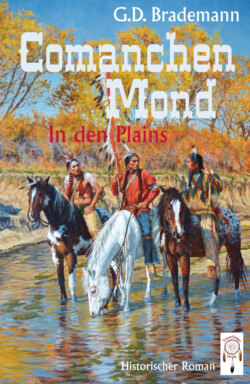Читать книгу Comanchen Mond Band 1 - G. D. Brademann - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 9
ОглавлениеNun, da er endlich ihr Tipi verlassen hatte, atmete Großmutter hörbar auf. „Ich dachte schon, er geht überhaupt nicht mehr“, konnte sie es sich nicht verkneifen zu sagen. Dann sprudelte es förmlich aus ihr heraus: „Running-Fox ist ein Cheyenne – ich verstehe das nicht. Warum hat er uns das nicht gesagt? Nun denn, das werden wir aufklären; ich frage ihn einfach.“
Summer-Rain schaute etwas verlegen drein. Was sollte sie dazu sagen? Irgendwie war sie enttäuscht. Sie und Running-Fox hatten so viel gemeinsam unternommen, so viel miteinander geredet. Warum nicht darüber? „Light-Cloud wusste es sicher auch nicht, Großmutter“, wandte sie ein, „sonst hätte er doch etwas gesagt. Macht das denn einen Unterschied? Running-Fox bleibt doch Running-Fox.“
Großmutter schnaufte geringschätzig. So ein dummer Junge, dachte sie. Im Volk hat jeder einen Platz, egal, woher er kommt. Schämt er sich etwa seiner Herkunft? Das konnte sie sich bei dem stolzen Mann nicht vorstellen. Also, warum diese Heimlichtuerei?
Weil sie ihre Miene sah, hob Summer-Rain eine Hand. „Ich will nicht, dass du ihn deshalb bedrängst“, sagte sie entschlossen. Beinahe hätte Großmutter laut aufgelacht, weil sie ihn in Schutz nahm.
„Gut, dann frag du ihn eben selbst.“ Damit Summer-Rain ihr leicht amüsiertes Gesicht nicht sehen konnte, wandte sie sich ab. „Wir werden ihn ohnehin bald hier haben – länger als einen halben Tag hält er es ja sowieso nicht ohne dich aus. Ich möchte mal wissen, was er macht, wenn er von hier fort ist.“
‚Auch darüber haben wir nicht gesprochen‘, stellte Summer-Rain schmerzlich fest.
Peinlich berührt wuselte sie im Tipi herum, als ob sie sich eine Näharbeit suchen wollte. Freiwillig hätte sie das niemals getan. Was Großmutter da behauptet hatte, stimmte natürlich. Mit einem zu flickenden Hemd von Light-Cloud setzte sie sich an das herunterbrennende Feuer.
Die Flammen wärmten und beruhigten sie etwas. Innerlich aufgewühlt schloss sie die Augen. Sie durfte jetzt nicht über Running-Fox nachdenken. Alles, was mit ihm zusammenhing, musste vorerst aus ihrem Kopf verschwinden. Später würde sie darüber nachdenken, warum er ihr das verschwiegen hatte. Es dauerte nicht lange, da gelang es ihr, sich voll auf die bevorstehende Wanderung zu konzentrieren. Was Great-Mountain alles gesagt hatte, war wieder da.
Großmutter setzte sich still neben sie. Erst als Summer-Rain ihre Augen wieder öffnete – das dauerte lange – legte sie ihr eine Hand auf den Arm. „Mein kleiner Schmetterling, ich weiß doch, dass du ihn gern bei dir siehst. Deine alte Großmutter wollte dich nicht verärgern; hab Geduld mit mir. Lass uns jetzt über andere Dinge sprechen.“
Summer-Rain nickte. Ja, das wollte sie auch. „Erzähl“, drängte sie die alte Frau. „Erzähl mir alles, was du über diese Sache weißt!“ Sie deutete auf die Felle, auf denen bis eben noch Great-Mountain gesessen hatte. „Er hat ja nicht viel gesagt, was diese Vorkommnisse betrifft, wegen denen ich dort hingehen soll. Du kannst mich nicht, ohne etwas darüber zu wissen, reiten lassen. Ich bin auch kein kleines Kind mehr, auf das man Rücksicht nehmen muss. Ich habe ein Recht darauf, alles zu erfahren.“ Trotzig zog sie die Augenbrauen zusammen. „Und wage ja nicht, mich hinzuhalten!“
Mittlerweile war es zu dunkel im Tipi geworden, um das Hemd von Light-Cloud zu flicken. Nur die kleine Flamme des Kochfeuers erhellte den Raum. Summer-Rain behielt es trotzdem noch in ihrem Schoß.
Auf Großmutters Gesicht lag ein ernster Ausdruck. „Comes-Through-The-Summer-Rain. Also gut, hör zu – ich werde diese Geschichte nur einmal erzählen und niemals wieder.“
Die alte Frau streckte ihre geschwollenen Füße aus und massierte sie mit ihren abgearbeiteten Händen. Summer-Rain sprang auf, um Holz auf die Feuerstelle zu legen. Sie wollte das Gesicht ihrer Großmutter sehen.
„Ich muss wohl von ganz alter Zeit anfangen“, meinte diese und begann mit ihrer Geschichte. „Der große Krieg – dort, wo die Sonne aufgeht, mit den Englishmen und ihren Feinden, die jetzt in Kanada leben, war lange vorbei. Danach kamen mehr und mehr Siedler über das große Wasser. Warum? Das weiß nur der Wind, der sie zum Sonnenuntergang getrieben hat und immer noch treibt. Vielleicht ging es ihnen wie uns jetzt; jemand versuchte, sie aus ihren Jagdgründen zu vertreiben. Vielleicht waren sie auch nur gierig auf neues Land. Sie kamen als Fremde, und wir hießen sie willkommen, wie es unsere Art Fremden gegenüber ist. Sie – das waren etwa zehnmal zehn Hände voller Männer, Frauen und Kinder, die eine neue Heimat suchten. Als sie begannen, für sich Tipis zu bauen, fällten sie Bäume, bauten ihr Essen an und blieben. Wir lebten vom Mond der blauen Blumen bis zum Blättermond mit ihnen Seite an Seite in Frieden. Unsere Jagdgründe grenzten damals an die der Cheyenne, die dort noch zahlreich waren. Manchmal wussten wir sogar nicht genau, wo unsere aufhörten und ihre begannen; deshalb kam es oft zu Streitigkeiten. Wo sich die Weißen niederließen, war eindeutig Cheyenne-Land. Zwischen ihnen und uns gab es nie Feindschaft, wir waren gleichberechtigte Nachbarn von Anfang an. Diese Leute sprachen eine seltsame Sprache – eigentlich sprachen sie zwei Sprachen und verstanden sich doch. Das war es, was ihnen unsere Achtung brachte und uns neugierig auf diese Weißen machte. Das Land dort dehnte sich gewaltig weit nach jeder Himmelsrichtung aus. Platz genug für viele Völker mit den unterschiedlichsten Sprachen. Sie gründeten ein Lager, das sie Tuckerville nannten. Bereits nach einigen Monden gab es Ehen zwischen den Siedlern und uns. Unser Blut wurde ihr Blut, und wir saßen oft zusammen. Bei Festen gab jeder, was er hatte. Dann kamen die Ute aus den Bergen herunter und überfielen unser Lager. Sie waren damals noch zahlreich und stark. Von jeher haben wir mit diesen schwarzen Hunden Krieg geführt. Einige der Siedler, die gerade bei uns zu Gast waren, griffen wie wir nach den Waffen. Gemeinsam schlugen wir sie in die Flucht. Wir nahmen Skalps, die Siedler nahmen ebenfalls Skalps.
Ich war damals ein junges Mädchen. Aber ich erinnere mich noch gut an die anschließende Feier. Alle – wir und die Weißen – feierten diesen Sieg zusammen, bis die Sonne über den Bergen aufging.
Wi-tsha, wie wir sagen, wenn wir uns über etwas freuen, nannten die Siedler diesen Tag. Danach waren wir Brüder. Wenn wir wieder zu ihnen kamen, war es immer so, als kämen wir nach Hause. Die Sonne zog ihre Bahnen über dem weiten Himmel, und der Wind trieb die Wolken vor sich her. So verging die Zeit. Immer mehr Siedler kamen in das Lager Tuckerville. Wir waren erstaunt, wie schnell dieses Lager wuchs. Aber unsere Jagdgründe wurden nie von ihnen berührt. – kein Stück Erde eingezäunt, nicht ein Baum entwurzelt, um mehr Land für ihre Früchte zu haben oder dem Bau ihrer Tipis zu dienen. Was damals unsere Ältesten durch den Rauch der Pfeife mit ihnen ausgemacht hatten, war immer noch gültig. Nur so konnte der Frieden erhalten bleiben. Das wussten sie, und das wussten wir auch.
Eines Tages verdunkelten Wolken den Himmel. Es war die Zeit, als die Blätter von den Bäumen fielen und die Wälder in allen Farben des Regenbogens strahlten. Wir wussten, dass inzwischen die Felder der Tuckerviller bis weit in die Jagdgründe unserer Todfeinde, der Cheyenne, reichten. Bis zu dieser Zeit hatte sich keiner von ihnen dort blicken lassen. Wir glaubten, sie wären längst weit weg in den Sonnenaufgang geritten. Bevor die Siedler hierher gekommen waren, hatten wir oft blutige Auseinandersetzungen mit den Kriegern der Cheyenne. Sie raubten unsere Pferde, wir holten sie uns in doppelter Anzahl zurück – und ihre Frauen dazu.“
Großmutter machte eine Pause und versank in Erinnerungen. Sie hatte nicht vor, ausschweifende, lange Geschichten aus ihrer Jugend zu erzählen. „An diesem Tag, als der Himmel sich verdunkelte, kamen die Cheyenne zurück. Sie kamen zusammen mit ihren Brüdern, den Arapaho, und sie kamen wie ein Sturm im Blättermond über die weißen Siedler. Da griffen auch unsere Krieger zu den Waffen und standen ihnen in diesem Kampf bei. Ich gebe ja zu, dass es nicht wegen ihres guten Aussehens oder der gebackenen Leckereien war, dass wir das taten. Doch wir taten es, denn schon immer waren die Cheyenne unsere Todfeinde. Der große Friede mit ihnen, den Arapaho und einigen Apachengruppen war da noch fern. Es war ein gewaltiger Kampf, und auf beiden Seiten gab es große Verluste. Am Ende flohen die gemeinsam besiegten Feinde. Während wir zurück in unser Lager ritten, flatterte so mancher Skalp von ihnen im Wind an unseren Lanzen. Auch die Weißen hatten tapfer gekämpft. Danach kamen die Cheyenne nie wieder in diese Gegend.“
Großmutter griff nach Summer-Rains Hand und drückte sie. „Sie sind auch bis heute nicht wiedergekommen. Ich weiß, dass die Weißen sie ganz aus ihren Jagdgründen im Colorado-Territorium vertrieben haben.“
Summer-Rain runzelte die Stirn. Diese Geschichte würde Running-Fox gar nicht gefallen. Nein, er sollte kein einziges Wort davon erfahren. Auch nicht, dass man sie dorthin schicken wollte.
„Als der Kampf vorbei war“, erzählte Großmutter weiter, „boten die Siedler uns dieses Geschenk an – dieses Land, das in Great-Mountains Ur-kunde beschrieben ist. Niemand von ihnen darf jemals dort siedeln, niemand darf dort etwas anbauen. Es soll unser Land sein, solange die Flüsse fließen, solange der Wind weht, solange das Gras wächst und die Berge in den Himmel ragen. Also haben wir uns zusammengesetzt, die Weißen aus dem Lager Tuckerville und wir alle. Haben geredet und geredet, gegessen, geredet, gegessen, geredet, vier Sonnenaufgänge und drei Sonnenuntergänge lang. Eigentlich hätten wir ja diese Menschen auslachen können, denn dieses Land dort draußen vor den Bergen, das sie uns zum Geschenk machen wollten, das war doch frei, groß und frei. Niemand würde uns daran hindern können, es uns einfach zu nehmen. Wir hatten jedoch kein Interesse daran; unsere Heimat ist hier. Trotzdem lachten wir heimlich über die Dummheit der Weißen, uns ein Gebiet zu überlassen, das ihnen nicht gehörte und das sie nicht einmal kannten. Unsere Vorstellungen von Land und die der Weißen gehen weit auseinander. Weil sie das nicht begriffen, ließen wir ihnen die Freude über ihre Großzügigkeit; schließlich gab es bei diesen Gesprächen immer genügend Tabak.
Am Ende bemalten sie dieses Papier – diese Urkunde, die Great-Mountain in Verwahrung hat – mit ihren Zeichen, und jeder unserer Krieger setzte sein eigenes Zeichen ebenfalls auf das Stück Papier, wie sie diesen Stoff nennen. Auch mein Großvater, mein Vater und mein Bruder – dein Vater – machten ihre Zeichen darauf. Ich war damals verheiratet. Neben unsere Namen schrieb einer der Weißen, wie sie ihn in ihrer Sprache aussprachen, manchmal sogar, was er bedeutete. Mein Ehemann ist in diesem Kampf gefallen, auch die erste Frau deines Vaters. Sie war eine Kriegerin und ebenso tapfer wie die Männer. An diesem Tag, als alle diese Urkunde unterzeichneten, kam ein dunkel gekleideter Mann, um alles zu überwachen.“ Ja, sie konnte ihn noch genau vor sich sehen, als wäre es erst gestern gewesen. „Er war ein hochgewachsener Mann in schwarzen Kleidern mit einem komischen Hut auf dem Kopf. Ein großes Medaillon steckte an seiner Brust. Zu unserer Verwunderung machte er aus dem einen Papier zwei, und wir mussten auch darauf unsere Zeichen setzen. Er ritt wieder fort und nahm eine Urkunde mit. Die andere hatte er zuvor Old-Antelope, der damals unser junger Häuptling war, übergeben. Uns wurde gesagt, er würde diese Urkunde an einem sicheren Platz verwahren, damit sich Tuckerville immer daran erinnern kann.“
Summer-Rain wartete, ob noch etwas von Großmutter kam, aber als sie weiter schwieg, sprach sie das, was ihr eben in den Kopf gekommen war, aus. „Meine Mutter hat mir einmal gesagt, dass nur der Große Weiße Vater in Washington, den die Weißen ihren Präsidenten nennen, Verträge mit uns abschließen darf. Vielleicht hat dieser Mann deb Vertrag ja zu ihm gebracht?“
Großmutter schüttelte unwillig den Kopf. „Du hast nicht richtig zugehört, Kind. Das war kein Vertrag, das war ein Geschenk in Form von Land. Wenn es ein Vertrag gewesen wäre, hätten beide Seiten etwas geben müssen, und einer wäre übervorteilt worden – wie es immer war. Nein, Quahari machen keine Verträge mit dem Weißen Mann.“
Dann sagte sie nachdenklich: „Ich hoffe nicht, dass der Große Weiße Vater, dessen Zunge gespalten ist wie die einer Schlange, jemals irgendeinen Einfluss auf diese Ur-kunde hat. Es war ein Geschenk, Summer-Rain; dieses Geschenk war ein Versprechen. Nur Tuckerville und wir, kein Washington, kein Großer Vater, nur wir und Tuckerville. Ob sie noch immer dort so denken, wissen wir nicht. Deshalb will ja Great-Mountain dich dorthin schicken; du sollst das herausfinden.“
Gut, dachte Summer-Rain, jetzt weiß ich Bescheid. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, was man ihr damit zutraute. Es ging nicht nur um diese gefahrvolle Wanderung, es ging um viel mehr. Sie musste auch Kontakt mit den Menschen dort aufnehmen. Natürlich – deshalb hat Great-Mountain ja mich ausgesucht; niemand hier spricht Taibo Tekwapu, Americano.
Die alte Frau hatte sie nicht aus den Augen gelassen. „Ich will doch nur, dass du vorsichtig bist“, sagte sie jetzt mit besorgter Stimme und barg ihren Kopf auf den Knien. Weinte sie etwa?
Summer-Rain legte ihr einen Arm um die schmächtigen, knorrigen Schultern und versuchte, sie mit aufmunternden Worten zu trösten. Nach einer Weile gelang es ihr auch, und sie kam wieder auf ihr ursprüngliches Thema zu sprechen. „Bei allem, was du mir von den Menschen aus dem Lager, das sich Tuckerville nennt, erzählt hast, glaube ich, dass sie aufrichtig und ehrlich sind – nicht so verlogen und hinterlistig wie die Tejano, sonst gäbe es diese Ur-kunde gar nicht. Seitdem ist viel Zeit vergangen, doch diese Menschen wollten in Frieden mit uns leben; so viel habe ich verstanden. Nicht wie die Tejano, die uns immer schon als ihre Feinde betrachten. Warum sollten sie jetzt anders darüber denken?“
Großmutter nickte – auch sie hatte darüber nachgedacht. Sich eine Träne von der runzligen Wange wischend, kam auch prompt ihre Antwort. „Du hast recht, kleine Summer-Rain. Die Leute aus Tuckerville sind keine Tejano, die nur darauf aus sind, uns von der Erde zu wischen. Die Tejano wollen uns vernichten. Sie haben damals unsere Häuptlinge erschossen, als sie vorgaben, mit uns einen Frieden auszuhandeln. Die Menschen in Tuckerville dagegen waren anders, und ich habe sie in guter Erinnerung. Es fragt sich nur, ob sie oder ihre Nachkommen auch jetzt noch so denken.“
Was sie auch vorbringen würde, egal – es war ohnehin zu spät. Die Ratsversammlung hatte entschieden, und ihrem Urteil sollte man vertrauen. „Genug für heute“, sagte sie deshalb, nach der Näharbeit des Mädchens greifend. „Das Hemd von Light-Cloud sieht aus, als hättest du einen Truthahn gerupft. Leg das weg – wir werden viel Arbeit haben, wenn unsere Männer zu einer weiteren Büffeljagd aufbrechen.“
In dem Moment, als Großmutter Light-Cloud erwähnte, zuckte Summer-Rain zusammen. Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Die Sache mit Dark-Night fiel ihr wieder ein. „Ich muss noch einmal fort“, behauptete sie, Großmutters forschendem Blick ausweichend. „Ich muss zu Mocking-Bird und ihrem kleinen Jungen“, log sie sie mit schlechtem Gewissen an.
„Dann kannst du gleich noch unseren Wassersack auffüllen“, meinte Großmutter.
Hastig griff Summer-Rain danach und huschte aus dem noch offen stehenden Tipi.
Mittlerweile stand die Sonne bereits weit im Westen, und die Dämmerung legte sich über das Land. Suchend schaute sich Summer-Rain um. Keine Spur von ihrem Bruder, dessen Tipi nicht weit von ihrem stand. Bei seinen Pferden, von denen einige in der Nähe grasten, war er ebenfalls nicht. Vier von ihnen hoben eben die Köpfe und blickten erwartungsvoll zu ihr hin. Summer-Rain eilte an ihnen vorbei hinunter zum Fluss. Dort bahnte sie sich einen Weg durch das hohe Gras, aus dem ab und zu Pferdeköpfe auftauchten; dann ging sie am Rande der Uferböschung entlang. Icy-Winds Behausung war noch weit weg. Sollte sie tatsächlich dorthin gehen, um nachzusehen, ob Dark-Night inzwischen in ihrem Zuhause war? Mit sich selbst im Zweifel, blieb sie stehen. Langsam ging sie um eine Flussbiegung, da bemerkte sie flüchtig einen Schatten, der ihr schon die ganze Zeit über gefolgt sein musste. Jetzt hatte sie sich anders entschieden und stieg einen leichten Abhang empor. Von hier aus suchte sie die andere Flussseite nach ihrem Bruder ab. Sie konnte die Reiter sehen, die sich seit dem frühen Morgen dort mit ihren Pferden beschäftigten. Die mexikanischen Pferdejungen trieben gerade einige von ihnen zusammen, um sie wieder zur Herde zu bringen. Das waren die Tiere, die besonders für die Büffeljagd ausgebildet worden waren und den Kriegern morgen Früh zur Verfügung stehen mussten. Der große Bruder war nirgends zu sehen. Mit klopfendem Herzen suchte sie trotzdem noch einmal die gegenüberliegende Seite nach ihm ab.
„Ich bin hier, falls du mich suchst.“
Abrupt drehte sie sich um. Sie hatte den Schatten hinter ihr ganz vergessen. Running-Fox stand da, aufrecht, groß und schlank. Die Haare fielen ihm offen bis weit über die Schultern auf den Rücken. Er trug wieder das weiße Hemd aus Leinen, das immer noch schmutzig war, und seinen breiten, silberbeschlagenen Gürtel. Unter sein Lendentuch hatte er Leggins gezogen. Anders als bei den Comanchen üblich, waren sie nicht schlicht gehalten, sondern mit Fransen verziert und mit eingefärbten Stachelschweinborsten bestickt.
„Dich habe ich nicht gesucht“, blaffte sie ihn an. Ihr Ton war trotzig. Atemlos schnappte sie nach Luft.
„Wenn du nach deinem Bruder Ausschau hältst, kann ich dich beruhigen“, meinte Running-Fox. „Der ist drüben im Tipi von Gray-Wolf. Storm-Rider ist auch bei ihnen. Sie besprechen den morgigen Tag, denn sie wollen ganz früh los. Mich haben sie übrigens auch eingeladen, an der Büffeljagd teilzunehmen. Du wirst mich also noch eine Weile ertragen müssen.“
Ein breites Lächeln auf dem Gesicht, kratzte er sich mit einem Finger über die Kerbe in seinem Kinn.
Sie ließ sich nicht von ihm beeindrucken, hatte sie doch noch die Worte von Great-Mountain, dass er fortreiten wollte und das andere, dass er ein Cheyenne war – im Kopf. Wollte er nur wegen der Büffel noch bleiben? An welcher Stelle kam sie denn da?
Ein wenig enttäuscht sagte sie deshalb schmollend: „Das ist wohl so, aber irgendwann musst du sicher wieder weg. Sag nur vorher rechtzeitig Bescheid, damit ich dir dein Hemd noch waschen kann.“
Er blickte an sich hinunter und nickte. „Ich hab dich übrigens heute ausreiten sehen“, sagte er so beiläufig wie möglich.
Schweigen. Erschrocken hielt sie den Atem an.
„Aber ich schleiche keinem Mädchen nach – auch nicht dem, das durch den Sommerregen kommt.“
Erleichtert atmete sie aus. „Was ich tue, geht dich nichts an“, zischte sie etwas ungehalten.
Ihre dunkelblauen Augen funkelten herausfordernd, doch dann lenkte sie ein. „Ich habe Light-Cloud gesucht. Jetzt, wo ich weiß, dass er beschäftigt ist, kann ich wieder zurück zu Großmutter.“
Eigentlich war das ja gar keine Lüge. Zufrieden wandte sie sich ab. Sie wollte sich nicht weiteren peinlichen Fragen ausliefern.
Running-Fox, der ahnte, dass sie ihm etwas verheimlichte, sich aber ärgerte, dass sie sich ihm das nicht zu sagen traute, deutete auf den leeren Wassersack an ihrer Seite. „Warum trägst du dann einen leeren Wassersack mit dir herum?“
Ein kurzes Blinzeln und er wusste, dass sie ein schlechtes Gewissen hatte. Ihr verwirrt zu ihm hochgerecktes Gesicht stimmte ihn milde. Nein, er wollte ihr nicht wehtun, auch nicht mit Worten. „Komm, lass uns Frieden schließen“, kam es deshalb freundlich von ihm. Natürlich lag ihm daran, sich nicht mit ihr zu streiten.
Seine Worte rührten sie sichtlich, denn ihre Miene hellte sich auf. Verlegen blickte sie zu Boden. Hitze stieg an ihrem Hals herauf. Inständig hoffte sie, dass er es nicht bemerkte. Ihr Gesicht war so dunkelbraun von der Sonne verbrannt, dass es keine Rolle spielte.
In seinen Augen funkelte es belustigt, während er seinen Kopf zu ihr hinunter bog, um sie ansehen zu können. „Ich hoffe, du schickst mich jetzt nicht fort“, flüsterte er.
Ein warmes Gefühl – nicht zu vergleichen mit der Hitze, die langsam wieder abflaute – ließ Summer- Rain zu ihm aufschauen. „Bist du wirklich ein Cheyenne?“, stellte sie ihm zusammenhanglos diese Frage. Ihre blauen Augen blickten ihn an, wollten einfach nur wissen: Wer bist du? Und warum hast du mir das verschwiegen? Es ging nicht um seine Herkunft; für sie ging es um mehr. Denn da gab es so vieles, was sie ihn gern gefragt hätte und es doch nicht wagte. Es gab auch vieles, was sie gar nicht wissen wollte. Wenigstens auf diese Frage sollte er ihr jedoch antworten.
Als er schwieg, reckte sie ihm trotzig ihr Kinn entgegen. Sollte er seine Geheimnisse doch für sich behalten! Ihre Augen begegneten sich, und einen flüchtigen Moment lang berührte etwas ihre beider Herzen – etwas, das sie nicht mit Worten hätten beschreiben können. Sie fühlte sich zu ihm hingezogen, doch nicht so, wie es eigentlich hätte sein sollen; anders eben. Ihr Herz machte einen Sprung, und da war er wieder, dieser Schmerz, der wie mit eiskalten Klauen nach ihr griff – immer, wenn sie an den Anderen denken musste. Warum gerade jetzt? Warum hörte das nie auf? Vergiss ihn, schrie es tief in ihr drinnen – vergiss ihn endlich, es tut doch nur weh. Er hat dir das Herz gebrochen, und dieser hier will es ganz. Sie schloss die Augen und blinzelte die aufsteigenden Tränen zurück. Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Als er immer noch nicht antwortete, war sie enttäuscht, dass er ihr so wenig Vertrauen entgegenbrachte.
Running-Fox war verwirrt. Erst jetzt erfasste er die Bedeutung ihrer Frage – sein Versäumnis, ihr davon zu erzählen – und schob ihre Reaktion darauf. Sie muss sich verraten vorkommen, dachte er. Nein, das hatte er nicht gewollt, überhaupt hatte er aus seiner Herkunft kein Geheimnis machen wollen. Er war einfach nur zu naiv gewesen; für ihn war das schon lange nicht mehr wichtig. Er war Running-Fox und ebenso auch Jeremiah Machel. Sollte er das jedes Mal, wenn er irgendwo hinkam, erneut erklären? Ihr hätte er es erklären müssen, das wurde ihm nun klar. Auch die Tatsache, dass Cheyenne lange, lange Zeit Todfeinde ihres Volkes gewesen waren, machte es nicht besser. War es das, weshalb sie dachte, er hätte ihr nichts erzählt? So einfach war das nicht. Die Wahrheit wog viel schwerer. Ihr hätte er viel mehr erklären müssen als jedem Anderen, der ihn gefragt hätte. Ihr hätte er sein Herz ausschütten müssen, und davor war er bisher zurückgeschreckt. Das, was seine Vergangenheit ausmachte, war wie Schlamm in einem Teich. Bei der geringsten Berührung des Wassers kam es wieder hoch. Aber woher wusste sie es? Wer konnte ihr davon erzählt haben, bevor er es selber für nötig hielt? Verdammt, fluchte er wieder einmal in Gedanken auf Englisch, weil es ihm einfiel. Verdammt, ich habe es Great-Mountain gesagt; er hatte mich wegen meiner Kleidung gefragt.
Langsam sog er die Luft ein, um Zeit zu gewinnen. Seine schön geschwungenen Lippen verzogen sich zu einem gequälten Lächeln. Wie die Flügel eines reglos am Sommerhimmel stehenden Adlers, dachte Summer-Rain, die ihn beobachtete. Eins, zwei, drei, vier – zählte sie in Gedanken die Schläge ihres Herzens. Wie lange wird er wohl brauchen, bis er endlich eine Ausrede findet?
Endlich war er zu einer Antwort bereit. Sechs, sechs Herzschläge lang hatte er gebraucht.
„Ja, wer auch immer dir davon erzählt hat, es stimmt“, begann er.
„Denke nicht, dass ich das vor dir verschweigen wollte – so ist das nicht. Meine Vergangenheit ist wie die Schnüre einer Perlenkette, die sich in deinen Haaren verheddert haben. Schmerzhaft, sie wieder auseinanderzubringen, zu ordnen.“ Dann sagte er ein englisches Wort. „Kompliziert.“
„Kom-pli-ziert?“
Er nickte. „Englisch, dieses Wort ist englisch. Ich habe bei einem weißen Mann gelebt – nein, das stimmt so nicht. Ich lebe immer noch bei – nein, mit einem weißen Mann.“ Verwirrt hielt er inne.
Summer-Rain blickte ihn zweifelnd an. „Gut, wenn du entschieden hattest, mir nichts zu erzählen, dann ist das eben so.“
Das Gespräch nahm keine gute Wendung. Erst jetzt verstand er das. Wie sollte er ihr begreiflich machen, dass es nicht so war, wie sie dachte? Dass er ihr zwar alles erzählen wollte es aber noch nicht konnte? Auf seiner Brust lag ein schwerer Stein, während er nach Worten suchte. „Mein ganzes Leben – ich werde es vor dir ausbreiten wie ein Bild auf einer Büffeldecke. Ich werde dir jedes Zeichen genau erklären – alles. Du sollst meine Geschichte hören, die Geschichte meiner Mutter, meiner Schwester, meines Vaters, die Geschichte meines Volkes.“ Nachdem er das endlich herausgebracht hatte, musste er schwer schlucken. Der Rest kam wie ein einziger Schwall von seinen Lippen. „Du sollst sie hören, wenn ich zu dir zurückkomme.“ Summer-Rain schnappte nach Luft – so verzweifelt hatte sie ihn noch nie gesehen. Es tat ihr leid, ihn so in die Enge getrieben zu haben. Geduldig wartete sie, bis er sich wieder gefasst hatte, ohne diesmal ihre Herzschläge zu zählen.
„Verzeih“, sagte er. „Verzeih, doch es ist schwer, von etwas zu sprechen, das man ganz tief in sich verschlossen hat.“
Beide blickten stumm vor sich hin. Summer-Rain wagte nicht, die Spannung, die zwischen ihnen entstanden war, zu durchbrechen. Er machte den Anfang, wieder in die Normalität zurückzufinden – denn es drängte ihn danach, ihr etwas zu sagen, etwas, das ihm schon seit langem auf dem Herzen lag. „Comes-Through-The-Summer-Rain, ich werde zurückkommen.“
Sie wischte sich eine Haarsträhne aus der Stirn und wartete auf mehr. „Das habe ich vor – dann aber komme ich nur wegen dir. Dark-Night ist ja jetzt versorgt.“
Sein Lächeln wurde breiter. Den linken Mundwinkel leicht nach oben gezogen, betrachtete er ihr Gesicht.
Summer-Rain war durcheinander und überlegte schon, ihm etwas über das traurige Leben der Mexikanerin zu erzählen. Natürlich wusste er nichts über sie und Icy-Wind. Männer interessierte so etwas ja nicht. Oder etwa doch? Dass sie nicht glücklich war, wusste hier inzwischen jeder. Vor ihrem Innern erschien urplötzlich das Bild von Light-Cloud und ihr, wie sie dort auf seinen Beinen lag. Es schnürte ihr das Herz zusammen. Und wenn er weiß, was ich weiß? Sofort verwarf sie diesen Gedanken wieder.
Running-Fox betrachtete sie noch immer. Warum sagte sie nichts? War er nicht deutlich genug gewesen? Seine nachtschwarzen Augen durchbohrten sie förmlich. Dachte sie vielleicht, er wüsste nichts über Dark-Nights Leben hier?
„Was das Leben von Dark-Night betrifft, so weiß ich Bescheid. Die Männer aus deinem Volk herrschen über ihre Frauen, das kannst du nicht abstreiten. Icy-Wind beweist das jeden Tag.“
Ungläubig starrte sie ihn an. Meinte er das jetzt im Ernst? Welches Recht hatte er denn, so über ihr Volk zu urteilen? Ihr fehlten die Worte. So durfte niemand von ihren Leuten reden. Außerdem stimmte es überhaupt nicht. Herablassend verzog sie den Mund. „Ich weiß nicht, woher du deine Erkenntnisse hast“, rief sie entrüstet aus, einen Schritt zurückweichend. „Mag sein, dass das auf Icy-Wind zutrifft, doch du kannst von ihm nicht auf den Rest unserer Männer schließen.“
Jetzt blickte er auf sie hinunter, streckte den Arm nach ihr aus und zog sie wieder zu sich heran. Niemand stand in der Nähe, sie waren allein. Nur unten vom Fluss her klangen die Laute kichernder Mädchen herauf. „Ich würde dich niemals so behandeln, Summer-Rain. Für mich kämst du immer an erster Stelle.“ Vorsichtig strich er mit seinen schlanken, feingliedrigen Fingern über ihre Haare, als wollte er es ihr damit beweisen. Sie stand wie erstarrt und wusste nicht, ob sie ihn abweisen sollte oder doch lieber nicht. Dann fiel ihr die Situation mit der Wunde ein. Hatte sie sich denn nicht schon längst für ihn entschieden? Aber das hier war etwas anderes. Es war etwas viel Persönlicheres.
„Comes-Through-The-Summer-Rain“, flüsterte er an ihrer Seite. „Du bist die, die ich will. Ich habe dich schon gewollt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Manchmal kommt es mir so vor, als würde ich dich bereits ewig kennen.“
Der Druck seiner Finger verstärkte sich. Er zog sie noch näher zu sich heran, und Summer-Rain ließ es geschehen.
Ihr klopfte das Herz bis zum Hals, als sie zu ihm aufblickte. Zögernd legte sie ihre Hände auf seine Schultern, fuhr damit an seinen Armen entlang, fühlte die Stränge und Sehnen seiner Muskeln unter ihren Fingern, registrierte eine tiefe, harte Narbe durch das Leinen hindurch. So nahe war sie ihm noch nie gekommen, doch es fühlte sich richtig an.
Mit der Nasenspitze reichte sie ihm gerade bis unter das Kinn, als sie den Kopf reckte. Er legte ihr einen Finger darunter und zwang sie damit, ihn weiter anzusehen. Sein Atem streifte ihr Gesicht, während er wieder zu reden begann. „Ich habe dich gesehen, Mädchen, Comes-Through-The-Summer-Rain. In einem Traum – lange, lange bevor ich hierher gekommen war. Damals dachte ich: Wie schade, dass dieser Traum nie Wirklichkeit werden wird – und jetzt bist du hier, hier bei mir.“
Seine Stimme klang ruhig, und doch spürte sie seine Angespanntheit. Liebevoll betrachtete sie seine schlecht zusammengewachsene Nase, die lange, gezackte Narbe, die vom linken Haaransatz bis zum Kinn verlief. Eines Tages werde ich alles über dich wissen, dachte sie und lächelte still in sich hinein. Dann wird es keine Geheimnisse mehr zwischen uns geben – nie mehr.
„Ich will nicht, dass wir uns aus den Augen verlieren wie die Wolken, die sich in Luft auflösen. Aber ich muss wieder weg, meine Summer-Rain. Alles, was ich mir erhoffe, ist, dass du auf mich wartest. Wird Comes-Through-The- Summer-Rain das tun? Wirst du auf mich warten?“
Erwartungsvoll sah er sie mit einem so intensiven Blick an, dass es schmerzte. In seinen tiefschwarzen Augen fingen sich die Strahlen der untergehenden Sonne und brachten sie zum Leuchten.
Ihr war ziemlich beklommen zumute. Doch seine Frage musste beantwortet werden, das war sie ihm schuldig. Einen Herzschlag lang hatte sie noch Zweifel, dann schob sie ihn energisch von sich weg und beantwortete sie ihm. „Ja, Running-Fox, ich werde warten. Doch du wirst Schwierigkeiten haben, mich wiederzufinden. Cheyenne sind nicht so gute Spurenleser wie Comanchen.“
Sie lachte, und er zog sie heftig an sich, fest entschlossen, sie noch eine Weile so zu halten – mochte sie sich auch dagegen wehren. „Wenn es weiter nichts ist, Summer-Rain, dann werde ich dir das Gegenteil beweisen. Ich finde dich!“
Er hielt sie weiterhin fest und drückte eine Hand gegen ihren Hintern. Ihre kleinen Brüste hoben und senkten sich. Durch das Leinenhemd hindurch spürte sie seinen Körper, ließ es zu, dass seine Hände an ihrem Rücken hinauf und wieder hinunter wanderten. Es wurde schnell dunkel, und die Sonnenstrahlen kamen nur noch wie gefiltert durch die Bäume.
Running-Fox schob sie etwas von sich fort, nur ein klitzekleines Stück, um sie in diesem Licht zu betrachten. Er prägte sich jede Einzelheit ein – alles, alles. Dann konnte er nicht anders, als sie auf ihre Lippen zu küssen. Es war Summer-Rains erster Kuss, und sie ließ es geschehen. Als er weitere Zugeständnisse einfordern wollte, schob sie ihn energisch weg. Es entstand ein Moment der gegenseitigen Unsicherheit. Running-Fox hatte nicht vor, mehr zu wollen, als sie bereit war zuzulassen, und Summer-Rain schwankte zwischen Neugier und Abwehr.
Völlig zusammenhanglos fragte sie: „Warum bist du eigentlich damals so weit hinter Icy-Wind geritten? Es sah so aus, als würdest du ihn mit Absicht meiden.“
Verwirrt blickte Running-Fox sie an. In sich hinein grinsend, beruhigte er seinen Puls. Wenn das ein Ablenkungsmanöver war, um ihn hinzuhalten, dann war ihr das gelungen. Dieses Mädchen war alle seine Bemühungen wert. „Willst du das jetzt wirklich wissen, Summer-Rain? Ich würde viel lieber in deine Augen sehen, solange ich es noch kann.“
Sie schüttelte ihm mutwillig ihre Haare ins Gesicht. „Ja, ich will das jetzt wissen, und mit dem in-die-Augen-sehen gibst du dich ja anscheinend nicht mehr zufrieden, denn ich spüre sehr wohl, wo deine Finger gerade sind.“
Seine Augen zogen sich zu schmalen Schlitzen zusammen, als er leise lachte; er zog jedoch seine Finger nicht weg. „Ich will es dir sagen, wenn du es denn unbedingt wissen musst. Aber mach dich auf einiges gefasst. Zu den Eigenschaften, ‚angeberisch‘ und ‚eingebildet‘, die ich an Icy-Wind erkannt habe, kommt noch eine weitere hinzu: Er ist jemand, der nicht davor zurückschreckt, von anderen etwas zu fordern, was ihm nicht zusteht.“
Oh, dachte sie, er hat ihn in dieser kurzen Zeit seiner Anwesenheit bereits durchschaut. Energisch löste sie seine Finger von dort, wo sie nicht hingehörten. Ein breites Lächeln lag auf seinem Gesicht, während er sie als Antwort darauf mit sich hinunter ins Gras zog. Summer-Rain ließ es geschehen, achtete aber darauf, dass er seine Hände bei sich behielt. Running-Fox hatte verstanden und respektierte ihre Entscheidung. Zwar hätte er ihr Alleinsein hier liebend gerne anders genutzt, doch wenn sie es so wollte, dann musste er sich fügen. Sich zusammenreißend und seine Gedanken auf ihre Frage lenkend, begann er mit seinem Bericht. „Wir sind auf dem Rückweg Comanchen begegnet. ‚Honigesser‘, nennen sie sich. Sie hatten reiche Beute bei einem Überfall auf einen Wagentreck gemacht. Icy-Wind umschmeichelte sie regelrecht, ihm einen Teil davon abzugeben. Mir wurde das bereits richtig peinlich, denn sie lachten hinter seinem Rücken über ihn. Schließlich behauptete er, ein Anrecht darauf zu haben, da er ihnen auf dem Hinweg einen Tipp wegen dieses Trecks gegeben hätte. Das stimmte zwar, wie sie bestätigten, doch sie ließen sich nicht darauf ein. Es war ihre Beute, ihr Überfall, ihr Kampf gewesen. Sie berieten sich eine geraume Zeit miteinander, dann fassten sie einen Beschluss. Es gab einen Überlebenden, einen Gefangenen.“ Running-Fox schwieg.
Geduldig wartete sie, dass er weitersprechen würde. Jetzt war er ernst geworden; es war nichts mehr von dem übermütigen Mann von eben übrig. Das Kichern der Mädchen unten am Fluss verstummte. Sie brachen anscheinend nach Hause auf. Running-Fox lachte verhalten, aber es klang wie erzwungen, fast höhnisch. Schließlich riss er einen Grashalm neben sich aus. Während seine Finger damit spielten, erzählte er die Geschichte weiter. „Sie übergaben ihm diesen Gefangenen als seinen Anteil an der Beute. Er steckte in einem großen Zuckersack. Man konnte nur seine Konturen sehen, weiter nichts. Icy-Wind nahm den Gefangenen mit stoischer Miene entgegen. Ich weiß nicht, was er sich dabei dachte, aber es ist naheliegend, dass er Dark-Night mit seinem nächsten Tun beeindrucken wollte.“
Ihre Frage erwartend, blickte er sie von der Seite an.
„Ich verstehe nicht“, kam es dann auch prompt. „Warum haben sie ihm diesen Mann überlassen?“
Running-Fox verzog angewidert den Mund. „Wahrscheinlich war er so sehr von sich selbst überzeugt, dass er dachte, sie wollten ihm Ehre erweisen.“
„Du denkst das nicht?“
„Nein, ganz und gar nicht. Er mag ein großer Krieger sein, aber die anderen dort wechselten untereinander Blicke, die ihn hätten misstrauisch werden lassen müssen. So etwa wie: Geben wir ihm diesen Mann, wir wollen mit ihm nichts zu tun haben.“
Er zögerte, weiterzusprechen – da protestierte sie. „Komm, jetzt will ich das Ende dieser Geschichte hören. Du kannst nicht in der Mitte aufhören!“
Also machte er mit seinem Bericht weiter. „Die Comancheros hätten bestimmt ein gutes Lösegeld für ihn gezahlt, es war ein großer Mann. Als Icy-Wind ihn aus dem Zuckersack zog, stellte er fest, dass er schwarz war.“
Summer-Rain stutzte. Zuerst wusste sie nicht, wovon er sprach. Dann wurde es ihr klar. Sie hatte noch nie einen dieser schwarzen Weißen gesehen, deren Haare wie Büffelwolle aussahen.
Running-Fox sprach schon weiter, als gelte es, das so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. „Natürlich waren die Honigesser da bereits lange fort. Sie wussten genau, dass ihr Streich nicht gut ankommen würde. Icy-Wind tat, als machte ihm das gar nichts aus. Er dachte nicht daran, diesen Mann zu verkaufen. Stattdessen band er ihn auf ein Wagenrad und entzündete ein kleines Feuer unter seinem Kopf. Als Dark-Night und ich wegritten, lebte der schwarze Mann noch. Seine Schreie konnten wir über eine weite Strecke hören. Icy-Wind blieb bei ihm. Lange – ich schätze, bis zum Schluss.“
Den Grashalm ausspuckend fuhr er fort: „Die Männer der Honigesser selbst wollten mit diesem Mann nichts zu tun haben. Wahrscheinlich hätten sie ihm nichts getan. Sie wollten Icy-Wind wegen seiner unberechtigten Forderung nur beschämen. Seinen Anteil an der Beute hatte er ja nun bekommen. Icy-Wind hat sich nichts anmerken lassen. Als er uns wieder einholte, lächelte er. Ich bezweifle sogar, dass er überhaupt gemerkt hat, was ihm die Krieger damit sagen wollten. Ich habe mich für ihn geschämt.“
Jetzt wusste sie, warum er damals diesen Abstand zu Icy-Wind gehalten hatte.
„Und noch etwas: Er hat mich die ganze Zeit über, die wir unterwegs waren, wie seinen persönlichen Sklaven behandeln wollen. Ich bin kein junger Hund, den er mit Füßen treten kann; ich bin Running-Fox!“
„Vergiss ihn, ich mag ihn auch nicht“, kam es voller Abscheu von ihr. Das stimmte nur zu gut. Er war ihr immer mit äußerster Unfreundlichkeit begegnet. „Ich sollte jetzt gehen, Großmutter wartet sicher auf mich.“
Wahrscheinlich eine Ausrede, glaubte Running-Fox und hielt sie zurück. „Ich habe ein Geschenk für dich.“
Aufstehend zog er sie mit sich hoch. Umständlich schob er den Ärmel seines Hemds zurück.
Darunter kamen, über seinen Unterarm verteilt, verschiedene silberne Armreifen zum Vorschein. Einen davon nahm er ab. „Hier – ich denke, er steht dir besser als mir. Bitte trage ihn für mich.“
Sie betrachtete das Schmuckstück aus sehr dünnem, fein gearbeitetem Silber. Es bestand aus je drei Runden zweier miteinander verschlungener Schlangen, die sich in die Köpfe bissen. Running-Fox bog den Armreif kurzerhand auseinander, machte ihn schmaler, so dass die Schlangen sich nicht mehr bissen, sondern ihre Köpfe übereinander lagen. So streifte er ihn ihr über das Handgelenk. Verlegen drehte er es hin und her, während er sie fragte, ob der Schmuck ihr gefalle. Zögernd schob sie die Ringe weiter nach vorn, als wollte sie sie ihm wieder zurückgeben. Tu es nicht, hämmerte es in ihrem Kopf, – tu es nicht, du bereust es, wenn du das hier nicht annimmst! Außerdem wäre es eine Beleidigung. Noch immer zögerte sie. Er verdiente die Wahrheit. Welche Wahrheit? Ihr schwirrte der Kopf, und eine tiefe Röte bedeckte ihr Gesicht. Diesmal war diese Röte stärker als ihre Bräune. Er bemerkte es, schob es aber auf ihre Verlegenheit. Sein Blick verlor sich in ihren blauen Augen; in seinen brannte ein Feuer.
Die Knie wurden ihr weich. Sei doch ehrlich, ermahnte sie sich, wie schon so oft in den letzten Tagen. Ihr Herz begann wie wild zu hämmern. Willst du immer noch einem Traum nachhängen – einem Traum, der nie wahr werden wird? Stell dich endlich der Wahrheit, lass nicht zu, dass ein Wunschtraum dein Leben zerstört. Du hast dich ja schon entschieden; schau Running-Fox an, er ist wirklich, er ist hier bei dir. Lass endlich los. Am Ende dieser Gedanken brauchte sie nicht länger für ihre Entscheidung als einen Herzschlag. Und wenn ich es bereue? Der nächste Herzschlag. Dann ist es eben so, noch einer. Wenn sie jetzt sein Geschenk annahm, dann war das wie ein endgültiges Versprechen, mehr noch als alles zuvor. Sie schluckte.
Sie in ihren Gedanken unterbrechend, fragte er noch einmal: „Gefällt es dir? Wirst du mein Geschenk tragen? Wirst du an mich denken, wenn es im Feuerschein an deinem Arm glitzert? Wenn die Sonnenstrahlen sich darauf spiegeln? Oder der Mond?“ Das Feuer in seinen Augen brannte noch immer.
Ihr Herzschlag normalisierte sich. Ja, dachte sie – ja, dann soll es so sein. Vielleicht hört dann dieser Schmerz auf, von dem sie wollte, dass er endlich aufhörte. Ein Schmerz, der sie zerriss, der ihr die Luft abschnürte und den Atem nahm, wann immer sich ihre Wege kreuzten. Ich will, dass es mir gleichgültig ist, wen er anlächelt, hämmerte es in ihrem Kopf. Soll er doch mit Magic-Flower oder jeder, die er will, glücklich sein – soll er doch! Ich habe Running-Fox.
Entschlossen streifte sie die Silberringe über ihr Handgelenk bis hinauf zum Ellbogen. Eine geschlängelte Brandnarbe, die vom Oberarm bis dorthin reichte, berührte fast einen der Schlangenköpfe. „Ich werde dein Geschenk tragen, mich an seinem Glitzern erfreuen, wenn die Sonne darauf scheint oder der Mond. Wenn ich am Feuer sitze, wird mich sein Glanz an dich erinnern, bis wir uns wiedersehen“, fand sie ihre Sprache wieder.
„Das wird bald sein“, versprach er bestimmt. „Wenn der Schnee schmilzt und das Büffelgras wächst. Ich werde es nicht riskieren, dass ein anderer kommt und dich mir wegschnappt. Euer Lager – egal, wo es auch sein wird – ich werde es finden.“ Erleichtert stieß er die Luft aus und strich mit dem Handrücken über ihre gerötete Wange.
„Aber jetzt muss ich wirklich gehen, Running-Fox“, drängelte sie. Verlegen schob sie ihn von sich weg.
Er wollte sie nicht gehen lassen. Entschlossen legte sie die Hand an seine gezackte Narbe und fuhr mit dem Zeigefinger daran entlang. Wie erstarrt ließ er diese Zärtlichkeit über sich ergehen, fühlte sie bis in die letzte Faser seines Körpers. Es war ihr Anblick, dieser eine Moment, den er niemals mehr vergessen sollte. Mit ihrem Finger auf seiner Narbe hatte sich sein ganzes Leben verändert. Jetzt gehörte sie ihm. Er würde wiederkommen und sie holen.
Summer-Rain lächelte. Sanft strich sie über seine schiefe, nicht richtig zusammengewachsene Nase. Da hielt es ihn nicht länger. Seine Lippen bewegten sich wie der Flügelschlag eines Adlers. Er beugte sich über sie und zog sie voller Leidenschaft ans sich. Diesmal wehrte sie sich nicht. Weiter jedoch ging er nicht. Lange standen sie so beisammen, aneinandergedrängt und still. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals, doch es tat nicht weh. Jetzt, da sie ihre Entscheidung getroffen hatte, musste alles leichter werden. Es musste, sagte sie sich voller Zuversicht.
Plötzlich aber war da ein Schatten, ein nicht greifbarer Schatten, der sich auf sie legte – auf sie und Running-Fox, den Cheyenne.
Er hielt sie fest; voller Wehmut dachte er an die bevorstehende Trennung, und auch Summer-Rain fühlte Traurigkeit bei diesem Gedanken. Es war gut so, in seinen Armen. Sie hätte es nicht als Liebe bezeichnen können, was sie fühlte, wenn jemand gefragt hätte – aber es fühlte sich richtig an. So richtig, dass sie einfach nur glücklich war. Endlich löste er die Arme von ihr, beugte sich über sie und berührte ihre Stirn mit seinen Lippen. „Morgen vor Sonnenaufgang reite ich auf Büffeljagd.“ Behutsam fasste er ihre beiden Hände in seiner einen zusammen. „Da wird es kaum eine Gelegenheit geben, dass wir uns sehen. Danach muss ich fort. Ich habe es meinem weißen Vater, der mir wichtig ist, versprochen. Gib ein wenig Acht auf Dark-Night.“
Mit gesenktem Blick auf ihre Füße nickte sie. „Das werde ich tun, Running-Fox. Jetzt lass mich gehen, bitte.“
Zögernd gab er ihre Hände frei. Ihn anblickend trat sie zurück und griff nach dem leeren Wassersack. Er wollte sie noch ein letztes Mal an sich ziehen, sie festhalten, den Abschied hinauszögern – da ertönten plötzlich ganz in der Nähe vom Hauptweg her laute Trommelschläge.
„Der Tanz für die Büffel, er beginnt bereits.“
Lächelnd wischte sie sich eine Träne, die ganz verstohlen über ihre Wange kullerte, weg und wand sich aus seiner Zärtlichkeit. Schon war sie den Abhang hinunter, den leeren Wassersack unter dem Arm. Noch einmal drehte sie sich nach ihm um. Seine hochgewachsene Silhouette hob sich von der Umgebung dunkel ab. Die Bäume, die in seinem Rücken standen, warfen lange Schatten in die beginnende Nacht. Er blieb stehen und blickte ihr nach.
Der Mond war gerade aufgegangen und beleuchtete ihre Gestalt. Seufzend starrte er auf ihr Hinterteil, das sich in ihrem Lederkleid spannte. Einige ihrer Freundinnen kamen ihr entgegen und umringten sie lachend.
Er stand noch lange dort. Ihm würde nichts weiter übrig bleiben, als sein Nachtlager aufzusuchen. Diese letzte Nacht hätte er gern mit ihr verbracht. Sollte er sich zu den Feiernden gesellen? Ihm war nicht danach zumute. Running-Fox, der Cheyenne, hatte nicht vor, an den Tänzen teilzunehmen, die die ganze Nacht andauern würden. Er konnte ja zusehen, ihr dabei zusehen. Er wusste jetzt schon, dass er sie nicht aus den Augen lassen würde. Comes-Through-The-Summer-Rain. Ein zufriedenes Lächeln umspielte seine schön geschwungenen Lippen.
Hergekommen war er voller Wut auf diesen Mann, der herzlos und steinhart zu sein schien. Der ihn mit seiner Arroganz beschämt hatte. Eigentlich wollte er nur sein Versprechen halten und Dark-Night sicher abliefern. Wie sie dann hier zurechtkommen würde, fiel nicht mehr in seinen Aufgabenbereich. Jetzt hatte sich mit einem Mal sein ganzes Leben verändert. Bevor er wieder von hier fortreiten würde, musste er unbedingt noch mit ihrem Bruder reden. Es war ihm nicht entgangen, wie gut sich die beiden verstanden. Light-Cloud war das Oberhaupt ihrer Familie. Würde er ihm Schwierigkeiten bereiten, wenn er um sie anhielt? Er hoffte, nicht.
Nachdenklich stellte er sich in den Schatten der Bäume, um den Tänzern zuzusehen. Summer-Rain erschien erst sehr viel später am Rande, bescheiden und zurückhaltend, so wie es ihre Art war. Sie hat keine Ahnung, dachte er verblüfft, welche Wirkung sie auf die Männer hat. Natürlich entgingen ihm die Blicke nicht, die ihr manch einer zuwarf. Nur Blicke, mehr nicht. Es war ihre unnahbare Art, die die Männer abschreckte; das sah er sofort. Befriedigt über diesen Abstand, den sie sich unbewusst verschaffte, wurde ihm das Offensichtliche klar. Niemand hier holte sich gern in aller Öffentlichkeit eine Abfuhr – und schon gar nicht diese arroganten, von sich eingenommenen Comanchen. Ihre Freundinnen sah er ebenfalls. Einige der jungen Männer begutachteten ganz ungeniert das Angebot. Summer-Rain machte endlich ebenfalls ihre ersten Tanzschritte, ließ sich in den Kreis mit hineinziehen, in all die Freude und das Lachen ringsum. Ihm begann das Herz laut zu klopfen. Sie weiß es wirklich nicht, erkannte er, ohne auch nur einmal seine Augen von ihr zu lassen. Sie ist etwas Besonderes – wer das nicht erkannte, musste blind sein.
Das flackernde Feuer in der Mitte des Platzes malte einen rotgoldenen Schein auf ihr Haar. Anmutig warf sie es nach hinten auf den Rücken, sich weiter bewegend, mal im Schatten, mal im Licht. Da löste sich ein junger Krieger aus dem inneren Kreis der Tänzer, ging außen herum auf sie zu. Running-Fox konnte sein Gesicht sehen. Genau wie er selbst ließ auch dieser sie nicht aus den Augen. Doch bevor er sie erreichen konnte, stellte sich ein hübsches junges Mädchen ihm in den Weg. Kokett wiegte sie ihren Körper vor ihm hin und her. Mit einer Handbewegung forderte sie ihn auf, an ihrer Seite weiterzutanzen. Er wollte an ihr vorbei, aber sie ließ es nicht zu. Dann, als es ihm endlich gelang, war der Platz, an dem Summer-Rain eben noch getanzt hatte, leer. Der Andere blickte sich suchend nach ihr um, konnte sie aber nirgends mehr entdecken. Sichtlich enttäuscht verließ er die Tanzenden.
Running-Fox sah ihn im Dunkeln verschwinden, doch auch er selbst hatte Summer-Rain aus den Augen verloren. Ein einziger unaufmerksamer Moment hatte genügt, sie ihnen beiden entwischen zu lassen.
Der Name des jungen Kriegers fiel ihm ein. Storm-Rider. Du kommst zu spät, mein Lieber – viel zu spät.
Running-Fox wartete noch, aber als Summer-Rain nicht wieder auftauchte, verließ auch er den Platz.
Als er am Tipi von Light-Cloud vorbeikam, sah er sie davor sitzen, zusammen mit ihrer Großmutter. Befriedigt zog er sich zurück. Gut so, dachte er. Was der Andere auch vorgehabt haben mochte, er war nicht zum Ziel gekommen. Comes-Through-The-Summer-Rain gehörte ihm.