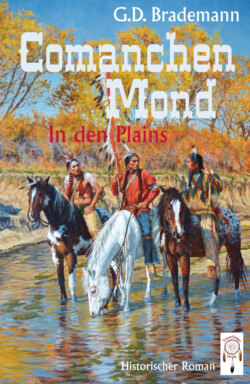Читать книгу Comanchen Mond Band 1 - G. D. Brademann - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 10
ОглавлениеNach der Büffeljagd, an der er auf Einladung der Krieger teilgenommen hatte, blieben ihm und Summer-Rain nur noch wenig gemeinsame Zeit. Running-Fox hatte seinen Aufbruch zwar noch etwas verschoben, jedoch nicht für lange. Ihn drängte es fort. Das gesamte Lager war tagelang damit beschäftigt gewesen, die erlegten Büffel so schnell wie möglich zu verarbeiten. Da wurde jeder Einzelne gebraucht – sogar die Kinder bekamen zu tun. Während dieser Zeit fiel Running-Fox auf, dass Storm-Rider nicht mehr da war. Als hätte der Erdboden ihn verschluckt, blieb er verschwunden. Natürlich konnte er niemanden fragen, also nahm er an, dass er sich mit zwei Männern auf der Suche nach weiteren Büffeln befand, denn Gray-Wolf und Raven-Feather fehlten ebenfalls.
Summer-Rain wurde von ihren Freundinnen offen um den stattlichen fremden Krieger beneidet. Das war eine ungewohnte Situation für sie. Anfangs war ihr das sichtlich peinlich. Dann genoss sie es, auch einmal im Mittelpunkt zu stehen. Nur Großmutter schüttelte den Kopf über das Treiben der Mädchen. Sie behauptete allen Ernstes, dass das in ihrer Jugend anders gewesen wäre – was natürlich nicht stimmte.
Nachdem der Großteil der Jagdbeute verwertet worden war, gab es nicht mehr ganz so viel zu tun. Die Tage wurden wieder mit den allgemein üblichen Arbeiten ausgefüllt. Light-Cloud, den die Sache mit seiner Schwester und Running-Fox kalt erwischte, da er wohl andersweitig abgelenkt gewesen, hatte eine lange und peinliche Unterredung mit ihr. Dass diese Angelegenheit, wie er es nannte, schon so weit fortgeschritten war, musste ihm entgangen sein. Er machte keinerlei Schwierigkeiten, als Running-Fox ganz offiziell bei ihm vorsprach. Lange wurde in seinem Tipi verhandelt. Dabei rauchten sie zusammen und aßen Mengen von wunderbar zubereitetem Fleisch, das Großmutter mit anderen Leckereien herbeizauberte. Am Ende wurden fünf Pferde als Brautpreis festgelegt.
Seinen Abschied hätte Running-Fox gerne noch weiter hinausgezögert; alles ging ihm viel zu schnell. Ehe er richtig zur Besinnung kommen konnte, befand er sich bereits auf dem Weg aus dem Lager. Eines jedoch hatte ihm weder Großmutter noch Summer-Rain mitgeteilt. Sie befanden es einfach nicht für notwendig. Noch ging es ihn nichts an, was die kleine Antilopenbande mit seinem Mädchen, seiner Summer-Rain vorhatte. Denn zu diesem Zeitpunkt war sie nur ihren Leuten Rechenschaft schuldig. Und so ahnte er nichts von ihren Plänen, sie in das Colorado-Territorium zu schicken. Wäre er fortgeritten, wenn er das gewusst hätte? Wohl kaum.
Eine seiner Satteltaschen war von Großmutter mit Nahrungsmitteln bis zum Rand vollgestopft worden. Damit würde er bis zu seiner Rückkehr auskommen, hatte er scherzhaft gemeint. Am Abend zuvor war er ein letztes Mal mit Summer-Rain allein gewesen. Natürlich musste er sich auch von Great-Mountain verabschieden, der es sehr bedauerte, ihn ziehen zu lassen. Der Cheyenne war ihm in mancherlei Hinsicht wertvoll geworden. Schon allein seine Kenntnisse über die Weißen hatten ihn oftmals verblüfft.
Nun, da er das Lager hinter sich gelassen hatte, ließ sich Running-Fox all die Ereignisse der letzten Zeit noch einmal durch den Kopf gehen. Seiner rostroten Stute die Richtung angebend, saß er ganz entspannt im Sattel. Ohne Ersatzpferd musste er sein Tier ohnehin schonen. Seine Gedanken schweiften zu seinem weißen Ziehvater, und er fragte sich, was der wohl zu Summer-Rain sagen würde. Sein weißer Vater – oh ja, er war von einem Mann namens Erik Machel adoptiert worden. Ihm verdankte er sein Leben. Ohne ihn wäre er im Alter von zwölf Wintern gestorben. Seitdem kümmerte sich dieser Mann um ihn wie um seinen eigenen Sohn. Wenn Running-Fox an seinen leiblichen Vater dachte, dann sah er immer zuallererst einen hochgewachsenen Cheyenne-Krieger vor seinem inneren Auge, der mit ihm jagen ging, der ihn in allem unterwies, was ein Junge wissen sollte; und doch hatte er ihn maßlos enttäuscht.
Bis zu dem Zeitpunkt der schlimmen Ereignisse, die ihn beinahe das Leben gekostet hatten, war er bei seinen Leuten am Smoky Hill gewesen. Ein normaler, heranwachsender Cheyenne-Knabe eben – mit allem, was dazugehört. Dann kam der Tag, an dem sein Vater ihn, die Mutter und die kleine, sieben Winter zählende Schwester sich selbst überließ. Es war eine Entscheidung, die sein Vater einzig und allein für sich traf und die ihr aller Leben verändern sollte. Schon damals hatte er die Entscheidung des Vaters nicht verstanden. Bis heute machte es ihn wütend, wenn er daran dachte. Noch immer war er der Überzeugung, dass der Vater sie alle hätte mitnehmen können. Seine Beweggründe, es nicht zu tun, beruhten schlicht und einfach auf der Tatsache, dass eine Familie ihn in seinen Entscheidungen eingeengt hätte. Ein Klotz am Bein sozusagen, hätte sein weißer Vater es genannt. Kinder und eine Frau hatten in den Plänen dieses Vaters keinen Platz. Statt Verantwortung für sie zu übernehmen, entschied er sich dafür, sie wegzuschicken. Vielleicht tat er ihm ja Unrecht. Jetzt, nach so viel vergangener Zeit, konnte er ihn ein bisschen besser verstehen. Doch er trug ihm das immer noch nach.
Damals, in den kriegerischen Zeiten von 1864, sollten sich alle Cheyenne in Fort Lyon melden, dort ihre Waffen abgeben, um sich dann von da aus zu einem Ort zu begeben, den der Weiße Mann für sie bestimmt hatte. So gedachten sie, den Krieg mit den Cheyenne ein für alle Mal beenden zu können. Die, die nicht bereit waren, sich an diese Anordnung zu halten, sollten sterben – schlicht und einfach totgemacht werden, ausnahmslos. Eine unmissverständliche, klare Ansage. Die Jagd auf das Volk der Cheyenne – auf menschliches Wild, auf Frauen und Kinder, Alte, Verletzte, Kranke – war damit ganz offiziell eröffnet. Es war nichts weiter als ein Freibrief für alle Weißen, jeden Cheyennen, den sie ansichtig wurden, umzubringen. Niemand würde Fragen stellen, niemand würde sie dafür verurteilen können. Ein Cheyenne war weniger wert als ein Stück Vieh, dessen Haut man wenigstens noch zu Geld machen konnte.
Sein Vater, Mitglied der Kriegervereinigung Hotamitanio, der Hundesoldaten, einer Elitekampftruppe sozusagen, schlug sich auf die Seite derer, die nicht bereit waren, sich dem Weißen Mann zu unterwerfen – die nicht nach Fort Lyon ziehen und sich ergeben wollten. Aber er schickte seine Familie zu Häuptling Black-Kettle, der sich mit seinen Leuten auf den langen Marsch nach dorthin aufmachte. Er selbst blieb bei Tall-Bull und Roman-Nose am Smoky Hill. Vielleicht nahm er ja an, seine Familie so in Sicherheit gebracht zu haben. Doch mit dieser Entscheidung lieferte er sie geradewegs der Willkür der Weißen aus. Womöglich hatte er sogar keine andere Wahl. Als Mitglied der Hotamitanio war er seinem Kriegerbund verpflichtet. Er, Motseske-Hetane, musste sich entscheiden – und sein Weg war der Krieg. Was Running-Fox auch immer über ihn denken mochte, sein Vater konnte damals nicht wissen, dass er seine eigene Familie damit in die Vernichtung schickte. Denn seine Mutter und die kleine Schwester waren im Gemetzel am Sand Creek gestorben.
Erik Machel, der nur zufällig dort hineingeraten war, hatte ihn unter Einsatz seines eigenen Lebens herausgebracht und auch danach noch Verantwortung für ihn übernommen. Weil er wieder zurück in den Krieg musste, ließ er ihn, den zwölfjährigen Jungen, in der Obhut einiger Comanchen zurück, die damals im Texas Panhandle lebten. Dort in der Nähe befand sich die ehemalige Handelsstation seiner Eltern, die jedoch schon lange verlassen war. Ausgerechnet bei den ehemaligen Todfeinden der Cheyenne fand der traumatisierte Junge einen sicheren Zufluchtsort. Nach dem Ende des Bruderkrieges mit dem Süden kam Erik Machel zurück, um ihn zu sich zu nehmen. Von seinen Verwandten, den Cheyenne, fanden sie keine einzige Spur, so oft Erik auch nachforschte.
Die Cheyenne, die damals nicht mit Black-Kettle gezogen waren, hatten sich mit den Oglala-Sioux und einer großen Gruppe der Northern Arapahos verbündet. Auch auf Grund der Ereignisse vom Sand Creek, des Wortbruchs der Weißen auf Frieden, der unerbittlichen Jagd auf ihr Volk tobte inzwischen entlang des South Platte ein blutiger Indianerkrieg. Unter denen, die dort Wagenkolonnen und Poststationen überfielen, sämtliche Nachrichten- und Versorgungsverbindungen bis nach Denver hin kappten, befand sich wahrscheinlich auch sein Vater.
War er zum Sand Creek gekommen, um nach seiner Familie zu suchen? Diese Frage hatte ihn damals oft gequält. Heute interessierte ihn das schon lange nicht mehr. Mit diesem Thema war er fertig – und auch mit seinem leiblichen Vater. Erik, der ihn vor einigen Jahren ganz offiziell adoptiert hatte, war jetzt sein Vater. Running-Fox sprach neben seiner Geburtssprache Cheyenne auch fließend Comanche und natürlich Englisch. Er konnte sogar lesen, schreiben und rechnen, was ihm gegenüber den meisten Menschen damals einen Vorteil verschaffte. Erik Machel hatte ihm zwei Jahre lang über längere Zeiträume hinweg einen Privatlehrer finanziert. Dieses so erworbene Grundwissen genügte, um ihm die Welt der Weißen begreiflich zu machen. Diese Welt war erschreckend groß und mächtig. Dass er Jeremiah Machel hieß, gefiel ihm zuerst gar nicht. Doch mit der Zeit gewöhnte er sich daran, und heute war er sogar stolz auf diesen Namen.
Wenn er beim Volk der Comanchen war – Machel brachte ihn auch nach dem Bürgerkrieg noch oft zu ihnen, um ihn seinen indianischen Wurzeln nicht zu entreißen – nannte er sich Running-Fox. Mit vierzehn Jahren hatte er dort seine Kriegerprüfung abgelegt. Drei Jahre später, als er 17 war, nahm ihn Erik mit nach Wyoming, wo sie sich gemeinsam eine Ranch aufbauten. Anfangs mussten sie sich dort gegen die Crow und die Shoshonen zur Wehr setzen, auf deren Land sie siedelten. Natürlich war das Unrecht. Doch sie dachten nicht weiter darüber nach, zudem dieses Land so unermesslich groß vor ihnen ausgebreitet lag – Platz genug für sie alle. Shoshonen und Crow vertrugen sich nicht, diese Tatsache machten sie sich zunutze. Running-Fox fand nichts dabei, gegen sie zu kämpfen. Er wusste noch aus den Erzählungen seiner Leute, dass die Crow schon immer zu den Todfeinden der Cheyenne gehörten – in seinen Augen also kein Grund, besondere Rücksicht auf sie zu nehmen. Doch allmählich begannen sich in Jeremiah, wie sein Vater ihn nannte, Zweifel zu regen. Es war Unrecht, was sie taten – dasselbe Unrecht, das die Siedler in das Land der Comanchen trieb. Nach einem ereignisreichen Herbst, in dem es Verletzte auf beiden Seiten gab, vielen schlaflosen Nächten und durchwachten Tagen, an denen sie die Gewehre niemals aus der Hand legen konnten – auch nicht während sie aßen oder schliefen – rauchten sie die Friedenspfeife mit den Crow.
Danach hatten sie ein für allemal Ruhe vor ihnen, denn sie zogen sich nach Norden in die Berge zurück; doch die Shoshonen lebten immer noch dort. Es kam vor, dass sie sich das eine oder andere Rind holten. Das nahm man in Kauf. Inzwischen besaßen sie so viele Rinder, dass sie die genaue Zahl gar nicht mehr kannten. Es ging ihnen gut. Das weite Land lag groß und grenzenlos vor ihnen. Mit den dort noch lebenden Indianern kamen sie aus. Was konnten sie mehr verlangen? Jetzt wollte sich Running-Fox mit seinem weißen Vater treffen, obwohl er am liebsten auf der Stelle wieder umgekehrt wäre. Die Sehnsucht nach Summer-Rain nagte bereits an ihm, während er die erste Flussbiegung hinter sich hatte. Doch sein Ziel hieß jetzt unwiederbringlich Fort Lyon. Dort wollte er sich, wie vor einem halben Jahr ausgemacht, mit seinem weißen Vater treffen. Wenn seine Zeitrechnung stimmte, dann wartete der bereits seit über einem Mond dort auf ihn. In den letzten Tagen seines Daseins im Lager der Comanchen hatte er immer wieder hin und her überlegt, ob er dieses Treffen nicht einfach aus seinem Kopf streichen und bleiben sollte. Doch er war nicht der Mann, der ein einmal gegebenes Wort ohne zwingende Gründe brechen würde. Er wusste, dass er mit Erik zurück nach Wyoming musste, um dort nach dem Rechten zu sehen. Die Ranch gehörte ihnen zu gleichen Teilen, darauf hatte Erik von Anfang an bestanden. Wenn er weiter mit ihm zusammenarbeiten und -leben wollte, dann musste auch er sich darum kümmern.
Jetzt erschien ihm sein Zuhause in Wyoming umso wichtiger, da er sich mit dem Gedanken trug, Summer-Rain nach dort mitzunehmen. Es wird ihr nicht passen, ihre Leute zu verlassen, befürchtete er. Hatte sie denn eine andere Wahl? Wenn er das nächste Mal – im späten Frühling oder Anfang Sommer, wie er hoffte – wieder bei ihr sein würde, dann mit fünf Pferden. Als seine Frau musste sie dorthin gehen, wohin er ging. Wyoming mit der Ranch wird ihr gefallen, davon war er überzeugt.
Die Herbststürme ließen ihn nur langsam vorwärtskommen. Immer wieder peitschte der Wind über die Plains, und die ersten Stürme erreichten ihn, bevor er das Panhandle-Gebiet hinter sich lassen konnte. Trotz seiner Eile machte er zuvor noch einen Umweg dorthin, wo er einen Großteil seiner Jugend verbracht hatte. Unbehelligt von herumstreifenden Kriegerbanden der Comanchen, denen er nur einmal begegnete, kam er dort an. Die Überreste der verlassenen Handelsstation von Eriks Eltern, die bei einer Pockenepidemie ums Leben gekommen waren, standen noch.
Als Anfang der 1850er-Jahre die Goldfunde in Kalifornien Tausende von Menschen hauptsächlich über den Santa Fe Trail in den Westen lockten, brachten sie todbringende Krankheiten mit auf die Plains. Running-Fox kannte unzählige Geschichten, die von den damaligen Zeiten handelten. Seine Pflegeeltern, denen Erik ihn anvertraut hatte, erzählten sie ihm in kalten, einsamen Nächten, während sich der Schnee draußen vor den Tipis staute. Ganze Stämme wurden von den Krankheiten der Weißen dahingerafft. Die Fremden brachten unfassbares Leid in die Plains.
Damit noch nicht genug. Unter denen, die an diesen Krankheiten starben, befanden sich fast alle Friedenshäuptlinge. Ironischerweise waren sie es ja hauptsächlich, die sich um ein friedliches Auskommen bemüht hatten, zumal die Vorkommnisse zehn Winter zuvor bei Friedensverhandlungen in San Antonio noch nicht vergessen waren. Ihr Fehlen und ihr Einfluss riss eine riesige Lücke in das Gemeinschaftsgefüge der Comanchen. Nicht nur das. Jetzt fehlten die Vermittler zwischen der Welt der Indianer und der der Weißen. Das sollte sich in den kommenden Jahren bitter rächen. Die Weißen waren damals durch das Gebiet der Indianer gestürmt wie hungrige Wölfe auf der Jagd. Ohne Rücksicht, ohne Erbarmen – sogar mit dem Wissen, die todbringenden Krankheiten in die Tipis zu bringen. Es war ihnen ganz einfach nur egal.
Running-Fox, alias Jeremiah Machel, erinnerte sich an all das, während er die Ruinen der ehemaligen Handelsstation von Eriks Eltern umrundete. Auch an das, was ihm sein weißer Vater von seiner eigenen Jugend erzählt hatte. Erik, gerade sechzehn Jahre alt, überlebte wie durch ein Wunder die Pocken. Er wurde nicht einmal von ihnen gezeichnet. Nachdem er seine Eltern begraben hatte, ritt er einfach – mit Vorräten versehen und mit drei Ersatzpferden im Schlepp – nach Westen. Als er auf eine kleine Horde Comanchen traf, die sich gerade auf einer Wanderung in der gleichen Richtung wie er bewegte, schloss er sich ihnen wie selbstverständlich an. Nach einem Jahr in ihrer Gesellschaft trieb es ihn wieder weiter. Er verdingte sich als Wagenführer oder ritt mit irgendwelchen Indianern, auf die er gerade traf, zu ihren Lagern, um eine Weile bei ihnen zu leben. Der heranwachsende Junge war überall zu Hause und hatte doch keines. Einmal zog er mit einem der großen Viehbarone, die in Kansas ihre Rinder verkauften, zurück in den Südwesten von Texas. Dieser Mann war einer der wenigen, die mit großem Aufgebot in Neu-Mexiko lebten, dort Viehzucht betrieben und sich bis tief in die Comancheria vorwagten, ohne von den Comanchen groß behelligt zu werden. Eriks frühere Beziehungen zu diesen Indianern kamen ihm nun zugute. Er hielt Verbindungen zu den Apachen wie zu den Comanchen, handelte, als der Krieg ausbrach, mit der Armee der Vereinigten Staaten um Vieh und Pferde, die nicht immer legal erworben waren. Lebte davon, aalglatt mit allen Beteiligten zu verhandeln. Mit Hilfe des Mannes, der ihn in die Kreise der einflussreichen Viehbarone eingeführt hatte, legte er den Grundstein zu einem Vermögen, mit dem er später zum größten Teil seine eigene Ranch in Wyoming finanzieren konnte. Ihm, Erik Machel, dem armen Waisenjungen aus Texas mit seinen Sprach- und Ortskenntnissen, oblag es, von der Grenze Neu-Mexiko-Texas Rinderherden der Viehbarone völlig unbehelligt durch Comanchengebiete zu treiben. Das raue Leben unter den Cowboys und den Mexikanern, das Stampfen der Pferde in der Remuda, wenn er hinter der staubigen Herde ritt oder ganz einfach ihnen die verborgenen Wasserstellen in einem durchaus fruchtbaren Gebiet, das die Weißen als Wüste bezeichneten, zeigte, lag ihm eher als ein Leben in der Stadt.
Als der Bürgerkrieg bereits ein Jahr andauerte, meldete er sich zur Unionsarmee, was keiner seiner ehemaligen Arbeitgeber verstand. Doch seine Beweggründe waren ganz einfach: Mit der arroganten, menschenverachtenden, hochmütigen Art der Südstaatler, die er bei seiner Arbeit kennengelernt hatte, konnte er nichts anfangen. Ja, er hasste sie oft genug dafür, wenn er mitbekam, wie sie ihre Leute, vor allem die Sklaven, behandelten. Ihr Standesdünkel war ihm ein Gräuel. Für ihn war das eine eigene, zusammengeschweißte Kaste, die davon überzeugt war, ohne die übrige Menschheit auskommen zu können. Dass er die Sklaverei verabscheute, daran ließ er oft genug keinen Zweifel.
In der Unionsarmee brachte er es bald bis zum Leutnant. Er schloss sich dem zweiten Iowa-Kavallerieregiment an und diente unter Oberst Grierson. Im Mai 1863 war er beim Ritt durch Louisiana nach Baton Rouge dabei. Er beteiligte sich an Banks Belagerung von Port Hudson, war inzwischen ein enger Freund von Grierson geworden, der dort als Kommandeur der Reiterei des XI. Korps fungierte. Er wurde verwundet, kehrte aber 1864 zu den Truppen von Grierson zurück, um sich in der Kavallerie, die sein Freund befehligte, an der Schlacht von Tupelo in West-Tennessee zu beteiligen. Diesmal waren seine Verwundungen so schwer, dass er sich für einige Wochen auskurieren musste. Deshalb folgte er der Einladung eines befreundeten Armeearztes, der in derselben Truppe wie er gedient hatte, ins Colorado-Territorium. Wegen seines verletzten Beins war Dr. Kamp, wie sein Freund hieß, zurück zu seinem damaligen Zuhause, nahe Denver, gereist. Auf dem Weg dorthin geriet Erik mitten hinein in den Krieg gegen die Cheyenne.
Weil er anders als die meisten Weißen über die Indianer dachte, hatte er sich viele Feinde gemacht. Nach den Ereignissen vom November dieses Jahres ging Erik sogar so weit, sich öffentlich darüber zu äußern. Er prangerte ohne Scheu vor Konsequenzen die Fehleinschätzungen eines Major Scott Anthony und diesem schwachsinnigen Blödmann, wie er ihn nannte, Chivington, an. Ja, er verurteilte ihre Handlungsweise hart – ohne Rücksicht auf seine eigene Existenz. Dass er als Lügner und Nestbeschmutzer bezeichnet wurde, sogar Todesdrohungen erhielt, nahm er in Kauf, denn er hatte alles mit eigenen Augen gesehen, am eigenen Leib erfahren.
Wenn er von einer besoffenen Miliz sprach, die die Frauen und Kinder der Cheyenne hingemetzelt hatte, dann wusste er, wovon er redete. Er war ihnen begegnet, war durch Zufall in das Massaker am Sand Creek geraten. Das war am bitterkalten Morgen des 29. November 1864 gewesen. Als eben dieser neuernannte Kommandeur Scott Anthony mit dem Dritten Colorado Kavallerieregiment, vier Zwölfpfünder-Gebirgshaubitzen und mit Verstärkung, die aus. 600 Mann von Colonel Chivingtons Regimentern bestand, über das Lager der friedlichen Cheyenne am Sand Creek herfiel. Im Nachhinein erfuhr Erik aus einer sicheren Quelle, dass Anthony zuvor diese Indianer persönlich von Fort Lyon zum Sand Creek geschickt hatte mit der Versicherung, sie stünden dort unter dem Schutz der Armee.
Running-Fox saß, während ihm das alles wieder durch den Kopf ging, auf einem umgestürzten Stück Palisade vor dem zerfallenen Blockhaus von Eriks Eltern. Er wusste von ihm viel über diesen Tag im November. Er selbst hatte natürlich keine Ahnung, warum das alles passiert war, bis Erik ihm die Zusammenhänge erklärte. Jetzt, auf diesem alten, verlassenen, zerfallenen Gelände, wo vor über zwanzig Jahren Menschen unterschiedlicher Herkunft friedlich miteinander umgegangen waren, erinnerte er sich auch dank Erik wieder.
Sand Creek – alle, die mit Black-Kettle dorthin gezogen waren, hatten ihre Waffen abgeben müssen. Danach befanden sich im Lager nur noch drei Gewehre, eine Pistole und sechzig Bogen mit nur wenigen Pfeilen. Das hatte eine spätere Zählung der Armee ergeben. Scott Anthony, der genau wusste, was er tat, hatte Tage zuvor in weiser Voraussicht die Krieger aufgefordert, nach Norden zu ziehen, um dort Büffel zu jagen. Es war also niemand da, der seinen Überfall ernstlich gefährden konnte. Nichts stand seinem und Chivingstons Vorhaben im Wege. Sie konnten in aller Ruhe Skalps sammeln und in Blut waten, wie sie sich kurz zuvor in Denver noch auszudrücken pflegten.
Erik Machel befand sich im Morgengrauen des 29. November 1864 auf dem Weg zu seinem Freund, dem Doktor. Er hatte eine Abkürzung nehmen wollen und sich dabei heillos verirrt. Kanonendonner und Schüsse ließen ihn sein Pferd wenden. Als er über einen Hügel ritt, stieß er auf Teile eines Trupps Soldaten. Dann sah er hilflos zusammen mit zwei Leutnants, einem Captain und Teilen ihres Dritten Colorado-Regiments, die sich geweigert hatten, an diesem Morden teilzunehmen, dabei zu, was sich dort, direkt vor ihren Augen, abspielte. Die Soldaten, die unter diesem Kommando standen, sagten später aus, dass sie dankbar dafür gewesen wären, keinem Schießbefehl gehorchen zu müssen. Das dort war Mord, davon waren ihre Offiziere überzeugt, und würde die Uniform der Armee entehrt haben.
Das Bild, das sich Erik damals bot, konnte er sein ganzes Leben lang nicht vergessen. Auch nicht die Erinnerungen an die Schreie der Menschen, an die Toten, die zu Hauf danach dort lagen. Running-Fox konnte es auch nicht. Nach Zählung der toten Indianer – Chivington protzte mit vierhundert – fand man achtundzwanzig tote Männer, fast alle waren alte, sowie einhundertundfünf Frauen- und Kinderleichen. Heraus aus diesem Blutbad kutschierte Erik einen Planwagen, in dem der schwer verletzte Junge, der damals noch Büffelkalb hieß, lag. Er brachte ihn in Sicherheit, ließ ihn zu Running-Fox heranwachsen und später zu Jeremiah Machel werden. Das verwundete Kind brachte er zu seinem Kriegskameraden Dr. Kamp.
Diese ganzen Ereignisse waren jetzt sieben Jahre her. Nun befand sich dieser Junge auf dem Weg nach Fort Lyon, um den Mann zu treffen, der seit diesem verhängnisvollen 29. November die Vaterstelle gegenüber ihm vertrat. Danach musste Erik Machel schmerzlich erfahren, was es hieß, sich gegen die öffentliche Meinung zu stellen. Weil er damit nicht hinter dem Berg hielt, wurde er bedroht, gemieden, man spuckte sogar vor ihm aus. Ja, die Leute gingen auf die andere Straßenseite, wenn er in Denver auftauchte. Running-Fox wusste, dass das auch heute noch vorkam, wenn ihn jemand von damals erkannte. Inzwischen war es Abend geworden, ihn fröstelte. Seine rostrote Stute stand nahe bei ihm und zupfte an dem spärlichen, harten, gelben Gras. Während er weiterritt, begegnete ihm kein einziger Mensch. Alles schien verlassen und öde zu sein. Hier war so viel Platz, dachte er – so viel Land für alle. Warum konnten es die Menschen nicht miteinander teilen?
Die nächsten Tage verbrachte er damit, auf dem schnellsten Weg vorwärtszukommen. Er machte nur spätabends Rast und ernährte sich von den Vorräten, die ihm Großmutter mitgegeben hatte. Der Winter machte sich früh bemerkbar. Die Antilopenbande, so vermutete er, wird bereits auf dem Weg in ihr Winterlager sein, Summer-Rain mit ihnen. Seine Gedanken weilten oft bei seinem Mädchen. Dann malte er sich aus, wie sie jetzt aussehen könnte, was sie gerade tat. Stellte sich voller Sehnsucht vor, wie sie am Feuer saß und sich wärmte, während draußen der Schnee die Ebene bedeckte, fragte sich, ob es ihr genauso wie ihm ging. Er dachte auch an die Ranch, an das gute Leben, das er ihr bieten konnte. Es musste ihr einfach gefallen. In dieser Stimmung sah er, wie er ihr all das zeigte, das weite Land, die Berge, all das. So vergingen die Tage, bis Fort Lyon in Sicht kam.
Die Steinmauern ragten unterhalb der Klippen aus dem Flussbett des Arkansas-River hervor. Er zügelte seine rostrote Stute, sein Lieblingspferd, und betrachtete eine Weile diese trostlosen Bauten.
Dann ritt er weiter, überquerte eine zugefrorene Furt, um unbehelligt durch das breite, unbewachte Tor bis hinein zu gelangen.
Ein breites Lächeln machte sich auf seinem Gesicht breit, weil er wieder daran dachte, was wohl sein Vater dazu sagen würde, wenn er von seinen Plänen erfuhr. Summer-Rain würde ihm gefallen, etwas anderes kam für ihn gar nicht in Frage. Sein Lächeln wurde breiter. Meine Summer-Rain, mein Mädchen. Wie der Flügelschlag eines Adlers bewegten sich seine schön geschwungenen Lippen, während er sich vorstellte, sie bei sich zu haben.