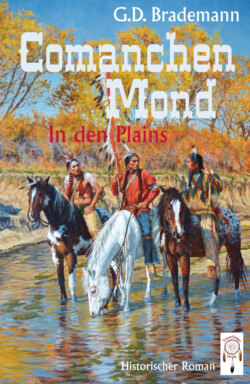Читать книгу Comanchen Mond Band 1 - G. D. Brademann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеWie recht er damit hatte, sollte sich bald zeigen. Um die weiße Frau kümmerte sich während ihres Heimritts keiner der Männer. Es meldete auch niemand einen Anspruch auf sie an. Sie musste selbst sehen, wie sie zurechtkam. Doch sie wurde nicht mehr auf ihrem Pferd festgebunden, und sie konnte kommen oder gehen, wann oder wohin sie wollte. Doch wohin konnte sie sich in dieser für sie völlig neuen, fremdartigen und bedrohlichen Welt wenden? Außerhalb dieser engen Gemeinschaft, mit der sie unterwegs war, erwartete sie der Tod. Es blieb ihr keine Wahl. Was sie am Ende dieses Gewaltrittes in dem Llano Estacado im Lager der Antilopenbande zu erwarten hatte, davon ahnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Dafür wusste sie zu wenig über die Gewohnheiten der Comanchen. Das war auch gut so, denn sonst hätte sie ihrem Leben vielleicht doch noch ein Ende gesetzt.
Wie besprochen zogen die Krieger zum Red-River, um sich und ihre Pferde mit frischem Wasser zu versorgen. Sie tauchten in den Fluss ein, wuschen sich seit Langem wieder gründlich, denn inzwischen konnten sie ihren eigenen Gestank kaum noch ertragen. Erstaunt sah die weiße Frau, wie sie ihre Körper mit Sand einrieben. Damit verschwanden auch die letzten Spuren ihres Kriegszuges. Die Kinder wie auch die Frau taten es ihnen gleich.
Während sie weiterritten, saß das kleine Mädchen zusammen mit Sun-In-The-Red-Hair auf einem Pferd. Die beiden Brüder ritten schon seit einiger Zeit auf eigenen Mustangs. Es hatte ganz den Anschein, als hätten sie sich mit der neuen Situation bereits abgefunden. Nachdem sie sich nach Westen gewandt hatten, überquerten sie die Caprock-Steilhänge, die das texanische Hügelland von dem Llano Estacado trennten, passierten die unzugänglichen Felsformationen, die die Hochebene umgaben und wie Palisaden aussahen. Die Weißen nannten sie daher Staked Plains. Die Quelle, die sich aus unterirdisch hervorsprudelndem Wasser speiste, fanden sie trotz Red-Eagles Befürchtung unversehrt vor. Sie tränkten ihre Ponys ein letztes Mal ausgiebig, bevor sie in das flache, baumlose, trockene Tafelland ritten.
Sun-In-The-Red-Hair fiel weder vom Pferd, noch passierte ihr ein anderes Unglück. Die Comanchen ließen sie in Ruhe. Es gab ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen ihnen. Im Gegenzug sorgte sie für Brennmaterial, kümmerte sich um das Feuer und lernte, ihnen ihr Wild zuzubereiten. Als ehemalige Lehrerin fiel es ihr auch nicht schwer, bald einige Brocken dieser unaussprechlichen Sprache zu lernen.
Icy-Wind stand zu seinem Wort. Er mied ihre Gesellschaft und ging ihr aus dem Weg. Sie blieb jedoch vor ihm auf der Hut, ihre Wachsamkeit ließ den ganzen Weg über nicht nach. The-One-Who-Should-Not-Look-Back, dieser ihm einst von einem alten, erfolgreichen Krieger gegebener Name, sollte sich noch viel eher bewahrheiten, als er dachte, und ihn sein ganzes Leben lang an diese seine Entscheidung schmerzlich erinnern.
So erreichten sie nach langem Ritt ihre Leute im windumtosten Llano Estacado. Die etwa hundert Personen umfassende Gruppe Comanchen hatte ihr Sommerlager vor einem Canyon, durch den sich ein Fluss schlängelte, aufgeschlagen. Sie nannten sich Antilopenbande und später einmal würden sie zu den Quahari gehören, die unter diesem Namen in die Geschichte eingehen sollten. Anders als auf der weiten Ebene, wo sie in einem Kreis lagerten, verteilten sich ihre Tipis hier unregelmäßig am Flussufer entlang. Nur die Familienverbände gruppierten sich enger zusammen.
Die Ankommenden wurden stürmisch empfangen. Es war allen eine große Freude, sie gesund wiederzuhaben. Neugierige wie auch feindselige Blicke trafen die weißen Gefangenen. Das blieb aber nicht lange so. Schon vor Sonnenuntergang gab es einige Familien, die die Kinder aufnehmen wollten. Am Ende sprach ihr Friedenshäuptling und Medizinmann Great-Mountain, ein weiser Mann um die vierzig, dessen Wort Gewicht hatte und der Streitigkeiten schon an der Wurzel schlichten konnte, die beiden Jungen zwei Familien zu. Die Brüder wurden zwar getrennt, ihre jeweils neue Heimstatt lag aber nur etwa hundert Schritte voneinander entfernt. Ihrer Adoption stand nichts mehr im Wege. Für das kleine Mädchen traf Red-Eagle selbst die Entscheidung. Er brachte es zu seiner Schwester, die erst im letzten Winter ein Kind im fast gleichen Alter durch die Krankheit der Weißen verloren hatte. Wie erwartet traf es Sun-In-The-Red-Hair nicht so gut. Nachdem sie ins Lager geritten waren, überließen die Männer sie den wartenden Frauen. Einige von ihnen machten ihr das Leben zur Hölle.
Crow-Wing, die zukünftige erste Ehefrau von Icy-Wind, war am grausamsten. Sie scharte etliche Frauen um sich, dann banden sie die weiße Gefangene an einen in den Boden gerammten Pfahl. Sie schlugen und stachen mit brennenden angespitzten Holzstöcken auf sie ein. Egal, ob sie ihr die Haare versengten, sie blutig schlugen, ihre ohnehin zerrissene Kleidung dabei verbrannten oder ihre nackte Haut – sie ließen ihre Wut an ihr aus. Wut, die sich seit langem aufgestaut und zuletzt durch den Tod einiger ihrer Kinder den Höhepunkt erreicht hatte. Eine ihnen völlig unbekannte Krankheit war nach dem Besuch einer der Handelsstationen des weißen Mannes unter ihnen ausgebrochen. Es war noch gar nicht lange her, und als sie der weißen Frau ansichtig wurden, erinnerten sie sich wieder daran.
Die Jagd auf sie ging einen ganzen Tag lang, ohne dass jemand ihr etwas zu trinken oder zu essen brachte. Niemand erbarmte sich ihrer. Crow-Wing hatte im Gegensatz zu diesen Frauen andere Beweggründe, denn es war ihr nicht entgangen, wie ihr zukünftiger Ehemann mit zerknirscht aussehendem Gesicht an ihr vorbeigeritten war. Nach einigen Fragen an Wolf-Hunter wusste sie Bescheid. Rasch zählte sie eins und eins zusammen und zog die richtigen Schlüsse daraus. Sie war eine sehr eifersüchtige junge Frau und nicht bereit, der Weißen das durchgehen zu lassen. Sie aus tiefstem Herzen hassend, beobachtete sie misstrauisch das Verhalten Icy-Winds. Oh ja, stellte sie schnell fest – sie war schuld, dass ihr Liebster nicht mehr so war, wie er sie verlassen hatte.
Noch vor Sonnenaufgang des nächsten Tages begann das Ganze für Sun-In-The-Red-Hair von Neuem. Je mehr sie litt, desto eifriger ersann Crow-Wing neue Foltermethoden. Darin war sie sehr erfinderisch. Irgendwann, die Sonne begann bereits zu sinken, banden einige der Frauen sie ohne das Wissen von Crow-Wing von dem Pfahl los, an dem sie seit dem Morgen hing. Völlig erschöpft, barfuß, halb verhungert, durstig und aus unzähligen offenen Wunden blutend, hatte die weiße Frau keine Kraft mehr. So hockte sie nur noch hilflos unten am Fluss, wohin sie sich des Wassers wegen gezwungen hatte zu kriechen. Ihr Kopf lag auf ihren Knien, sie war müde und verzweifelt. Die Männer hatten sich den ganzen Heimweg über zurückhaltend und beinahe höflich ihr gegenüber benommen. Das hier aber brachte sie an den Rand ihrer Kräfte. Sie konnte sich das Benehmen der Frauen nicht erklären. Wusste nichts von dem Leid, das Weiße, wie sie eine war, über dieses kleine Volk gebracht hatten. Krankheiten und ein Überfall im letzten Jahr, während sie an einem Nebenfluss des Brazos-River lagerten, stachelten den Hass der Frauen noch an. Die Verluste waren hoch gewesen. Jetzt, bei ihrem Eintreffen im Lager, entlud sich die Wut mancher Frau, die ihren Sohn, ihren Ehemann oder einen Bruder verloren hatte. Ihre Lage schien aussichtslos. Niemand stand ihr bei, niemand hatte auch nur einen Funken Mitleid für sie übrig. Die Männer mischten sich wohlweislich nicht in die Angelegenheiten der Frauen ein. Selbst Great-Mountain hielt sich zurück. Sie vertrauten auf die Zeit, die eine Entscheidung bringen würde. Entweder ging sie zugrunde und musste eine Art Sklaven-Dasein führen, oder sie konnte sich behaupten. Auf die Möglichkeit, dass vorbeikommende Comancheros sie auslösen würden, konnte sie nicht hoffen. Dieser kleine Stammesverband lebte zu abgelegen.
Irgendwann im Laufe des nächsten Tages raffte sie sich schließlich auf. Streifte von Tipi zu Tipi am Fluss entlang, gebückt, unterwürfig, mit hohlen, hungrigen Augen. So ging sie auf die Suche nach irgendetwas Essbarem. Zu ihrem eigenen Erstaunen stellte sie fest, wie gut sie inzwischen bereits Comanche verstand. Unbewusst bekam sie so den Sinn so manchen Gesprächs mit, das zwischen den alten Männern, die immer irgendwo rauchend und schwatzend vor den Tipis saßen, geführt wurde. Noch etwas hatte sich geändert. Heute bekam sie von einigen im Lager Nahrung zugesteckt oder sogar ein kleines Lächeln. Das passierte immer, wenn sie entschlossen auftrat, nicht unterwürfig. Mehr und mehr Mitglieder der Antilopen begannen sie zu ignorieren, statt sie von ihren Feuerstellen zu vertreiben. Es gab nicht mehr so viel Feindseligkeit wie am Anfang. Nachdem sie diese Reaktion der Menschen erkannte, änderte sie ihr Verhalten. Sie wollte kein Nichts sein – sie wollte als Mensch, ja, sogar als Frau, wahrgenommen werden. Nun war sie hier, weitab jeglicher Zivilisation, weitab von ihren Träumen und Hoffnungen, und musste das Beste daraus machen.
Adele Bergmann war schon immer eine praktische und starke Frau gewesen. Hatte sie es doch – ganz auf sich allein gestellt – sogar über den großen Ozean geschafft. Was hier mit ihr passierte, war schrecklich, doch sie wollte leben – wenn es denn sein musste, auch hier bei diesen Wilden. Jedoch ein wenig, ein klitzekleines wenig, dann auch zu ihren Bedingungen.
Doch noch war ihr Leiden nicht zu Ende. Die Gefahr in Form von Crow-Wing, diesem hochgewachsenen, wohlgeformten Comanchenmädchen, wurde ihr am Abend noch einmal so richtig klar gemacht. Anscheinend hatte sie es wieder geschafft, einige der älteren Frauen um sich zu scharen. Wohin die weiße Frau auch flüchtete, sich mit letzter Kraft verkroch, immer spürten sie sie auf. Wenn sie gerade dachte, ihnen entkommen zu sein, machte sich die Gruppe mit unveränderter Härte wieder über sie her. Steine flogen, Knüppel schlugen auf sie ein. Ein angezündeter Ast versengte ihr die Haut und verbrannte einen Teil ihrer ohnehin schon furchtbar zugerichteten Haare. Die anbrechende Nacht brachte ihr etwas Ruhe. Sie konnte in einem Versteck am Fluss ein wenig schlafen. Der Tag, der dann kam, brachte keine Veränderung. Lange würde sie das nicht mehr durchhalten. Am Ende ihrer Kräfte, völlig verzweifelt, hätte sie sich beinahe aufgegeben. Gerade suchte sie wieder einmal nach einem sicheren Unterschlupf für die kommende Nacht. Den ganzen vergangenen Tag über war sie auf der Suche nach Abfällen gewesen – immer auf der Hut, dem Mob um Crow-Wing zu entkommen. Jetzt kroch sie am Ufer zwischen den herunterhängenden Weiden hindurch, um dort Schutz zu suchen. Ihre Kleidung hing schon lange in Fetzen herab. Kaum, dass sie ihre Blöße verdecken konnte, raffte sie die Reste um ihren Körper. Die Nächte waren kalt, und sie fror erbärmlich. Ihre offenen, schwärenden Wunden machten ihr inzwischen nichts mehr aus. Der Hunger war schlimmer.
Als sie sich an diesem Tag dabei ertappte, wie sie sich mit einem der wenigen Hunde, die es im Lager gab, um ein Stück verkohlten Knochen stritt, erwachte sie wie aus einem schlechten Traum. Diese Art Herabwürdigung ihres Menschseins wollte sie so nicht länger hinnehmen. Sie besann sich auf ihre eigene Würde und beschloss, sich gegen diese Handvoll schrecklicher Frauen, die es noch immer auf sie abgesehen hatten, zur Wehr zu setzen, statt vor ihnen zu flüchten. Nicht alle hier begegneten ihr feindselig. Diese Erfahrung hatte sie bereits gemacht. Beschämt über sich selbst, dass sie sich wie ein ängstliches Tier benommen hatte, kroch sie aus ihrem Versteck. Entschlossen stand sie auf, um endlich den Kampf gegen ihre Peinigerinnen aufzunehmen. Die Tränen aus ihrem schmutzigen Gesicht wischend, fuhr sie anschließend mit den Fingern durch die widerborstig abstehenden, völlig verfilzten roten Haare. Dann ging sie hinunter zum Fluss, um sich dort zu waschen. Sie würde es ihnen allen schon zeigen. Mit hoch erhobenem Kopf, trotzig zusammengekniffenen Lippen und herausforderndem Blick aus großen, hellbraunen Augen ging sie durch das Lager. Sie war hungrig, und ihr schwindelte vor Kraftlosigkeit, trotzdem war ihr Schritt nicht mehr unsicher, ja, ihre ganze Erscheinung doch irgendwie stolz. Von einigen Feuerstellen, an denen sie vorbeikam, wurden ihr an diesem Abend wie nebenbei Fleischabfälle zugeworfen – gute Fleischabfälle. Am nächsten Morgen – in der vergangenen Nacht waren ihre Peinigerinnen zu ihrer großen Erleichterung ausgeblieben – trat aus einem der Tipis, an denen sie auf der Suche nach essbarem Abfall vorüberkam, eine Frau. Mit durchdringenden, sehr aufmerksamen Blicken musterte sie sie.
Sun-In-The-Red-Hair kam es so vor, als wäre die Frau erstaunt darüber, sie noch immer am Leben zu sehen. Stolz senkte sie weder den Blick, noch trat sie furchtsam den Rückzug an, wie sie es bisher zu tun pflegte. Die Indianerin nickte ihr mit einem leicht angedeuteten Lächeln zu und bedeutete ihr, zu warten. Dann verschwand sie im Innern des Tipis, um gleich darauf wieder mit einer Kürbisschüssel herauszukommen.
Ungläubig starrte die weiße Gefangene auf das viele Fleisch, das in einer dickflüssigen heißen, über die Maßen wohlriechenden Brühe schwamm. Bevor sie sich darüber hermachte, wischte sie ihre schmutzigen Finger an ihrem zerrissenen Kleid ab. Eine beiläufige Geste, die die Frau vor dem Tipi wohl bemerkte. Ein Gefühl der Beschämung über ihren verwahrlosten Zustand ließ Sun-In-The-Red-Hair tief erröten, während sie die ordentliche, hübsch gearbeitete Kleidung dieser Frau verstohlen musterte. Gleichzeitig stieg ein seltsames Gefühl der Stärke in ihr hoch. In diesem Moment wurde ihr klar, dass ihre Peinigerinnen sie nicht bezwingen konnten.
Die Frau, die ihr hier so freundlich gegenüber trat, mochte vielleicht dreißig Winter gesehen haben; genau konnte man ihr Alter nicht erkennen. Doch ihre Augen blickten gütig, und als sie ihr das Essen reichte, murmelte sie freundlich: „Tuhka“, Essen. Diese Frau hier stand ihr nicht feindselig gegenüber. Nachdem sie das Essen gierig hinuntergeschlungen hatte, ging sie voller Zuversicht weiter.
Im Laufe des Tages erkannte sie, dass es nur noch dieses eine Mädchen war, das sie verfolgte. Welchen Weg sie auch einschlug, wohin sie sich auch wandte – überall tauchte Crow-Wing auf. Ein paarmal gerieten sie aneinander, doch die weiße Frau war zu geschwächt, um ihr ernsthaft Widerstand leisten zu können. Wenigstens hatten ihre Begleiterinnen die Lust auf eine erneute Hetzjagd verloren. Schließlich kroch Sun-In-The-Red-Hair einen Abhang entlang, der bis zum Fluss hinunter reichte und dicht mit Gebüsch zugewachsen war. Irgendwann, so hoffte sie, würde es auch diese Frau müde werden.
Doch darin sollte sie sich täuschen, denn sie wusste gar nichts über Crow-Wing, deren Namen sie inzwischen kannte. Die hatte sich berechtigte Hoffnungen auf eine Ehe mit Icy-Wind gemacht, und nun ging er ihr aus dem Weg. Hatte er etwa vor, diese Weiße doch noch in sein Tipi zu holen? Sollte ihr ausgerechnet diese da den Platz als erste Frau nehmen? Obwohl sie durch Wolf-Hunter von dem Entschluss Icy-Winds wusste, was seinen Anspruch auf sie betraf, traute sie ihm nicht. Sie konnte er nicht täuschen. Eifersüchtig wachte sie über ihren Zukünftigen, nutzte jede Gelegenheit, um in seiner Nähe zu sein, und bemerkte sehr wohl, wie er es vermied, der weißen Gefangenen zu begegnen. Icy-Wind hatte ihr schon vor diesem Kriegszug nach Texas klargemacht, dass er sich für eine dauerhafte Bindung noch zu jung fühlte. Sie konnte warten, solange sie die einzige Frau für ihn blieb. Crow-Wing hatte für ihn viele Verehrer abgewiesen. Das schmeichelte ihm natürlich. Außerdem war zwischen ihm und ihrem Vater bereits eine Vereinbarung geschlossen worden. Er konnte nicht von ihr erwarten, dass sie tatenlos dabei zusah, wie er sich eine andere erste Frau in sein Tipi holte. Mochte er sich auch im Beisein seiner Männer anders entschieden haben – sie fühlte, dass dem nicht so war. Also verfolgte sie hartnäckig ihre angebliche Widersacherin, und es war ihr sogar egal, wenn sie dabei umkam.
An diesem späten Nachmittag bereitete sich Sun-In-The-Red-Hair in der Nähe des Ufers so gut wie möglich einen neuen Unterschlupf. Den einzigen Schutz boten die dicht herunterhängenden Erlen und Weiden. Sie bog sie bis zum Erdboden und beschwerte sie mit Steinen, so dass sie eine Art Laube bildeten. Leise plätschernde Wellen trugen sie in einen leichten Schlaf, aus dem sie immer wieder bei dem kleinsten Geräusch hochschreckte. Was der nächste Tag bringen würde, wusste sie nicht – nicht einmal, ob sie die nächsten Stunden überleben konnte, denn Crow-Wing lauerte sicher irgendwo. Immer nur einen Schritt nach dem anderen, sagte sie sich und erwartete so die Nacht. Sie hatte nichts, um sich zu bedecken, nichts, womit sie sich wärmen konnte.
Verzweifelt, frierend, hungrig, wieder einmal den Tränen nahe, lag sie auf dem bloßen Erdboden. Sehnsüchtig dachte sie an die Pferdeherde dem Fluss gegenüber, wo sie heute einen der weißen Jungen entdeckt hatte, der dort mit seinem neuen Vater in warme Decken gehüllt schlief. Wenigstens hatten es die Kinder besser als sie getroffen.
Vor Kälte konnte sie nicht wieder einschlafen, deshalb erhob sie sich und kroch aus ihrem Versteck. Etwas stimmte nicht. Geräusche von knackenden Ästen drangen zu ihr. Alarmiert horchte sie auf. Da sah sie auf einmal die freundliche Indianerin vom Morgen wieder. Sie kam über den Abhang ihr gegenüber durch wildes Gesträuch herab. Der Vollmond gab genug Licht, um Sun-In-The-Red-Hair sehen zu lassen, dass sie ein großes, gegerbtes Büffelfell über dem Arm trug. Vor ihr stehen bleibend, maßen sie sich mit Blicken. Die eine einfach nur neugierig, jedoch freundlich – die andere war sehr auf der Hut. Ohne etwas zu sagen, reichte die Indianerin ihr das Büffelfell. Sun-In-The-Red-Hair blinzelte; ihr eines Auge war noch von den Schlägen des Vortages zugeschwollen, aber ihr Herz klopfte freudig erregt. Der Mond verschwand hinter einer Wolke, und doch konnte sie das Lächeln der Indianerin in einem Gesicht sehen, das nicht schön war, aber gütig. Bevor sie etwas sagen konnte, verschwand sie wieder auf dem gleichen Weg, den sie gekommen war. Sun-In-The-Red-Hair kroch in ihren Unterschlupf zurück. Dankbar breitete sie den Umhang über sich aus.
Gerade, als sie der Schlaf überkommen wollte, wurde sie jäh aus ihrer warmen Hülle gerissen.
Crow-Wing. Einen zugespitzen Knüppel in der Hand, drosch sie erbarmungslos auf sie ein. Stach, Schimpfworte ausstoßend, mit solcher Wucht und Verbissenheit zu, dass Sun-In-The-Red-Hair sich kaum zur Wehr setzen konnte. Sie versuchte, sich mit dem Büffelfell so gut wie möglich zu schützen, doch im nächsten Moment wurde sie an den Beinen hinunter ins Wasser geschleift. Wie eine Furie schlug Crow-Wing weiter auf sie ein, bis der Knüppel endlich zerbrach. Das Letzte, was Sun-In-The-Red-Hair noch bewusst wahrnahm, waren die blutunterlaufenen Augen dieser fürchterlichen Frau, ihr geifernder, offenstehender Mund und das zerborstene Ende ihrer Waffe.
Crow-Wings wutverzerrtes Gesicht nahm nach diesem letzten Treffer einen befriedigten Ausdruck an. Sie trat einen Schritt zurück, um sich ihr Werk zu betrachten. Dabei kam ihr etwas in den Sinn. Ihre Augen huschten den Abhang hinauf. Niemand war zu sehen. Der Vollmond stand fast über ihr, doch jetzt schob sich eine Wolke davor. Sie beugte sich zu ihrem ohnmächtigen Opfer hinunter, ergriff ihre nackten Füße und zog sie weiter ins Wasser. Sie musste schnell eine Stelle für ihr Vorhaben finden, die niemandem gleich auffallen würde. Einige Schritte weiter am Ufer entlang wuchsen die Weidenbüsche bis an das Wasser. Erlen tauchten ihre Zweige hinein, überall lagen große Steine. Dort hindurch eine freie Stelle bis tiefer in den Fluss hinein zu finden, würde Zeit kosten – Zeit, die sie nicht hatte. Also musste sich Crow-Wing damit begnügen, ihr Opfer hier im flachen Wasser zu lassen. Wenigstens hingen die Weiden tief bis zu ihr herunter und verdeckten sie. Sollten die leicht ans Ufer schwappenden Wellen doch das Übrige tun. Was konnte sie denn dafür, wenn sie sie in den Fluss hinaus trugen und hoffentlich weit weg von hier. Damit hatte sie nichts zu schaffen.
Ohne nach rechts oder links zu blicken, beeilte sich das junge Mädchen mit dem Fellumhang unter dem Arm, den sie ohne groß nachzudenken mitgenommen hatte, den Abhang hinauf zu kommen. Um ihn loszuwerden, wollte sie ihn gerade achtlos ins Gebüsch werfen, da erstarrte sie plötzlich. Jemand kam ihr entgegen. Zuerst hatte sie nur ein Geräusch gehört, jetzt aber bewegten sich die Zweige des Gebüsches seitlich von ihr. Der Mond war wieder hinter der Wolke hervorgekommen und beleuchtete die nähere Umgebung. Konnte sie jemand bei ihrem Tun beobachtet haben? Diese Frau war in ihren Augen nur eine wertlose weiße Gefangene. Doch sie wusste genau, dass sie mit ihrer letzten Tat den Bogen überspannt hatte. Das Geräusch kam näher. Jemand schritt den Abhang hinunter, direkt auf den Fluss und das Versteck der weißen Frau zu. Jetzt erkannte sie die Gestalt eines Mannes und erschrak. Sie hatte jedoch keine Möglichkeit mehr, sich vor ihm zu verstecken. In dem Moment, als sie ihm gegenüberstand, ließ er den Blick über sie hinweg schweifen, sah auf sie hinunter, betrachtete das Büffelfell, holte aus und schmetterte ihr seine Handkante mit voller Wucht ins Gesicht. Der unerwartete Stoß beförderte sie zur Seite, das Büffelfell landete im Gebüsch. Sie fiel der Länge nach hin, raffte sich gleich wieder auf, um so schnell sie nur konnte davonzulaufen. Atemlos erreichte sie die Kante des Hangs und blieb oben stehen. Was sollte sie nur tun? Sie wusste sich das Erscheinen von Icy-Wind hier nicht zu erklären, schon gar nicht, warum er sie bestrafte. Er konnte doch unmöglich gesehen haben – nein. Oder etwa doch?
Alle ihre Vermutungen sah sie jetzt bestätigt. Der Schlag ins Gesicht brannte noch immer wie Feuer. Widerstreitende Gefühle stürmten auf sie ein. Wusste er, dass die weiße Frau ihr Nachtlager hier aufgeschlagen hatte? Die Eifersucht wühlte sie auf, sie konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Verzweifelt suchte sie nach einer Lösung. Es war zu spät. Wenn er wusste, was sie getan hatte, wie würde er reagieren? Sie jedenfalls nahm sich vor, alles abzustreiten. Völlig kopflos machte sie sich auf den Weg zurück in ihr Tipi.
Icy-Wind hatte unterdessen seinen Weg rasch fortgesetzt. Er wusste über Crow-Wings Hass Bescheid, was die weiße Frau betraf. Dafür war der Schlag gewesen. Es kümmerte ihn nicht, dass sie ihn hier gesehen hatte. Sollte sie doch denken, was sie wollte. Vielmehr fragte er sich, warum sie hier gewesen war. Um diese Zeit hatte ein junges Mädchen im Tipi zu sein. Er bückte sich zu dem weggeworfenen Büffelfell und ließ es nachdenklich durch seine Finger gleiten. Wozu hatte sie es bei sich gehabt? Und warum weggeworfen? Kopfschüttelnd verscheuchte er diese Gedanken. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals, während er den Abhang eilig hinunter schritt, immer noch das Büffelfell in den Händen.
Lange hatte er damit zugebracht, die weiße Frau bei ihrer Suche nach einem Unterschlupf zu beobachten. Erst, nachdem im Lager alles ruhig geworden war, machte er sich zu ihr auf den Weg. Nach einem langen, seit dem frühen Morgen andauernden und mit sich selbst geführten Kampf stand sein Entschluss jetzt fest. Egal, was er auch einmal gesagt haben mochte – er wollte sie in seinem Tipi. Die zu erwartenden Sticheleien konnte er aushalten. Irgendwann würde das ja auch wieder aufhören. Was Crow-Wing betraf – diese Angelegenheit konnte mit ein paar Pferden für ihren Vater schon irgendwie geregelt werden, dachte er.
Zu seiner Enttäuschung fand er das Versteck der weißen Frau verlassen vor. Spuren eines Kampfes bedeckten den schlammigen Boden bis hinunter zum Fluss. Sein kundiger Blick erfasste sofort die Situation. Da entdeckte er sie im Wasser, und ihn durchfuhr ein Riesenschreck. Sie herausziehend stellte er erleichtert fest, dass sie lebte. Vorsichtig trug er sie weiter das Ufer hinauf. Hatte etwa Crow-Wing hiermit etwas zu tun? Den östlichen Horizont erhellte bereits ein heller Schimmer. Nachdenklich hockte er sich neben Sun-In-The-Red-Hair, die noch immer bewusstlos war. So ausgemergelt und unansehnlich besaß sie nicht mehr sehr viel Ähnlichkeit mit der Frau, die er mit seiner Macht bedroht hatte. Und doch ließ sie ihn Dinge tun, die ihn verwirrten. Sie war in seinem Kopf, beherrschte sein Denken. Unfähig, ohne einen Blick auf sie auch nur einen einzigen Tag ertragen zu können, entschied er sich heute Morgen gegen seine erste Entscheidung. Mochte da kommen, was wollte. Eine kleine Weile verging, während er nur ihren Atemzügen lauschte und wieder einmal mit sich haderte. Wo war der überhebliche, anmaßende Krieger geblieben, der nur sich selbst liebte und kein anderes Wort als sein eigenes gelten ließ? Der zu stolz war, zuzugeben, was diese weiße Frau ihm bedeutete? Jetzt, hier, in diesem Augenblick der Einkehr würde er viel darum gegeben haben, das Gesagte von damals ungesagt werden zu lassen. Sogar seine Brutalität ihr gegenüber bereute er.
Dann schlich sich seine Eitelkeit wieder von hinten an ihn heran. Was er jetzt vorhatte, würde ihm den Spott des gesamten Lagers eintragen, wenn auch nicht für immer. War diese Taibo das wert? Erneut kamen ihm Zweifel.
Allmählich drangen die Geräusche des heraufdämmernden Morgens in sein Bewusstsein. Er riss sich von ihrem Anblick los und schüttelte sich wie benommen. Ihre Atemzüge kamen jetzt regelmäßig. Sie musste doch frieren, ging ihm auf. Wieder stellte er sich die Frage, warum sie im Wasser gelegen hatte. Die Kampfspuren fielen ihm ein, dann Crow-Wing und deren Erschrecken. Ein Lächeln umspielte seine schmalen Lippen. Natürlich, war er sich jetzt sicher, Crow-Wing mit ihrer ewigen Eifersucht. Doch wie passte das Büffelfell hierher? Es lag nur wenige Schritte von ihm entfernt, dort, wo er es fallen gelassen hatte, und er holte es, um es über ihr auszubreiten. Sacht strich seine offene Hand über ihren Körper, ohne sie zu berühren. Wieder einmal unsicher, fasste er erneut einen Entschluss. Diese Angelegenheit hier konnte noch warten. Jetzt war sie ja versorgt. Mit Crow-Wing würde er ein ernstes Wort reden. Die Verfolgungen mussten endlich aufhören. Entschlossen trat er einige Schritte zurück. Dass er hier gewesen war, musste sein Geheimnis bleiben. Niemand durfte davon erfahren. Crow-Wing würde schweigen, denn was sie getan hatte, brachte ihr keine Ehre, wenn es herauskam. Er wandte sich von Sun-In-The-Red-Hair ab, um die Umgebung zu durchforschen. Auf keinen Fall wollte er hier bei ihr überrascht werden. Er würde seinen Entschluss noch einmal gründlich überdenken und dann entscheiden. Vielleicht morgen, vielleicht gar nicht.
Doch jemand hatte das alles längst beobachtet. Versteckt im Gebüsch lauerte Antelope-Son. Seit er gesehen hatte, wie die Frau, die er seit vielen Wintern liebte und die seine Werbungen so schmählich immer wieder abwies, dieser Weißen den Büffelumhang gebracht hatte, war er hier. Er wollte sich schon zurückziehen, aber da war Crow-Wing erschienen, und die Neugier hatte ihn gepackt. Antelope-Son konnte eins und eins zusammenzählen; Crow-Wings Eifersucht war allgemein bekannt. Das Auftauchen von Icy-Wind und sein Tun hatten ihn jedoch sehr erstaunt. Was soll´s – er würde vorerst schweigen. Vielleicht konnte man ja aus dem Gesehenen irgendwann Vorteile ziehen. Die Zärtlichkeit, mit der Icy-Wind über ihren Körper gestrichen hatte, war ihm nicht entgangen. Sich tiefer ins Gebüsch hineinduckend, beobachtete er, wie Icy-Wind noch einmal mit den Fingerspitzen über die unter dem Büffelfell liegende weiße Frau strich und sich dann langsam zurückzog. Antelope-Son reckte sich etwas vor; er wollte sehen, wohin der junge Krieger nun ging.
In tiefes Nachdenken versunken stolperte Icy-Wind über eine hervorstehende Wurzel. Er blieb stehen und nahm einen Reiter wahr, der von flussaufwärts heraufkam. Es war zu spät, um ungesehen zu verschwinden– viel zu spät, um seine Anwesenheit bei der weißen Frau zu erklären. Aber, so durchfuhr es ihn, musste er das denn überhaupt? Er schalt sich selbst einen Dummkopf. Er, Icy-Wind, war niemandem Rechenschaft schuldig.
Der Reiter kam direkt auf ihn zu. Im Dämmerlicht des heraufziehenden Morgens konnten beide zuerst nur ihre Umrisse wahrnehmen. Dann, als das Pferd heran war, erkannten sie einander. Die Mundwinkel des Reiters zuckten spöttisch. „Oh, das ist aber eine Überraschung“, sprach er Icy-Wind an. Dann aber bekam seine angenehm klingende Stimme einen drohenden Unterton. „Willst du nachsehen, ob deine ehemalige Kriegsbeute gut versorgt ist? Lässt das deine Ehre denn überhaupt zu? Ich bin Crow-Wing begegnet, sie rannte mein Pferd fast um. Ihre Flügel flatterten so wild wie die ihrer Namensgeberin, wenn sie auf ein Stück Aas trifft.“
Die Worte sprangen Icy-Wind wie eine Raubkatze an. Seine dunkle Gesichtshaut färbte sich noch dunkler. Zusehends erhärtete sich seine Miene. Eben noch um Gleichgültigkeit bemüht, wurde sie Augenblicke später hart, ja, der Zorn sprühte förmlich aus seinen eng zusammenstehenden Augen. Dieser Mann hier weiß Bescheid, glaubte er zu wissen. Sich zusammenreißend, sagte er nichts. Es war oft besser zu schweigen. Ein falsches Wort, und die Situation würde sich verschärfen, da kannte er sich gut genug. Stumm, das Pferd des anderen nur mit dem Oberarm streifend – dessen konnte er sich nicht enthalten – ging er an dem Reiter, einem bedeutend älteren Krieger, als er es war, vorbei. Als er ihm den Rücken zukehrte, stellten sich ihm sämtliche Härchen im Nacken auf. Plötzlich fror er. Niemals hätte ihn hier jemand sehen dürfen! Three-Bears würde reden. Das war gar nicht gut. Nun, sagte er sich mit Wut im Bauch, ich kann es nicht mehr ändern. Was hatte diesen Mann nur dazu bewogen, gerade hier entlangzureiten? Sein plötzliches Erscheinen fasste er als persönliche Beleidigung auf. Erst recht, was und wie er es gesagt hatte. Die Situation war für ihn höchst peinlich gewesen. Wenn das die Runde macht, dachte er, bin ich geliefert. Das wird mir noch in ewigen Zeiten nachhängen. All das ging ihm durch den Kopf, während er den Abhang hinauf schritt, vorbei an Antelope-Son, der immer noch unentdeckt ausharrte.
Was auch immer der ältere Krieger, den sie Three-Bears nannten, denken mochte, ob er es weitererzählte oder nicht, er hatte sich Icy-Wind in dieser Nacht zum Feind gemacht. Selbstgerecht, wie der junge Mann nun einmal war, kam er nicht einmal auf den Gedanken, dass es Three-Bears nicht interessierte, was er hier machte, es war ihm schlichtweg egal. Doch für Icy-Wind war diese schicksalhafte Begegnung und insbesondere, was danach folgte, Anlass genug, Three-Bears und dessen gesamte Familie für alle Zeiten zu hassen. Ahnungslos, sich für immer einen Feind erschaffen zu haben, blickte Three-Bears ihm nach. Er sah, wie er hinter dem Abhang verschwand, und wartete noch einen kurzen Moment; dann suchten seine Augen im Dämmerlicht nach der jungen Frau. Seine Schwester hatte ihm genau beschrieben, wo er sie finden würde. Vor zwei Sonnenaufgängen war er von einem ausgedehnten Jagdausflug zurückgekommen und hatte erst da von dem erfolgreichen Kriegszug erfahren. Seine Schwester wusste viel über die weiße Gefangene zu berichten; deshalb war er jetzt hier. Das Pferd, das er ritt, ein hochbeiniger rotbrauner Hengst mit heller Mähne, der von einem Raubzug stammte, setzte vorsichtig einen Fuß nach dem anderen durch das dichte Unterholz. Three-Bears suchte die Umgebung ab, bis er die weiße Frau endlich entdeckte. Sun-In-The-Red-Hair lag noch immer nahe am Wasser – eingehüllt in das Büffelfell, von dem er wusste, dass es von seiner Schwester stammte.
Langsam erwachte die weiße Frau aus ihrer Ohnmacht. Wie war sie nur hier hergekommen? Sie erinnerte sich nur daran, dass diese gemeine Frau sie angegriffen und ins Wasser gezogen hatte. Wieso war sie nass und das Büffelfell trocken? Das Auftauchen des Reiters, der jetzt auf sie zukam, beunruhigte sie nicht weniger. Zuerst wollte sie weglaufen, doch dann besann sie sich. Weglaufen hätte keinen Sinn gehabt. Misstrauisch blickte sie ihm entgegen, eine neue grauenhafte Quälerei erwartend. Das verschwindende Licht des Mondes und der neu heraufziehende Tag mit seinem silbernen Streif am Horizont zeigten ihr das ovale, tätowierte Gesicht eines älteren Mannes mit sehr hohen Wangenknochen, einem großen, schmalen Mund, ausdrucksstarken dunklen Augen und einer geraden Nase. Seine Haare, bereits mit einigen Silberfäden darin, fielen ihm lang bis auf die nackten Schenkel. Hinter seinem Rücken schaute ein Köcher mit Pfeilen und einem Bogen hervor. Sonst trug er keinerlei Waffen, so weit sie das von ihrem Platz aus beurteilen konnte. Über den Muskeln seiner Oberarme, die mindestens so dick wie jetzt ihre Schenkel waren, spannten sich breite silberne Ringe. Seine ganze Haltung hatte keinesfalls etwas Bedrohliches. Als er sich jetzt nach hinten beugte, dachte sie zuerst, er griffe nach seinem Bogen. Dann jedoch zerrte er ein Bündel hervor, auf dem er halb gesessen haben musste.
In seinen Augen spielgelte sich kurz das spärlich heraufziehende Licht des neuen Morgens, als er es ihr zuwarf. „Anziehen“, kam es wie ein Befehl auf Comanche aus seinem Mund. Das Pferd unter ihm tänzelte etwas zurück, schnaubte, blieb dann aber wieder ruhig stehen.
Natürlich hatte sie erraten, was er von ihr wollte. Ungeschickt, wie gelähmt und doch unwillkürlich von ihm fasziniert, machte sie die Schnüre los, die das Bündel zusammenhielten. Zum Vorschein kam ein Kleid aus Hirschleder, wie es die jungen Mädchen hier fast alle trugen. Zögernd hielt sie es in ihren hart gewordenen, schwieligen Händen – jetzt zitternd und sich plötzlich der Tatsache bewusst, dass die Fetzen ihres eigenen Kleides feucht und unansehnlich waren und mehr preisgaben als bedeckten. Beschämt presste sie das Büffelfell mit gesenktem Blick an ihren Körper, griff aber nach dem Kleid und zog es sich unter dem Büffelfell über.
Im Hintergrund hörte sie die Geräusche, die vom Fluss heraufkamen. Irgendwie waren sie jetzt anders als all die Tage zuvor. Vögel machten Lärm, Frösche quakten, die Weiden bewegten sich im Wind. Verwundert hob sie den Kopf.
„Komm her!“ Seine Stimme war sanft. Ihre Blicke begegneten sich zum ersten Mal, hakten sich ineinander. Unsicher gehorchte sie. Über dem Horizont stand noch keine Sonne, doch der Himmel dahinter war bereits wie mit geschmolzenem Silber übergossen. Plötzlich drangen die ersten Sonnenstrahlen durch die Weiden am Fluss. Sun-In-The-Red-Hairs wild aufgelösten Haare glühten. Ein offenes, breites Lächeln – ein gutes Lächeln, wie sie fand – erschien auf den Lippen des Mannes, ging wie ein Leuchten in seine schwarzen Augen über. Da wurde ihm plötzlich etwas klar. Unzählige kleine Fältchen zogen sich in seinem Gesicht zusammen, dann bewegte sich sein Adamsapfel auf und ab, als müsse er schwer an etwas schlucken. „Sun-In-The-Red-Hair“, sagte er, und es klang wie eine Offenbarung. „Sun-In-The-Red-Hair“, kam es noch einmal, jetzt staunend – wie etwas, das sich bei ihrem Anblick bestätigte. Ja, seine Schwester hatte nicht übertrieben. Die Sonne war tatsächlich in ihrem roten Haar, so zerzaust und ungepflegt es auch sein mochte. Ein Schauer lief ihm den Rücken hinunter und löste sich erst in seinen Waden auf. Er beugte sich leicht nach vorn, einen Arm ausgestreckt, und machte mit Mittel- und Zeigefinger eine unmissverständliche Bewegung von ihr zu sich herauf.
Sun-In-The-Red-Hair stutzte. Was wollte er von ihr? Tausend Gedanken stürzten auf sie ein. Ich? Ich?
Dann machte sie den ersten Schritt auf ihn zu. Machte ihn mit klopfendem Herzen, doch sie machte ihn. Noch einmal kam von ihm diese Bewegung, diesmal mit der ganzen Hand.
Sie zögerte erneut, zögerte zwei Herzschläge lang, dann ging sie auf sein Pferd zu. Vergiss alles, was vorher war, dachte sie entschlossen und schob sämtliche Vorbehalte beiseite. Neue Hoffnung keimte in ihr auf. Sie schätzte sein Alter auf etwas über dreißig. Doch seine Mimik, seine ganze Vertrauen einflößende Art, besonders sein Lächeln, gab den Ausschlag. Ihr Herz schlug so schnell, dass sie dachte, es müsste zerspringen. Während sie noch näher kam, entdeckte sie etwas in seinem Blick, das sie tief berührte und ihr durch Mark und Bein ging. Nein, er war nicht schön. Doch das spielte für sie keine Rolle. Sein Blick war besorgt, forschend, während er ihren ausgemergelten, von Wunden bedeckten Körper betrachtete, den auch das neue Kleid nicht ganz verdecken konnte.
Endlich stand sie neben dem Pferd, das Büffelfell unbeholfen unter dem Arm. Er riss es ihr förmlich fort, verstaute es hinter sich und streckte dann mit ernstem Gesicht den Arm nach ihr aus. Sie reichte ihm entschlossen eine Hand. Mühelos hob der Krieger Three-Bears sie zu sich hoch auf sein Pferd. Plötzlich zitterte Sun-In-The-Red-Hair; sie fröstelte, und doch war ihr gleichzeitig warm. Die ganze Tragweite ihrer Entscheidung jetzt erst so richtig begreifend, schnappte sie nach Luft, stieß ihren Atem geräuschvoll wieder aus – und so gab sie ihr Leben vertrauensvoll in seine Hände.
Three-Bears ließ das Pferd einmal um sich selbst tänzeln. Das Morgenlicht spiegelte sich auf ihrer beider Haare. Wild durcheinanderflatternd, vermischte es sich, weil der plötzlich aufkommende Wind hindurchfuhr. Der Comanche ritt mit ihr den Hang hinauf, dann weiter, am Tipi seiner Schwester vorbei, die gerade herauskam, einen leeren Wassersack in der Hand. Auf ihrem schmalen, herben Gesicht lag ein wissendes Lächeln. Leichten Fußes lief sie hinüber zur Wasserstelle, den Kopf mit vielen Gedanken voll. Sie musste ein Tipi einrichten. Ihr Bruder hatte ja keine Ahnung, was alles dazugehörte. Obwohl er schon einmal verheiratet gewesen war, wussten das Männer ja nie.
Ein neuer Morgen zog herauf.
An diesem Tag wurde Sun-In-The-Red-Hair die Frau von Three-Bears.