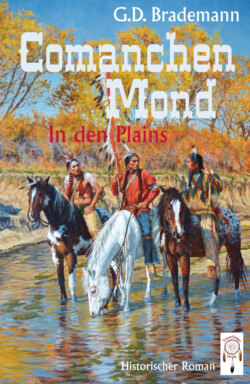Читать книгу Comanchen Mond Band 1 - G. D. Brademann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеDicht zusammengedrängt warteten die Frauen auf das, was die Männer mit ihnen machen würden. Ihre schlimmsten Befürchtungen standen ihnen in die Gesichter geschrieben; schließlich hatten sie im Osten genug Gräuelgeschichten über die Indianer gehört. Manche von ihnen wünschte sich, auf ihren Mann gehört zu haben, der die letzte Patrone für sie aufheben wollte. Jetzt war es dafür zu spät. Die Krieger trieben ihre Mustangs zu immer schnellerer Gangart an, umrundeten die Frauen und jauchzten vor Freude darüber, einen guten Kampf geführt zu haben – ohne eigene Verluste. Während die Frauen vor Verzweiflung, Angst und Entsetzen schrien, während vor ihnen Lanzen in den Boden gerammt wurden oder Pfeile dicht über sie hinwegflogen, lachten die Krieger und tollten herum wie ausgelassene Kinder. Vielleicht waren sie das ja auch noch ein klein wenig, denn bis auf Antelope-Son hatten sie alle nicht mehr als 16, 17 Winter gesehen. Die ihnen ausgelieferten Frauen glaubten doch tatsächlich, dass die nach ihnen geworfenen Lanzen sie treffen sollten.
Zwei etwas resolutere – eigentlich waren sie unterwegs diejenigen gewesen, die immer das Wort geführt hatten – versuchten, nach einer der Lanzen zu greifen. Es war eine Verzweiflungstat, die zu nichts führen konnte, denn schon hatten die jungen Krieger sie ihnen vom Pferd aus entwunden – lachend, nach ihnen stoßend, vorgetäuschte Attacken reitend, als wäre das nur ein Kinderspiel. Eine dritte Frau nutzte die Gelegenheit, um zu einem umgestoßenen Planwagen zu laufen, aus dem Rauch emporstieg. Hatte sie tatsächlich gedacht, die Krieger könnten nicht bis vier zählen und würden nicht merken, dass eine von ihnen fehlte? Es gab keine Möglichkeit für sie, zu entkommen.
Einer der Krieger, der eben einen Scheinangriff geritten war, holte sich seine Lanze aus dem Boden zurück, wog sie kurz in der Hand, dann schleuderte er sie hinter ihr her. Zusammen mit der Lanze brach sie schreiend zusammen. Diesmal hatte er mit voller Absicht getroffen. Eine klaffende Wunde in ihrer Schulter zeugte davon. Die Krieger johlten – gut getroffen, sollte das heißen; die Ware war nur leicht beschädigt.
Ganz in ihrer Nähe hörten sie auf einmal die junge Frau kreischen. Icy-Wind war abseits von den anderen sehr mit ihr beschäftigt. Dann herrschte plötzlich Stille. Die am Boden liegenden Frauen sahen sich an. Eine rappelte sich hoch, als Wolf-Hunter von seinem Mustang sprang. Sie hatte immer noch die Schreie ihrer jungen Begleiterin im Kopf. Mit einem kräftigen Fußtritt trat sie ihm in den Unterleib. Was auch immer sie sich dabei gedacht haben mochte, das war kein guter Einfall gewesen. Noch während sie sich keuchend mit den Armen auf ihre Oberschenkel stützte, stand er bereits wieder vor ihr. Brutal griff der kleine, 16 Winter zählende Comanche nach ihren Haaren, schleifte sie hinter sich her, als wäre sie kein menschliches Wesen, sondern nur ein Gegenstand. Nach einigen Schritten ließ er sie los, stand im nächsten Moment mit dem Messer in der Hand über ihr und warf es lässig aus dem Handgelenk heraus so nahe an ihrem Hals vorbei in den Boden, dass dabei nur ihre Haut leicht angeritzt wurde. Der Schmerz war für sie nicht schlimm; schlimmer war die Erkenntnis, dass sie ihm hilflos ausgeliefert war. Sicher, dass er sie jetzt töten würde, hielt sie sich schreiend einen Arm vor das Gesicht. Mit einem Ruck riss er ihr den Arm herunter, zwang sie, ihn anzusehen. Sein Gesicht zeigte keine Regung. Obwohl es in ihm vor Wut brodelte, riss er sich zusammen. Das hier war sein erster Kriegszug an die Grenze ihres Landes. Er wollte, dass die anderen anerkannten, wie umsichtig und beherrscht er sein konnte. Vorhin, bei den weißen Männern, hatte er keine Gnade gekannt. Doch dieses armselige, winselnde Weib hier brachte ihm keine Ehre, wenn er es tötete.
Wolf-Hunter sagte etwas in seiner gutturalen Sprache. Sie schüttelte verständnislos den Kopf. Er zeigte nach Osten, dorthin, woher sie gekommen waren, und spuckte vor ihr aus. Da wusste sie, was er meinte. Ja, wenn sie jetzt die Wahl gehabt hätte, würde sie sofort nach dort wieder zurückgehen – sogar barfuß.
In der Pose des überlegenen Siegers, der sich alles erlauben konnte, sogar Milde gegenüber einem Besiegten, steckte er das Messer zurück. Sie wagte nicht, ihren Arm wieder über ihr Gesicht zu legen, sie wagte gar nichts mehr. Jetzt wünschte sie sich, an der Stelle der Frau zu sein, die auf dem Leichenberg bei ihrem Mann und den anderen Toten lag. Was würden diese wilden Bestien weiter mit ihnen machen? Was würden sie noch alles auszuhalten haben? Sie war ohne jede Hoffnung und fügte sich in ihr Schicksal. Was auch immer noch kommen würde, sie hatte keine Kraft mehr, sich dagegen aufzulehnen. Erst als sich der junge Krieger von ihr entfernte, kroch sie auf allen vieren zu den anderen Frauen zurück. War der Traum vom eigenen Land das hier wert gewesen? Ihre Männer waren alle tot – und sie wahrscheinlich auch schon bald. Die Frauen drängten sich wieder eng aneinander und versuchten, ihre erlittenen Verletzungen so gut es ging irgendwie zu verbinden. Sie hatten dafür nur ihre Bekleidung und rissen sich Streifen von den weiten Unterröcken, dabei jeden Blick zu den Indianern hin vermeidend. Deshalb sahen sie auch nicht, dass einer von ihnen, Red-Eagle, herangeritten kam.
Sein breites Lächeln galt seinen Kameraden, die in der Nähe der Frauen weiter Kunststücke auf ihren Mustangs vollführten. Einer wollte den anderen übertreffen, angeben, besser sein. Seine wohlklingende Stimme übertönte ihr Gejohle. Es musste schon etwas Wichtiges sein, sonst hätte er sie nicht unterbrochen. Red-Eagle deutete auf die Prärie hinaus, und nun sahen es auch die anderen. Noch tauchten sie nur als bewegliche Punkte im Wellental der Prärie auf und unter. Flimmernde Gestalten, die im Licht zerflossen. Aber sie kamen stetig näher, wurden deutlicher, zeichneten sich alsbald dunkel gegen die Sonne ab. „Wir bekommen Besuch. So ein Glück an einem einzigen Tag“, rief er noch einmal.
Wolf-Hunter schlenderte dicht an der Frau, die er mit seinem Messer bedroht hatte, vorbei. Sofort begann sie zu zittern. „Vielleicht kann ich die hier ja gegen ein neues Pferd eintauschen“, damit zeigte er mit dem Kinn auf sie.
Er grinste, den Kopf schiefgelegt. Da sah er auf einmal wie ein Lausbub aus, der sich auf sein neues Spielzeug freute. Die anderen um ihn herum lachten. Der Vorschlag gefiel ihnen ebenso, das wäre ganz nach ihrem Sinn. Eilig sammelten sie ihr Plündergut zusammen, den Rest konnten die Neuankömmlinge gerne haben. Icy-Wind war nicht zu sehen; er gab auch keine Antwort, als sie nach ihm riefen. Antelope-Son, der sich als ihr Anführer ein wenig für ihn verantwortlich fühlte, zuckte nur die Schultern. Der Junge hatte sicher etwas Besseres zu tun, als sich um Kochtöpfe zu kümmern. Und doch fand er es ratsam, dass sie alle gemeinsam die Ankömmlinge empfingen – man wusste ja nie.
Unterdessen ritt Red-Eagle auf die Prärie hinaus, um sie in Augenschein zu nehmen.
Antelope-Son rief noch einmal nach Icy-Wind. Als wieder keine Antwort kam, ging er zu der Stelle, an der er ihn mit seiner Kriegsbeute vermutete. Im nächsten Wellental fand er ihn. Er stand neben der auf dem Boden liegenden, halb entkleideten jungen Frau und warf ihr gerade die Fetzen ihres Kleides zu, während der Ältere näher trat. Ihr Blick auf ihn aus weit aufgerissenen, blutunterlaufenen hellbraunen Augen drückte Panik aus, ja, unendliche Qual, Verzweiflung, Schmerz – alles auf einmal. Das wie reife Kastanien aussehende Haar hing ihr wild um die Schultern. Sie war furchtbar zugerichtet. Während sie mühsam aufstand, lief Blut an ihren Beinen hinunter, ihr zerfetztes Unterkleid war rot. Auf ihren Armen konnte man deutlich Fingerabdrücke sehen und einen tiefen Schnitt. An ihrem Kinn prangte eine Platzwunde – und diverse andere Verletzungen bezeugten, wie sehr sie sich gewehrt haben musste. Antelope-Son schüttelte angewidert den Kopf.
Icy-Wind ignorierte seinen tadelnden Gesichtsausdruck und sagte stattdessen gleichgültig: „Hab schon gesehen, Kotsoteka.“ Er winkte ab, als der ältere Mann etwas erwidern wollte. „Ich gedenke nicht, mit ihnen zu teilen – schon gar nicht diese hier“, machte er seinen Standpunkt klar.
Die junge Frau stolperte, weil er sie ungeduldig vorwärts trieb, knickte mit den Beinen weg und brach zusammen. Ungerührt bearbeitete er sie mit einem Fuß, bis sie sich wieder aufraffte. Sie stolperte erneut, riss sich zusammen und schlurfte nur mit einem Schuh, schwer atmend vor den beiden Kriegern her. So kamen sie bis zu den sich eng zusammendrängenden Frauen. Die sahen sie weder an, noch wechselten sie ein einziges Wort mit ihr. Hockten nur einfach da, vor Angst schlotternd, eingeschüchtert, eine mit einer tiefen Schulterwunde, andere nur leicht verletzt – wie Vieh, dass man zusammengetrieben hatte.
Die Jüngere, die dieser Anblick trotz ihres eigenen Leids erbarmte, fuhr sich mit fahrigen Bewegungen durch die langen, nach allen Seiten hin abstehenden lockigen Haare. Voller Entsetzen blickte sie dann auf ihre Finger, in denen ein Büschel Haare war. Das musste passiert sein, während Icy-Wind sie rücksichtslos hinter sich her gezerrt hatte. Eine Kriegsbeute, nichts weiter – und als solche würde er sie auch weiterhin behandeln. Niemanden kümmerte es, was aus ihr wurde. Er konnte sie töten, am Leben lassen, sie weiterreichen oder an die Comancheros verkaufen – ganz wie es ihm gerade beliebte. Jetzt, entgegen seiner ersten Entscheidung, gefiel es ihm nun, sie mit zurück in ihr Lager in den Llano Estacado zu nehmen. Er bedeutete ihr, sich neben die anderen Frauen zu setzen – und sie gehorchte, wissend, dass es keine Möglichkeit zur Flucht für sie gab. Inzwischen hatten die Comanchen ihre Ersatzpferde mit der Beute beladen. Manch einer war noch im Zweifel, ob er lieber dies oder jenes mitnehmen sollte.
Die Näherkommenden sollten ihnen die Wahl bereits wenig später abnehmen. Sie kümmerten sich um den Rest der Beute, und auch das Schicksal der vier Frauen schien mit dem Eintreffen der befreundeten Kotsoteka-Comanchen besiegelt zu sein. Sie waren aus dem Balcones Escarpment gekommen und mussten die Comancheria noch ca. 240 Meilen entlangreiten, um am Red-River wieder mit ihren Leuten zusammenzustoßen.
Bei ihnen befanden sich vierzig Ersatzpferde. Einige mussten gestohlen sein, denn das Zaumzeug und die Sättel sahen fremdartig aus. Sie ritten lautstark johlend zu den wartenden Comanchen, um triumphierend und stolz von ihren Taten entlang der texanischen Grenze zu berichten. Pferdestehlen galt unter ihnen als beliebter Sport. Schnell brannten drei Lagerfeuer, an denen sich die Krieger grüppchenweise niederließen. Die Neuankömmlinge hatten frisches Fleisch dabei, das sie großzügig verteilten. Das war eine willkommene Abwechslung zu dem Trockenfleisch, das die sechs Krieger in den letzten Tagen essen mussten. Bald breitete sich der Geruch gebratenen Fleisches aus. Den Frauen war trotzdem nicht nach Essen zumute. Stumm harrten sie der kommenden Dinge. Doch als ihnen achtlos Essensreste hingeworfen wurden, fielen sie wie Tiere darüber her.
Red-Eagle hielt sich meist aus den Gesprächen der Krieger heraus. Besonders was Icy-Wind betraf, hatte er seine eigenen Vorstellungen. Während dieser ganzen Zeit lag er ein gutes Stück abseits, nahe der Pferdeherde. Hinter ihm schliefen die Kinder. Es war nicht etwa so, dass er das, was Icy-Wind und diese Frau betraf, verabscheute oder verurteilte. Für ihn bedeutete das nichts anderes als sein Recht – etwas, das zum Krieg gehörte, genau wie das Skalpieren oder Beutemachen. Manche taten es eben und manche nicht. Diese Art, mit Frauen als Beute umzugehen, kam für ihn wie für viele weitere Krieger nicht in Frage. Dass er dem nichts abgewinnen konnte, war einzig und allein seine Sache.
Niemandem kam es in den Sinn, ihn deshalb zu verurteilen. Jeder Comanche hatte das Recht, zu tun oder zu lassen, was ihm beliebte. Das war ihre Art von Freiheit. Solange er der Gemeinschaft damit nicht schadete, ging es nur ihn etwas an. Was auch immer jemand mit seiner Beute machte, es hatte keinerlei Bedeutung.
So verbrachten sie die Nacht mit Essen und Schwatzen. Niemand achtete groß darauf, womit Icy-Wind sich inzwischen die Zeit vertrieb.
Kaum dass die Morgenröte den Horizont färbte, wurde mit den Kotsoteka um die vier Frauen gefeilscht. Icy-Wind stellte die junge Weiße nicht zur Verfügung. Zwar verschwendete er einige Überlegungen daran, kam dann aber doch zu dem Schluss, dass diese Frau mit den dunkelroten Haaren mehr wert war als ein Beutepferd der Tejano, so verlockend dieses Angebot auch sein mochte. Seitdem sie keine Macht mehr über ihn besaß, war er davon überzeugt, dass sie seiner Medizin auch nicht schaden konnte. Außerdem gab es da ja immer noch die Möglichkeit, sie an die Comancheros zu verkaufen, machte er sich etwas vor. Denn im Grunde genommen hatte er sich bereits anders entschieden. Jetzt spielte er sogar mit dem Gedanken, sie ganz für sich zu behalten, Crow-Wing hin oder her. Er konnte sich durchaus zwei Frauen leisten.
Nach langen, zähen Verhandlungen zogen die Kotsoteka mit den Frauen ab. Vier Comanchen waren um einige Pferde reicher und mit dem Tausch mehr als zufrieden. Wenn die Frauen Glück hatten, würden sie irgendwann von den Comancheros ausgelöst werden und konnten zurück, anstatt bei den Kotsoteka ein Sklavendasein zu fristen. Wahrscheinlich hatten die Männer das ohnehin vor, denn die Frauen waren alle nicht mehr jung, was ihnen natürlich nicht entgangen war. Niemand konnte ein Interesse daran haben, sie als Ehefrauen zu behalten.
Während sie in nordwestlicher Richtung verschwanden, blickte sich eine von ihnen ein letztes Mal um. Sie nahm das Bild, das sich ihr bot, mit ins Exil. Sah, wie ein junger, arrogant dreinblickender Indianer eine zerbrechlich wirkende junge Frau auf einem Pferd festband, die offenen schwarzen Haare vom lauen Sommerwind zerzaust. Sie hörte, wie er laut lachte und ihnen etwas Anzügliches in dieser barbarisch klingenden Sprache nachrief. Dann verschleierten die Tränen, die ihr die geschwollenen Wangen herunterliefen, den Blick auf ihre ehemalige Reisegefährtin.
Die Comanchen sammelten ihre Pferde ein, fügten die eingetauschten den Ersatzpferden hinzu und saßen auf. Red-Eagle machte den Schluss. Neben seinem liebsten Kriegspony, das er selbst ritt, trabte das Pferd, auf dem die beiden Knaben saßen. Das kleine Mädchen mit den dicken braunen Zöpfen, die es mühsam mit eigenen Händen heute Morgen geflochten hatte, saß jetzt hinter ihm, die kleinen Arme so weit sie es vermochte um seinen Oberkörper geschlungen. Ab und zu erhaschte sie einen aufmunternden Blick von den beiden Brüdern, die neben ihr ritten.
Icy-Wind setzte sich sogleich an die Spitze der kleinen Gruppe, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Ein Rohlederriemen verband sein Pferd mit dem, auf dem die junge Frau saß, die Füße unter dem Bauch des Tieres zusammengebunden. Der Kopf der jungen Frau lag müde und zerschunden auf dem Hals des Pferdes. Ihre Haare – zerzaust, dunkelrot trotz Staub und Schmutz in der aufgehenden Sonne schimmernd – fielen lang und wirr über den Widerrist des Tieres.
Auf ihrem Ritt nach Westen kam die kleine Gruppe schnell voran. Die Sonne stach unbarmherzig auf ihre Körper, doch das machte den dunkelhäutigen, zähen Comanchen nichts aus. Ihre Lider waren wie gegerbtes Leder, und um in die Ferne sehen zu können, schlossen sie sie bis auf einen winzigen Spalt. Das endlos anmutende Grasmeer breitete sich vor ihnen aus. Einzelne Kreideplateaus tauchten immer öfter aus dem weiten Hügelland hervor. Über ihnen spannte sich ein blendend heller Himmel – ohne eine einzige Wolke. Nur manchmal brachte ihnen ein laues Lüftchen angenehme Kühlung. Die Mustangs liefen unermüdlich durch das hier fast brusthohe Gras, das aber, je weiter sie nach Südwesten ritten, immer trockener wurde. Erst gegen Sonnenuntergang machten sie die erste Rast. Die Pferde ließen sie frei laufen, nur die Beutepferde der Siedler und die frisch eingetauschten wurden gehobbelt. Red-Eagle teilte seinen Wasservorrat und den mitgebrachten Pemmikan mit den Kindern. Die ungewohnte Nahrung wurde dankbar entgegengenommen. Wolf-Hunter lag zusammen mit drei Männern neben niedrigem Gesträuch, das ihnen etwas Schatten bot. Ein Feuer machten sie nicht an, es gab zu wenig Brennholz dafür; außerdem hatte sich keiner von ihnen auf die Jagd nach Wild gemacht.
Icy-Wind zerrte seine Kriegsbeute vom Pferd. Sie fiel wie ein nasser Sack auf den harten Boden. Er stieß mit dem Fuß nach ihr und deutete auf einen noch grünen Strauch, etwas entfernt von den anderen. Völlig erschöpft wankte sie vorwärts. In ihrem Kopf begann es zu hämmern. Ungewohnt, so lange der prallen Sonne ausgesetzt gewesen zu sein, ließ sie sich dort einfach auf den Boden fallen. Kraftlos, ausgelaugt, mit trockenen, aufgerissenen Lippen beobachtete sie den Mann, der ihr so verhasst war. Icy-Wind hatte anscheinend endlich Erbarmen. Nachlässig warf er ihr seinen Wasserschlauch zu, den sie hastig aufstöpselte und dann gierig daraus trank. Ihre Augen folgten ihrem Peiniger aufmerksam – wie ein Tier, das nach einem rettenden Ausweg sucht.
Icy-Wind ging zu Wolf-Hunter und vertiefte sich mit ihm in ein Gespräch, das für ihre Ohren mit diesen unaussprechlichen Wörtern so fremdartig klang, dass es sie faszinierte. Unter normalen Umständen hätte sie nachgefragt, sich diese Worte ausgiebig durch Gesten erklären lassen; das hier jedoch – nein. Sie war als Lehrerin in Deutschland ausgebildet worden und hatte gehofft, im Westen dieses Landes als Erzieherin eine Stellung in einer der deutschen Siedlungen zu bekommen. Hiermit aber hätte sie nie in ihrem Leben gerechnet. Doch sie hatte trotz allem nicht vor, so schnell aufzugeben, und sann bereits darüber nach, wie sie diesen Männern entkommen konnte. Wohin – diese Frage stellte sie sich nicht. Einen Schritt nach dem anderen, erinnerte sie sich an die Ratschläge ihrer Großmutter. Irgendwann hörte sie nichts mehr von der Unterhaltung der Männer, sondern schlief einfach ein. Zusammengerollt wie ein Embryo lag sie da, von den letzten Sonnenstrahlen berührt,sich nur ab und zu herumwälzend, als träumte sie einen schrecklichen Traum.
Die Nacht zog herauf, und es wurde unangenehm kühl. Der Comanchenmond hatte eine winzige Ecke verloren. Tausende silbern blinkende Sterne standen hoch oben am Firmament. Obwohl Pferde in der Dunkelheit besser sehen konnten als Menschen, und der Mond immer noch genügend Licht spendete, wollten die Comanchen nicht weiterreiten. Sie befanden sich tief in ihren eigenen Gebieten, der Comancheria, und niemand würde sie hier behelligen. Erst kurz vor Sonnenaufgang wollten sie ihren Ritt wieder fortsetzen.
Red-Eagle breitete eine Büffelhautdecke über die dicht aneinandergeschmiegt liegenden Kinder aus. Er selbst ging zu seinem liebsten Kriegspony, dem Schimmel, um sich in seine Nähe zu legen. Wachen aufzustellen kam ihnen nicht in den Sinn. Die arroganten, selbstsicheren Comanchen sahen dafür nicht die geringste Veranlassung. Gegen Mitternacht kam Icy-Wind aus der Gesellschaft der anderen Krieger zurück zu seiner Beute. Sie mit dem Fuß gegen den Rücken stoßend, holte er nochmals aus und traf ihren Kopf. Hochschreckend glaubte sie noch in einem Traum gefangen zu sein, der auf grausame Weise Wirklichkeit wurde. In Icy-Winds einer Hand lag eine Schlinge, die er ihr über den Kopf warf und zuzog. Als sie nach Luft schnappte, lachte er auf und befestigte sie so geschickt an einem der stärkeren Äste über ihr, dass sie ihren Kopf nicht mehr senken konnten, ohne sich dabei selbst zu erdrosseln. Jedes Mal, wenn sie gerade wieder am Einschlafen war und ihr der Kopf auf die Brust fiel, wurde sie brutal hochgerissen. Damit sie sich nicht bequemer hinsetzen konnte, waren ihre Hände zusätzlich noch an die Füße gefesselt. Die ganze restliche Nacht über fand sie keinen Schlaf. Icy-Wind hatte begonnen, seine anfängliche Schwäche ihr gegenüber in Macht umzuwandeln. Der Krieger amüsierte sich, ihr dabei zuzusehen, wie sie mit der Schlinge kämpfte. Er hatte sich in seine Decke eingewickelt, um den Schlaf nachzuholen, der ihm seit Tagen fehlte.
Die Sterne verblassten langsam, da lag die weiße Gefangene völlig übermüdet, frierend, wund und zerschunden von den Bemühungen, am Leben zu bleiben, mit hochgerecktem Hals halb auf der Seite. Über dem östlichen Horizont sah man schon den ersten rötlichen Schimmer, der den neuen Morgen ankündigte. Mustangs schnaubten zufrieden, ein Kriegspony wieherte. Die Krieger begannen sich verschlafen aus ihren büffelledernen Decken zu winden.
Erste Strahlen der aufgehenden Sonne fingen sich im Haar der jungen Frau. Das Dunkelrot begann zu glühen. Icy-Wind jedoch, der diesen Moment unendlicher Schönheit verpasste, stand vor ihr und pisste auf ihre Füße.
Sie ritten an diesem Tag, bis die Sonne sich dem westlichen Horizont zuneigte, dann erst machten sie Rast. Icy-Wind zerrte seine Gefangene wieder wie am Vortag vom Pferd. Sie hatte versucht, während des Rittes zu schlafen, war aber zweimal aus dem Sattel gerutscht, obwohl er ihre Füße unter dem Pferdebauch zusammengebunden hatte. Rücksichtslos trieb er sie jetzt vor sich her bis zu dem Platz, wo die anderen bereits lagerten. Großzügigerweise gab er ihr wieder aus seinem Wasservorrat zu trinken. Dann ging er zurück zu seinem Pferd, um in seinen Satteltaschen nach Pemmikan zu wühlen. Achtlos warf er ihr einen Beutel davon zu, doch er landete etwas von ihr entfernt. Sie versuchte, sich danach zu bücken, da gaben ihre Beine unter ihr nach. Zu der Stelle robbend, raffte sie das Essen an sich und öffnete gierig den Verschluss. Das erste Mal seit ihrer Gefangennahme bekam sie von Icy-Wind etwas zu essen. Er wollte sie also nicht sterben lassen, so viel stand fest. Erst jetzt bemerkte sie das bewusst. Ohne den Kopf zu heben, begann sie ihren Heißhunger zu stillen. Icy-Wind stand unterdessen vor seinem Pferd und band von dem wenigen doch noch von ihm mitgenommen Plündergut etwas los, dass, wie sie sah, ein zusammengerolltes Handtuch war. Anscheinend kannte der Comanche den Inhalt nicht, denn er warf ihr das Tuch, so wie es war, vor die Füße. Sofort griff sie danach, riss es an sich, bemüht um eine gleichgültige Miene. Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie wusste genau, dass sich in diesem Tuch das Rasierzeug eines der Männer befand, dessen Skalp jetzt an der Lanze ihres Peinigers hing. Scheinbar ruhig, obwohl ihr das Herz bis zum Hals hinauf klopfte, blickte sie hinüber zu den Kriegern.
Icy-Wind ging gerade zu Wolf-Hunter, der neben Antelope-Son und zwei anderen Kriegern stand. Red-Eagle führte die Kinder über einen kleinen Hügel weiter weg von den anderen. Da löste sie die Schnüre, mit denen das Tuch umwickelt war, vorsichtig, ohne die Männer aus den Augen zu lassen. Mit zitternder Hand ertastete sie das Stück Seife, den Pinsel, das kleine schlanke Rasiermesser. Als sie das Tuch über ihre zerschundenen Beine breitete, sah niemand, wie sie das kleine Messer in dem zerrissenen Ausschnitt ihres Kleides verschwinden ließ. Die Schnüre band sie sich um die Taille, damit die kleine Waffe nicht hinunterrutschen konnte. Die Seife steckte sie zu der anderen in die Tasche ihres Kleides, den Pinsel und das Band zum Schärfen verscharrte sie mit den Füßen in der Erde. Sie wollte kein Risiko eingehen, obwohl sie nicht glaubte, dass die Comanchen wussten, dass zu Pinsel und Seife auch ein Rasiermesser gehörte, wenn sie diese Teile hier finden sollten. Wieder blickte sie zu den Männern. Icy-Wind schien mit den anderen etwas zu verhandeln. Laute Worte gingen hin und her. Zuerst schüttelte er den Kopf, schaute sich nach ihr um, musterte sie eine Weile und nickte.
Es ging um sie – um eine Gefälligkeit, die sich Antelope-Son erbat, aber das konnte sie ja nicht wissen.
Ein Mustang schnaubte, Insekten belästigten die Tiere genauso wie die Menschen. Antelope-Son und ein anderer Comanche erhoben sich von ihrem Lagerplatz, gingen zu ihren Mustangs und ritten fort, bewaffnet mit Köcher, Pfeil und Bogen. Sie verschwanden im Hügelland, den Spuren von Gabelböcken, die ihren Weg bereits seit Mittag kreuzten, folgend. Wolf-Hunter kam mit den beiden Jungen zu der weißen Gefangenen, musterte sie scharf, dann verzog er angewidert den Mund. Er sagte etwas in seiner Sprache zu den Kindern, und zum Erstaunen der Frau schienen sie seine Worte bereits zu verstehen. In ihren kleinen Händen hielten sie lange Stöcke, die sie irgendwo aufgetrieben haben mussten. Wolf-Hunter deutete mit einer weit ausholenden Geste um sich, worauf sich die Kinder entfernten. Es dauerte nicht lange, da kamen sie mit aufgespießten trockenen Büffeldunghaufen beladen zurück. Auch einer der Comanchen hatte sich am Einsammeln dieses eigenartigen Brennmaterials beteiligt. Sie stapelten alles zu einem Haufen auf und blickten dann erwartungsvoll in die Richtung, in der die beiden Krieger verschwunden waren. Es dauerte auch nicht lange, da tauchten sie im hohen Gras wieder auf. Sie wurden mehr als freudig begrüßt, denn von dem Widerrist des einen Mustangs hing ein erlegter Gabelbock. Das Lagerfeuer brannte bereits, von Wolf-Hunter entzündet. Die beiden Jungen, die ihn dabei aufmerksam beobachteten, legten ihr eingesammeltes Brennmaterial nach Anweisungen des jungen Kriegers nach; anscheinend machte ihnen das solchen Spaß, dass sie zum ersten Mal seit ihrer Gefangennahme lachten.
Die weiße Gefangene beobachtete wachsam das Tun um sich herum. Das Wild wurde zerlegt, auf von der Rinde befreite Stöckchen gespießt, über die Flammen gehalten, bis es gar war. Wolf-Hunter, der nicht auf sein Fleisch achtgab, verbrannte es an einigen Stellen. Er biss das verbrannte Fleisch ab, spuckte es achtlos auf den Boden, um dann den innen noch blutigen Teil genüsslich zu kauen. Niemand tadelte ihn, sie lachten nur. Die weiße Frau sah erstaunt, wie die beiden Jungen herzhaft in die ihnen zugewiesenen Fleischstücke bissen, als hätten sie nie etwas anderes gegessen. Red-Eagle tauchte auch auf, holte sich seinen Anteil am Fleisch und verschwand wieder.
Icy-Wind musterte kauend seine Beute, nahm einen verkohlt am Boden liegenden Knochen und warf ihn ihr vor die Füße. Sie beugte sich vor, hob ihn auf und betrachtete ihn von allen Seiten. Er war restlos verbrannt, und sie würde hungrig bleiben. Trotzdem nagte sie verzweifelt, den Tränen nahe, an dem Knochen, immer den Blick auf ihren Peiniger gerichtet. Wolf-Hunter, dem das auffiel, schubste den neben ihm sitzenden Icy-Wind mit dem Ellbogen an und deutete mit dem Kinn, an dem das Fett vom Essen tropfte, auf die Frau. „Wenn du nicht willst, dass sie dir vom Pferd rutscht, gib ihr ein bisschen mehr Fleisch zu essen“, lautete sein Kommentar. Mit schmierigen Fingern suchte er ein gutes Bratenstück aus. „Da, gib es ihr. Wenn sie jetzt stirbt, hat niemand was davon. Die ganze Mühe, die du dir mit ihr gemacht hast, ist dann umsonst gewesen.“
Icy-Wind, dem der Hohn in der Stimme des anderen nicht entgangen war, schien das egal zu sein. Gleichgültig riss er mit den Zähnen an seinem Fleisch. Doch er musste darüber nachgedacht haben, denn irgendwie schien ihm das, was Wolf-Hunter eben gesagt hatte, nicht zu gefallen. Ein vernichtender Blick maß den Freund, dann spuckte er verächtlich einen Knochensplitter in seine Richtung. „So schnell stirbt diese da nicht. Die ist so zäh wie eine Bergkatze. Die Augen hat sie ja schon von ihr.“ Sein hageres Gesicht hellte sich jetzt auf, die dunklen, schmalen, eng zusammenstehenden Augen glitzerten im Feuerschein. Ihm war etwas klar geworden. Sich mit den fettigen Fingern durch die offenen Haare streichend, stellte er fest: „Sie ist gute Kriegsmedizin, Wolf-Hunter, glaub mir. Ich lasse sie schon nicht verhungern.“ Sein Blick huschte zu ihr. „Die Aufsässigkeit habe ich ihr ja schon abgewöhnt, vielleicht behalte ich sie ja doch.“ Die letzten Worte kamen so leise gemurmelt, dass Wolf-Hunter sie nicht mehr verstand.
Antelope-Son, der auf der gegenüberliegenden Seite des Feuers kauerte, musste die Unterredung verfolgt haben, denn er nickte zustimmend. Sein von Narben entstelltes Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. „Wolf-Hunter hat recht – bring ihr ein bisschen Fleisch, sie sollte bei Kräften bleiben, besonders, wenn ich da an meine Bitte denke.“
Icy-Wind biss sich auf die schmale Unterlippe; es schien ihn zu verärgern, dass man ihn an etwas erinnerte, zu dem seine Zustimmung noch ausstand. Aber er tat, wie sie wollten, stand auf und brachte ihr ein halb gar gebratenes Stück Fleisch zu essen. Ohne sie weiter eines Blickes zu würdigen, setzte er sich wieder zwischen seine Leute.
Red-Eagle erschien erneut und setzte sich zu ihnen ans Feuer. Er hatte den beiden Jungen und dem kleinen Mädchen ein Nachtlager hinter einem der Hügel bereitet. Eine Weile musterte er einen der Krieger nach dem anderen nur stumm, bevor er das Wort an sie richtete. Dann aber klang seine Stimme laut und bestimmt. „Wir sollten einen Abstecher zum Red-River machen und unsere Wasservorräte auffüllen. Ich will das Risiko nicht eingehen, dass die unterirdische Quelle, die hier auf unserem Weg liegt, ausgetrocknet ist. In dieser Jahreszeit müssen wir damit rechnen.“ Ohne eine Antwort abzuwarten stand er auf. Das war kein Vorschlag – nicht in diesem Ton, wurde den anderen klar. Die jungen Männer blickten sich, erstaunt über seinen befehlsmäßigen Ton, verdutzt an. Doch nach kurzem Nachdenken mussten sie sich eingestehen, dass er recht haben könnte.
„Deinen Rat zu befolgen, bedeutet, dass unser Heimweg dann länger dauert. Sollte die Quelle im Canyon trotzdem noch immer gutes Wasser führen, hätten wir den Umweg umsonst gemacht. Aber gut, wenn du es so siehst und das Risiko nicht eingehen willst, machen wir das eben so.“ Icy-Winds Worte klangen zwar ein wenig missbilligend, doch er wartete nicht erst auf eine Antwort der anderen, sondern stand auf. Einen Moment lang maßen sich die beiden jungen Männer mit abschätzenden Blicken. Ihr Machtkampf dauerte nun schon seit ihren Kindertagen. Icy-Wind fand, dass er noch einen kleinen Seitenhieb austeilen musste; es ging nicht ohne. „Deine eigenen Wasservorräte sind anscheinend knapp geworden. Kein Wunder, du musstest dich ja mit dem Kleinkinderkram belasten. Wenn du willst, kannst du einen Schlauch von mir haben, solltest du unterwegs Durst bekommen.“ Anmaßend machte er eine großzügige Geste hin zu seinen Sachen. „Bedien dich ruhig.“
Red-Eagle beherrschte sich. Lediglich seine geballte rechte Hand zeigte, wie ihn diese anmaßenden Worte getroffen hatten. In seinem schönen Gesicht zuckte es kurz. „Danke, aber meine Vorräte sind ausreichend“, lautete seine Antwort.
Wolf-Hunter strich sich über seinen wohlgeformten Bauch. „Also, lasst uns jetzt nicht streiten.“ Er wollte, dass die gute Stimmung zwischen ihnen nicht durch diesen immerwährenden Zwist der beiden getrübt wurde.
„Icy-Wind“, hakte jetzt Antelope-Son nach, um dem Geplänkel ein Ende zu machen. „Ich denke, jeder von uns sollte sich um seine eigenen Sachen kümmern. Kümmere du dich um deine Kriegsbeute. Doch sollte sie dir lästig werden, helfe ich gerne aus. Du kennst ja mein Angebot.“ Sein Narbengesicht verzog sich belustigt. Er drehte den Kopf zu der weißen Frau und betrachtete sie lüstern.
Icy-Wind zögerte. Wenn er sie für sich allein haben wollte, musste er das jetzt sagen und auch das Angebot von Antelope-Son ein für alle Mal ablehnen. Noch hatte er die Wahl. Die Augen der anderen waren gespannt auf ihn gerichtet. Sein arrogantes, prahlerisches Wesen kämpfte gegen das Gefühl in seinem Innersten an. Jemand wie er legte sehr großen Wert auf Anerkennung, auf Ruhm und Ehre. Besonders die Bewunderung seiner Leute bedeutete ihm viel. So viel, dass er Abstriche machen sollte?
Großspurig baute er sich vor dem wesentlich älteren Krieger auf. Nein, sagte er sich, während ihm verschiedene Möglichkeiten durch den Kopf gingen.
Red-Eagle verzog bei diesem Anblick sein Gesicht herablassend. Schon hatte er eine Bemerkung auf der Zunge, beherrschte sich jedoch, wandte ihm den Rücken zu und zog sich zurück. Ein knappes Nicken, und Icy-Wind traf seine Entscheidung. Das Lagerfeuer knisterte, als er mit rauer, etwas belegter Stimme das Wort ergriff. „Ich werde schon allein mit ihr fertig, Antelope-Son. So schwer ist das gar nicht. Wenn ich Hilfe brauche, wende ich mich gerne zuerst an dich, alter Mann!“ Es sollte scherzhaft klingen und gleichzeitig wollte er damit Antelope-Son ein bisschen ärgern. Doch was war, wenn der sein Angebot erneuerte? Kurz fürchtete er sich vor seiner eigenen Wortwahl. Als Antelope-Son jedoch zu lachen begann, ja, ihm den kleinen Scherz nicht einmal übel nahm, atmete er erleichtert auf. Es würde keine zweite Aufforderung geben. Auch die anderen lachten jetzt.
Icy-Wind drehte sich zu der jungen Frau um. Sein breiter Rücken dehnte sich, während er Luft holte. Sie saß noch immer auf dem gleichen Platz wie zuvor. Blinzelte nervös, gespannt, was nun wieder kommen würde. Er streckte den Arm aus und winkte mit dem Zeigefinger. Es war klar, was er ihr damit sagen wollte.
Langsam, viel zu langsam, erhob sie sich. Den Rücken zur untergehenden Sonne, aufrecht und keineswegs unterwürfig, stand sie vor ihm, ohne seiner Aufforderung nachzukommen. Ihre dunkel erscheinende Silhouette war wie von dem Feuer übergossen, das im Westen am Horizont brannte. Orange, silberne und rote Strahlen glühten wie ein Flammenkranz in ihrem kastanienfarbenen Haar. Ihr Gesicht lag im Schatten. Niemand sah den Hass in den hellbraunen Augen. Ihre nackten, zerschundenen Beine zitterten, suchten nach einem festeren Stand. Schürfwunden, offen und bereits eitrig, zogen sich an ihnen bis unter ihren stinkenden Körper. Nur das verdreckte, zerrissene Kleid bedeckte spärlich ihre Blöße. Sie hatte sich seit dem Überfall nicht mehr gewaschen. Ihre Schenkel, wundgescheuert vom Reiten, klebten nicht nur vom Blut. Den rechten Arm presste sie über ihre an vielen Stellen von Insekten zerbissenen, aufgerissenen Brüste – dorthin, wo kein Stoff mehr reichte. Das Kinn hochgereckt und die Mundwinkel verächtlich heruntergezogen, so starrte sie jetzt ihren Peiniger an.
Icy-Wind, der vergeblich versuchte, ihre Gesichtszüge zu erkennen, blickte zu ihr hin. Jetzt bog sie den Kopf etwas zur Seite. Durch den Schatten, der noch immer auf ihrem Gesicht lag, trafen sich ihre Blicke. In diesem Moment sahen ihre Augen aus wie glühende Kohlen. Wie die Augen einer Bergkatze, die auf etwas lauert. Der junge Krieger missachtete diese Warnung, doch es lief ihm eiskalt den Rücken hinunter. Die rotgoldenen Strahlen der untergehenden Sonne glühten nicht mehr nur in ihrem Haar, sie hatten sich wie ein Kranz um ihren Kopf gelegt. Der Zauber dieses Moments ließ sich nicht leugnen. Jeder der Männer musste es sehen. Alle blickten wie gebannt von dieser Erscheinung zu Icy-Wind.
Langsam senkte er seine ausgestreckte Hand. Zugleich bemerkte Wolf-Hunter Red-Eagle, der wie aus dem Boden gewachsen plötzlich hinter der weißen Frau stand. Icy-Wind sah alle Blicke auf sich ruhen und wusste, dass er etwas tun musste. Niemand sollte von ihm sagen können, er fürchtete sich vor der Magie einer weißen Frau oder ließe ihr diese Ungehorsamkeit ungestraft durchgehen. Er entschied sich für die brutale Art. Doch noch bevor sich seine Finger um ihr Handgelenk schließen konnten, erstarrte er mitten in der Bewegung. Blitzschnell hatte die weiße Frau ein aufgeklapptes scharfes, kleines Messer aus ihrem Kleid gezogen und hielt es sich an die Kehle. Die Botschaft war unmissverständlich. Lieber wollte sie sterben, als weitere Erniedrigungen zu ertragen.
Die Zeit schien stillzustehen.
Icy-Wind reagierte verwirrt, in seinem Kopf herrschte völlige Leere. Was diese weiße Frau hier zu tun beabsichtigte, konnte er nicht einordnen; das ging über seine Vorstellungskraft. Auch die anderen sahen sich ratlos an. Niemand von ihnen wollte sie tot sehen – und schon gar nicht von eigener Hand. Diese Medizin war schlecht, sehr, sehr schlecht.
Während sie die Frau immer noch anstarrten, lief ein Blutstropfen an ihrem Hals herunter. Sie drückte das scharfe Rasiermesser tiefer in die Haut. Einen Schritt, dachte sie entschlossen, macht auch nur einer von diesen verdammten Comanchen einen einzigen Schritt auf mich zu, töte ich mich. In ihrem regungslosen Gesicht schienen nur die großen braunen Augen lebendig zu sein. Unbewusst zählte sie die Männer. Verdammt, einer fehlt – wo ist der mit dem hübschen Gesicht?
„Was soll das, verrückte Tejano?“, fand endlich Icy-Wind seine Sprache wieder, wenn auch nur zaghaft. Doch er stand still, rührte sich nicht vom Fleck. Sie verstand nur das eine Wort: Tejano.
„Ihr verdammten Hurensöhne – dreckiges, verrohtes Vieh!“, schrie sie ihnen in ihrer Muttersprache, auf Deutsch, entgegen, das R besonders betonend. „Verdammt, verdammt, ich bin keine Tejano!“ Schmerz kroch ihre Kehle hoch und verengte ihre Luftröhre. Sie wollte doch nur nach Kalifornien, um dort Kinder in einer Schule zu unterrichten. Ein aufkeimendes Schluchzen krampfhaft hinunterschluckend, ihr Messer fest gegen die Halsschlagader gepresst, spie sie ihnen, jetzt englisch, nur ihren Namen deutsch aussprechend, entgegen: „Ich bin Adele Bergmann, keine Tejano! Ich habe doch mit euch überhaupt nichts zu schaffen!“
Natürlich verstanden sie sie nicht; den Männern wäre das auch egal gewesen, wenn sie die Worte verstanden hätten. Für sie waren alle Eindringlinge in ihr Land Tejano und Taibo, Weiße.
Was jetzt, ging es ihr durch den Kopf, was tue ich jetzt? Diese Mörder verstehen doch kein Wort. Sie werden nur lachen, wenn ich mich umbringe. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Verzweifelt suchte ihr Blick nach irgendeiner menschlichen Regung in den versteinerten Gesichtern. Noch einmal versuchte sie es, immer noch hoffend, dass sie jemand verstand. Doch dann wurde ihr die Wahrheit über ihr vergebliches Unterfangen klar. Verzweifelt wiederholte sie wieder und wieder die Worte: „Ihr irrt euch, ich bin nicht aus Texas, keine Tejano! Hört ihr nicht? Keine Tejano! Ich bin …“
Sie wurde jäh durch eine wohltönende Stimme unterbrochen. „Du bist Sun-In-The-Red-Hair“, rief Red-Eagle, den sie hinter sich nicht bemerkt hatte, holte mit der Handkante aus, traf ihre rechte Schläfe und fing sie in seinen Armen auf. Er hatte als Einziger ein paar ihrer Worte verstanden. Ohne auf die verblüfften Gesichter der anderen Männer zu achten, ließ er sie grob ins Gras fallen. Ihren Namen hatte er in Comanche gesprochen, so weit reichten seine Kenntnisse denn doch nicht, um ihn in ihre Sprache zu übersetzen.
Wolf-Hunter begann laut zu lachen. Antelope-Son fiel mit seinem dunklen Bass ein. Die Übrigen blickten Icy-Wind, ihren Besitzer, nur mitleidig an. Diese da hatte keinen Wert, warum sollte man sich über sie den Kopf zerbrechen? Sie wollten keinesfalls derjenige sein, der sich mit ihr herumärgern musste.
Icy-Wind hatte es die Sprache verschlagen, erholte sich jedoch schnell wieder aus seiner Benommenheit. Gute Kriegsmedizin sollte sie sein? Wohl kaum. Er musste sich getäuscht haben. Die da war weiter nichts als eine, von der er sich lieber fernhalten sollte. Wenn sie sich umgebracht hätte – oder vorhat, es noch zu tun – brachte das ihm keine Ehre. Einen Moment lang erwog er, ihr einfach selbst die Kehle durchzuschneiden. Dann erinnerte er sich an den Blick, mit dem sie ihn aus dem Schatten heraus angesehen hatte, und ihn fröstelte. „Sun-In-The-Red-Hair – pah, nenne sie, wie du willst; ich kann sie nicht gebrauchen!“, schrie Icy-Wind aufgebracht. „Ich will sie nicht mehr! Ich will mit ihr nichts mehr zu tun haben, sie verdirbt meine gute Medizin. Wir hätten sie töten und mit den anderen auf einen Haufen werfen sollen. Wer immer sie haben will – jetzt, hier, kann sie haben. Ich will nichts für sie, ich schenke sie euch! Diese dort, die Red-Eagle Sun-In-The-Red-Hair nennt, wird mit einem anderen als Eigentümer in den Llano Estacado reiten oder hier verrecken; das ist mein letztes Wort. Sie soll mir aus den Augen bleiben!“ Icy-Wind hatte gesprochen und alle hatten es gehört.
Er war zu jung, um sich für eine solche Entscheidung Zeit zu nehmen. Es war überstürzt und unüberlegt von ihm, sich so schnell gegen sie zu entscheiden, hatte er doch kurz zuvor noch ganz anders gedacht.
In diesem Moment wusste er jedoch auch ganz genau, dass er das eben Gesagte nicht wieder zurücknehmen konnte. Unmöglich – sein Stolz und sein arrogantes Wesen würden das nicht zulassen. Diese hastig hervorgestoßenen Worte sollte er den Rest seines Lebens bitter bereuen. Eine Frau wie diese Weiße gab man nicht einfach mal so auf. Er bückte sich, um ihr das scharfe Rasiermesser aus der schlaffen Hand zu winden. Kurz betrachtete er das eingefallene, bleiche Gesicht und die zusammengepressten Lippen. Ihr Anblick berührte ihn auf eine so seltsame Art, dass es schmerzte. Eine Hitzewelle stieg in ihm hoch. Etwas griff nach seinem Herzen und versetzte es in rasenden Galopp. Ein Schauer raste durch seinen Körper, bis in seine Fersen hinunter. Das Gefühl von Verlust – ja, von Trauer – ergriff von ihm Besitz. Ein solches Gefühl hatte er bisher nie gekannt. Also schüttelte er es mit Gewalt von sich ab, als wäre es nur ein Blatt, das auf seine Schulter gefallen war. Um seine Stimmung zu überdecken, betrachtete er das kleine, unscheinbar aussehende Messer in seiner Hand mit großem Staunen. In seinem Innersten musste er zugeben, dass sie mit diesem Messer, so harmlos es auch aussah, Mut bewiesen hatte – und das war mehr, als man von einer weißen Frau erwarten konnte.
Seine Entscheidung kurz überdenkend wusste er bereits unbewusst, dass sie falsch war. Zurücknehmen? Niemals ! Jetzt musste er damit leben. Er kannte das schon – manchmal war man gezwungen, Dinge zu tun, die einfach notwendig waren. Wie ein Weg, den plötzlich ein anderer kreuzt, und man sich entscheiden muss, ob der neue Weg besser ist als der alte. Manchmal stellte es sich eben heraus, dass man die falsche Entscheidung getroffen hatte, doch man konnte nicht zurück. Während er noch immer das Messer betrachtete, kamen ihm erneut Zweifel. Konnte er das wirklich nicht? Den Weg zurückgehen und weiter auf dem alten wandern? Noch nicht einmal fertiggedacht, verwarf er diesen Gedanken sofort wieder. Nein, seine Entscheidung stand fest. Diese weiße Frau kümmerte ihn nicht das Geringste mehr. Er hatte es vorhin gesagt, und dazu stand er auch jetzt noch. Fest entschlossen blickte er auf. Wie zu erwarten waren aller Augen auf ihn gerichtet. Sie hatten ihn die ganze Zeit über beobachtet. Doch seine Miene war ja undurchdringlich geblieben, nichts war nach außen gedrungen. Nicht einmal, als er kurz seine Entscheidung in Zweifel gezogen hatte, wenn auch nur einen winzigen Augenblick. Um seine Meinung zu bekräftigen, spuckte er auf die vor ihm am Boden liegende Frau. Seine Finger um das Rasiermesser gekrallt, nickte er den anderen zu. Ihm war nicht so zumute, wie es nach außen hin den Anschein hatte, doch er würde das niemals zugeben. Jetzt nicht und auch später nicht. Ohne sich um die Frau oder ihren weiteren Verbleib zu kümmern, wandte er sich seinem Nachtlager zu. Niemand sah, was ihn das für eine Überwindung kostete, wie er sich zusammenriss, um nicht doch noch umzukehren und seine einmal getroffene Entscheidung zurückzunehmen.
Und so betrat er den neuen Weg, für den er sich entschieden hatte.
Wolf-Hunter, der so seine Zweifel hegte, was das eben Geschehene betraf, und der vielleicht der Einzige war, der den Freund durchschaute, wiegte bedenklich den Kopf. Er, der feinfühlige, oftmals in Träumereien versunkene junge Mann, machte sich so seine Gedanken über Icy-Wind. Vielleicht war es ja so, und der Freund hatte recht, was die schlechte Medizin betraf. Dennoch fand er, dass Icy-Wind die falsche Entscheidung getroffen hatte. Diese Weiße ist eine starke Frau, dachte er, ihre Medizin kann nicht schlecht sein. Konnte Icy-Wind das nicht erkennen?
Antelope-Son berührte die Frau leicht mit der Fußspitze. Nachdenklich betrachtete er Red-Eagle, während er etwas sagte, das Wahrheit werden sollte: „Icy-Wind wird dir das hier nicht danken, glaub mir. Was du eben getan hast, wird ewig zwischen euch stehen. Du hättest sie besser töten sollen. Ihr beiden werdet keine Freunde mehr sein – das ist sicher. Sun-In-The-Red-Hair, so heißt sie jetzt also. Ich denke, das wird sie auch noch sehr lange bleiben, und ihren Ehemann wird sie sich selbst aussuchen, genau wie eine aus unserem Volk.“