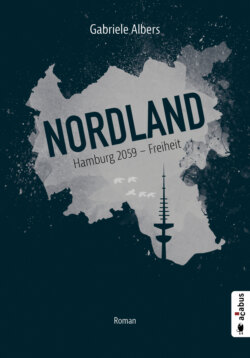Читать книгу Nordland. Hamburg 2059 - Freiheit - Gabriele Albers - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Volksfest
Оглавление»Du wirst in der ersten Reihe sitzen und es dir angucken. Soviel Respekt sind wir Willems Familie schuldig.«
Lillith kannte diesen Ton. Weitere Diskussion zwecklos. Sie versuchte es trotzdem.
»Bitte, Vater! Hinrichtungen sind für mich jedes Mal die Hölle. Du kannst dir nicht vorstellen, wie intensiv die Gefühle …«
»Lern endlich, damit umzugehen«, unterbrach Davide sie.
Sehr witzig. Wenn sie wüsste wie, hätte sie es schon lange getan.
Sie steckte ihre Sonnenbrille ins Haar, überprüfte ein weiteres Mal die dicke Schicht Make-up und holte tief Luft. Zur Belohnung stachen ihr die Korsettstangen in die Seite. Dämliche Mode, die Frauen so einschnürte, dass jeder Atemzug schmerzte. Die Zahl der Ohnmachtsanfälle bei öffentlichen Veranstaltungen hatte deutlich zugenommen. Vielleicht konnte sie sich ja so retten, wenn es zu schlimm wurde.
Ihr Chauffeur hielt die Tür zum Fond der auf Hochglanz polierten dunklen Limousine auf. Lillith setzte sich ihrem Vater gegenüber, der seinen Borsalino neben sich warf, auf den Manschettenknopf drückte und die Vidja mit der hochauflösenden Oberfläche des Tisches zwischen ihnen verband. Der gepanzerte Wagen setzte sich in Bewegung und fuhr fast lautlos die Einfahrt hinunter. Lillith warf einen Blick auf die Dokumente, die Davide aufgerufen hatte: Berichte von den Windfarmen in der Nordsee: lange Zahlenreihen, Kurven und Grafiken, knappe Texte.
»Gibt es Probleme?«, fragte Lillith.
Davide strich sich über den Nacken. »Nicht mehr als sonst.«
»Warum bist du dann so besorgt?«
Davide blickte auf und lächelte Lillith an. »Du bist ja schlimmer als deine Mutter. Der konnte ich wenigstens bei den geschäftlichen Dingen etwas vormachen.«
Lillith erwiderte das Lächeln. »Also, welche Probleme gibt es?«
Davide seufzte. »Seit gestern ist Ventus 3 vom Netz. Bei der Hälfte der Windräder ist das Getriebe heiß gelaufen. Einer unserer Mitarbeiter hat es gerade noch rechtzeitig gemerkt und die Anlage abgeschaltet.«
»Was heißt das in Zahlen?«
»Eine halbe Million Nordmark pro Tag.«
Lillith holte so tief Luft, wie es das Korsett erlaubte. Da die Windfarmen in der Nordsee größtenteils abgeschrieben und die laufenden Betriebskosten zu vernachlässigen waren, redeten sie von einer halben Million Nordmark Reingewinn, der ihnen täglich entging. Nicht schön.
Lautlos rollte ihre Limousine die Allee hinunter, links und rechts leuchteten die Blätter der Kastanien kupferrot und gelb, auch die Buchen, Platanen und Eichen hatten erste goldene Farbtupfer. Am Südtor winkten die Sicherheitsmänner sie ohne genauer hinzuschauen durch ihre Hochsicherheitsanlage hindurch – und in der nächsten Sekunde waren sie in einer anderen Welt.
Von dem gerade beginnenden, goldenen Herbst war hier nichts zu sehen. Die Straße war schlammig grau. Der Fernsehturm, der auf alten Fotos strahlend weiß vor dem blauen Himmel leuchtete, war von einer dunklen Rußschicht überzogen. Selbst das Unkraut, das die alte Eisenbahntrasse überwucherte, war schmutzig braun. Hier wohnten die Menschen, die nicht bei einer der reichen Familien der Stadt beschäftigt waren und die, wenn Erik Drach sich durchsetzte, bald ihre Sachen würden packen müssen.
Die gepanzerte Limousine fuhr eigenständig durch die Straßen Hamburgs auf dem Weg zur Hinrichtung des Mannes, der, ohne es zu wissen, zum Werkzeug ihres Vaters geworden war. Lillith beobachtete den Chauffeur. Ein weiteres Werkzeug. Im Prinzip nur dazu da, ihren Reichtum zur Schau zu stellen, die Türen des Fond zu öffnen, den Regenschirm zu halten und Lillith beim Aussteigen zu helfen. Fahren konnte das Auto allein.
Am Bunker, der seit über einem Jahrhundert unbeirrt und fast unbeschädigt auf dem Heiligengeistfeld stand, bogen sie ab auf eine der alten Magistralen, die hundert Meter weiter vor einer grauen Betonmauer endete. Hier begann das Anwesen von Bildungssenator Ehrenreich Benz. Das Tor stand offen, im Schritttempo fuhren die Limousinen mit ihren Begleitfahrzeugen durch die Sicherheitskontrollen. Benz’ Männer verglichen sorgfältig Fahrzeuge, deren Insassen und ihre Identitätskarten mit den Daten, die sie auf langen, auf Papier ausgedruckten Listen vorliegen hatten. Davide guckte auf seine Uhr. »Kein anderer nutzt für die Sicherheitskontrolle noch ausgedruckte Listen. Papier! Dem Mann gehört das Vidja-Netz und er benutzt Papier! Erik Drach sollte ihm dringend ein Angebot machen.«
Ein Stück weiter hatte Benz das Fußgängertor öffnen lassen. Hunderte Menschen standen davor und drängelten sich durch den schmalen Zugang, um rechtzeitig zum großen Spektakel auf dem Rathausmarkt zu sein.
»Die einfachen Leute lässt er so durch«, bemerkte Lillith. Davide beendete mit einem Druck auf seinen Manschettenknopf seine Arbeit, die Dokumente auf dem Tisch vor ihm erloschen. »Manchmal glaube ich, er würde lieber zu den Menschen auf der anderen Seite seiner Mauer gehören«, sagte er. Er setzte seinen Filzhut auf, jede Faser seines Seins Senator. »Vermutlich das Erbe seiner Mutter.«
Eine Gruppe dunkel gekleideter Männer näherte sich dem Fußgängertor. Lillith öffnete ihr Fenster einen Spalt. Sie wollte hören, was draußen vor sich ging. Einer aus der Gruppe schlug den Cordkragen seiner fleckigen dunkelgrünen Jacke hoch und schrie die Menschen vor sich an: »Platz!« Der Mann klang wie eine schleifende, schlecht geölte Maschine. Die Menschen leisteten keinen Widerstand und machten, sich gegenseitig schubsend, eine Gasse frei. Der Mann drehte sich selbstzufrieden zu seinen Leuten um und Lillith sah in die Fratze eines Dämons.
»Da ist der Angreifer aus dem Elbtunnel!«, rief sie. Das Gesicht war unverkennbar. Riesig, eckig, als ob sein Schöpfer eine riesige Brotform dafür verwendet hätte. Die Augen lagen fast an den Schläfen, die Nase schien zwei Rücken und vier Nasenflügel zu haben und nahm den gesamten, reichlich vorhandenen Platz in der Mitte des Gesichts ein. Das Kinn streckte sich so weit nach vorne, das es nur wenige Zentimeter von der Nase entfernt war. Der Mund war nicht mehr als ein schmaler Strich in einer Wanne aus Haut.
Davide drehte sich um und versuchte, ihrem Fingerzeig zu folgen. Aber der Mann war schon mit seinen Leuten hinter der Mauer verschwunden. »Sicher?«
Lillith nickte. »Absolut. Ich verstehe nicht, wieso Drach ihn noch nicht verhaftet hat. Seine tolle Software sollte ihn schon lange gefunden haben.«
»Es heißt Senator Drach«, tadelte Davide, »aber ich schicke ihm eine Nachricht. Wie ist die Stimmung im Volk?«
»Keine besonderen Emotionen«, sagte sie. »Der übliche Brei aus leichter Anspannung wegen der vielen Menschen und Vorfreude auf die Veranstaltung. Freude, verstehst du das?«
»Sie freuen sich, dass es sie nicht erwischt hat«, sagte Davide. »Erik muss aufpassen, dass die Urteile nicht willkürlich werden. Erinnerst du mich daran, dass ich ihm das sage?«
Lillith machte eine Notiz in ihre Vidja. Der Neue würde bald merken, dass er ohne Davides Unterstützung nicht weit kam. Liborius Oppermann nannte ihren Vater nicht ohne Grund den Paten von Nordland.
Sie fuhren zu dem Doppelgebäude aus Rathaus und Handelskammer – die Hamburger hatten schon immer gewusst, dass Politik und Wirtschaft zusammengehören – und parkten hinter dem altehrwürdigen Gebäude, in dem seit über 150 Jahren die Bürger der Freien und Hansestadt Hamburg über die Geschicke ihrer Stadt verhandelten. Durch ein seitliches Tor betraten Lillith und Davide den Innenhof. »Ich muss noch etwas besprechen, geh schon vor«, sagte Davide und bog in die alte Handelskammer ab, den nur einen Hauch schlichter gehaltenen Teil des Ensembles, der den Senatoren als Konferenz- und ihren Mitarbeitern als Büroraum diente. Lillith wandte sich in die entgegengesetzte Richtung und betrat die Rathausdiele.
Ruhe. Kühle. Erhabenheit. In der großen Halle war außer ihr niemand. Sie genoss den Anblick der mächtigen Sandsteinsäulen, die wie in einer Kathedrale das Kreuzgewölbe stützten. Die breiten Treppenaufgänge, die hohen Portale mit ihren schmiedeeisernen, reich verzierten Toren – alles atmete Großzügigkeit, Kultur, Geschichte. Sie tagträumte, wie sie selbst eines Tages die Treppe zu den Senatsräumen hinaufstieg, mit ihrem Assistenten die letzten Fragen klärte und durch geschicktes Taktieren ihre Senatorenkollegen dazu brachte, die Todesstrafe abzuschaffen und Männer wie Joseph Foth in die Verbannung zu schicken. Naiv. Ja. Aber noch hatte sie die Hoffnung auf eine selbstbestimmte Zukunft nicht aufgegeben.
Hinter ihr öffnete sich eine Tür. »So schön und so allein?«
Lillith drehte sich um und setzte ihr Geschäftslächeln auf: »Hallo Otwin.«
Bevor sie ausweichen konnte, hatte der übergewichtige Sohn von Bürgermeister Rabe sie schon bei den Schultern gefasst und an sich gezogen. Er drückte ihr Begrüßungsküsse auf die Wange, erst links, dann rechts, dann wieder links, während Lillith darauf wartete, dass er sie endlich losließ und sie sich von seinem Geruch entfernen konnte: Wermut und Anis. Offenbar konnte er das Leben nur mit Hilfe von Absinth ertragen.
»Wartest du auf jemanden?«, fragte er.
»Mich zieht es ehrlich gesagt nicht auf den Balkon.«
»Ach komm, manchmal ist das doch ganz unterhaltsam.«
Von Otwin gingen irritierend harmlose Sonnenstrahlen aus, er freute sich auf die Veranstaltung. Oder auf ihre Begleitung. Oder auf beides. Eigentlich war es genau das, was sie jetzt brauchte. Kaum zu glauben, dass sie etwas Positives mit diesem Mann verbinden konnte, dessen Auftreten genauso feist war wie alles andere an ihm. Ob dieser aufgeblasene Bürgermeistersohn wohl platzen würde, wenn sie eine Nadel in sein rundes Gesicht stach?
Sie legte ihre Hand auf den ihr dargebotenen Arm.
Der alte Balkon vor dem Rathausturm war vor einigen Jahren verlängert und in schusssicheres Glas eingefasst worden. Die wichtigsten Familien der Stadt mussten sich nicht mit dem Volk auf eine Ebene begeben. Lillith begrüßte die Anwesenden, sprach Bibi und Jay Kropp ihr Mitgefühl für den Verlust von Willem aus, beantwortete leise und zurückhaltend die Fragen der anderen Senatoren nach ihrer Befindlichkeit und setzte sich zu den Kropps in die erste Reihe.
Otwin ignorierte die Etikette und setzte sich neben sie. »Ich darf doch?«
Lillith zog eine Augenbraue leicht hoch, sagte aber nichts. In Otwins Augen war das offenbar ein »Ja«.
»Und du kommst jetzt tatsächlich unter die Haube?« Otwins Stimme war unangenehm spöttisch. »Ich hab gehört, dass dein Vater einen großen Märchenball organisiert, um deinen zukünftigen Ehemann auszuwählen. Verrätst du mir die Aufgabe, die ich erfüllen muss, um deine Hand zu bekommen?«
Die letzte irrationale Hoffnung, dass ihr Vater es gar nicht so gemeint haben könnte, löste sich in Luft auf. »Es gibt keinerlei Planungen für einen Märchenball und keine Aufgaben, die irgendein Kandidat erfüllen muss«, sagte sie kühl. »Und im Übrigen ist dein Vater der Bürgermeister und der erste Mann in Nordland. Damit steht dir der Titel ›Kronprinz‹ zu.«
»War das ein ›Ja, ich will‹? Wann ist die Hochzeit?«
Wieso akzeptierten die Männer in ihrem Umfeld kein Nein?
»Du weißt genau, was ich meine: Mein Vater ist ein Senator unter vielen. Ich glaube nicht, dass es von allgemeinem Interesse ist, wen ich heiraten werde.«
»Na klar, dein Vater ist nur einer von vielen. Lass mich mal überlegen, ob mir Gründe einfallen, warum du trotzdem eine Person des öffentlichen Interesses sein könntest …« Otwin schaute nach oben, als ob er ernsthaft nachdenken würde und zählte dann an seinen Fingern ab: »Vielleicht weil du, erstens, aus der reichsten Familie des Landes kommst? Oder weil dein Vater, zweitens, den Daumen auf unserer Energieversorgung hat? Wenn Davide Civetta beschließt, dass wir für heute genug Energie verbraucht haben, dreht er uns einfach den Strom ab. Soll ja schon mal passiert sein. Liborius!«
Otwin hatte Finanzsenator Liborius Oppermann entdeckt, der im Begriff war, sich einige Plätze entfernt von ihnen zu setzen. Der Sohn des Bürgermeisters sprang auf und drängte sich an Bibi Kropp vorbei, deren Mundwinkel noch weiter nach unten fielen. Lillith erwartete, Trauer bei Duhnkreihs Schwester zu spüren. Aber alles, was sie fühlte, war Verbitterung.
Otwin stürmte auf Oppermann zu und streckte ihm die Hand entgegen. »Schön, dich zu sehen.« Er senkte die Stimme. »Wegen der Finanzierung sollten wir im Anschluss kurz sprechen.« Und wieder laut: »Wir reden gerade über den passenden Ehemann für Lillith. Bist du mit im Rennen? Hast du Davide schon ein Angebot gemacht?«
Oppermann ließ Otwins Hand fallen, als ob er sich daran verbrannt hätte.
»Ich glaube, du verwechselst da etwas, Otwin.« Lilliths Stimme schnitt durch den Small Talk der anderen, die irritiert in ihre Richtung blickten: »Ich bin nicht käuflich zu erwerben.«
»Ist das so?« Otwin drehte sich wieder in ihre Richtung und lächelte auf sie herab.
»Selbst wenn es so wäre, wärst du der Letzte, der sich eine Civetta leisten könnte.«
»Ehemann?« Fritjof stand plötzlich neben ihr. »Ich dachte immer, dein Vater lässt dich nie aus seinem Schloss und du bleibst für immer die eiserne Jungfrau!«
Er beugte sich zu ihr herab und flüsterte: »Eine treffende Bemerkung, aber keine besonders kluge.«
Lillith bemerkte im selben Moment Otwins Ärger und flüsterte: »Die alte Saufnase soll mich gefälligst in Ruhe lassen. Reicht doch, dass er seinen Vater ins Unglück stürzt. Mein Geld wird er nicht kriegen.«
Bevor sie sich weiter aufregen konnte, klang die Nationalhymne aus den Lautsprechern. Die Menschenmenge, die sich unterhalb des Balkons versammelt hatte, verstummte. Die Gespräche im Aquarium wurden leiser.
Die Scheinwerfer gingen an und sorgten in dem Oktobergrau für gleißende Helligkeit auf der Bühne in der Mitte des Platzes. Lillith spürte die tausendfache Anspannung der Menschen auf dem Rathausmarkt. Die Vorfreude, die sie eben noch irritiert hatte, war verschwunden. Auch von der Volksfeststimmung, die öffentliche Bestrafungen sonst begleitete, war nichts zu spüren. Etwas stimmte nicht.
Ihr Vater nahm wortlos neben ihr Platz. Lillith versuchte, sich auf seine Ruhe zu konzentrieren, auf die Gelassenheit, die ihr Vater ausstrahlte. Sie wollte sich auf keinen Fall zu intensiv dem Geschehen dort unten auf dem Platz widmen. Schon die einfacheren Bestrafungen wie Haarescheren oder der Pranger waren unangenehm, voller Scham und Hilflosigkeit. Hinrichtungen konnte sie nur aushalten, weil die Delinquenten schon im Vorfeld mit Medikamenten ruhig gestellt wurden; man war schließlich ein zivilisiertes Land. Die Bestrafungen dienten allein der Abschreckung, nie der Rache.
Die letzte Exekution lag drei Monate zurück; damals hatten die Behörden einen jungen Mann aus dem Volk hingerichtet. Er war der Kopf einer Verbrecherbande gewesen, die in den weniger gut gesicherten Beamtenvierteln und sogar in den Armenvierteln der Stadt für Leid und Terror gesorgt hatte. Es gab wenig Mitleid aus der Bevölkerung, die Hinrichtung war auszuhalten gewesen.
Aber heute war es anders. Zur Anspannung kamen Trauer und Fassungslosigkeit. Und an einer Stelle unendlich viel Leid. Es stach klar aus allen anderen Emotionen heraus. Selten konnte sie bei einer solchen Menschenmasse eine einzelne Person so deutlich fühlen. Sie schloss die Augen und versuchte, die Stelle zu finden, an der ein dichter grauer Nebel alles andere verschluckte. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie in der ersten Reihe hinter der Absperrung eine schmale Frau mit ungewöhnlich langen, schwarzen Locken. Lillith schaute genauer hin und bemerkte die grauen Strähnen in den Haaren und den gebeugten Rücken. Da straffte sich die Unbekannte. Sie drehte sich zu dem Balkon und blickte ihr genau in die Augen.
Die Schuld zog sie unter Wasser. Luft! Ohne ihre scheiß Sensibilität wäre keiner von ihnen hier. Luft! Sie konzentrierte sich auf ihren Verstand. Hätte Duhnkreih ihren Vater lieber umbringen sollen? Sie atmete ein und aus, ein und aus. Niemand hatte diesen Thorn dazu gezwungen, Duhnkreih totzuschlagen. Ein, aus, ein, aus, ein. Die Korsettstangen drückten in ihre Seiten, der Schmerz betäubte die Schuld, sie bekam wieder Luft, trieb auf einer Welle, die langsam auslief. Niemand in ihrer Umgebung hatte etwas gemerkt. Nicht einmal Davide – Lillith atmete langsam aus.
Der Blickkontakt musste Zufall gewesen sein. Auf die Entfernung war es überhaupt nicht möglich, jemandem so genau in die Augen zu sehen. Sie musste sich das eingebildet haben. Als sie wieder hinunterschaute, konnte sie die Frau nicht mehr sehen, auch das unendliche Leiden war nicht mehr herauszuspüren.
Der Verurteilte kam in einem Gefängniswagen in einem Konvoi schwer bewaffneter Polizeifahrzeuge auf den Platz. Eine lächerliche Zurschaustellung von Macht. Wer sollte an dieser Stelle einen Befreiungsversuch unternehmen?
Sie erwartete einen halb betäubten Mann zu sehen. Aber der Mann, der aus dem Kastenwagen stieg, wusste genau, was um ihn herum passierte. Sein Gesicht wurde in Großaufnahme auf die Leinwand oberhalb der Bühne projiziert. Ein Fehler. Denn der Verurteilte sah schlimm aus, die Nase gebrochen, ein Auge blau und zugeschwollen, sein notdürftig um den Kopf gewickelter Verband war an einer Stelle dunkel von getrocknetem Blut. Auch das Volk registrierte die Verletzungen. Ein Raunen ging über den Rathausmarkt. Lilliths eigener Ärger über diese unnötige Zurschaustellung von Foths Verhörmethoden vermischte sich mit der Wut der Leute auf dem Platz. Wohin würde diese Wut die Menschen dort unten tragen?
Lillith beugte sich zu ihrem Vater: »Das Volk ist sehr aufgebracht. Ist die Sicherheit alarmiert?« Davide nickte und tätschelte beruhigend ihre Hand, aber hinter seiner Schläfe pulste deutlich sichtbar eine Ader. Die Polizisten aus dem Begleitkonvoi stellten sich rund um die Bühne, ihre Gewehre im Anschlag.
Das Volk war verstummt. Kein Flüstern, kein Lachen, kein Sprücheklopfen. Diese Hinrichtung lief nicht wie geplant. Lillith biss sich auf die Unterlippe.
»Ich habe kein gutes Gefühl«, twinkerte sie an ihren Vater.
Davide reagierte nicht.
Lillith spürte erneut hinunter. Sie konnte den Hass auf die Machthaber bis in die letzte Ecke des Platzes spüren. Ihre Hände zitterten.
»Könnt ihr diesen Mann nicht in letzter Minute begnadigen?«
»Nein.«
Joris Thorn stieg unter Schmerzen die Stufen zur Bühne hoch, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Er stolperte, fiel, schlug mit dem Gesicht auf.
Das Volk stöhnte auf.
Einer der Polizisten packte ihn und stellte ihn wieder auf die Füße.
»Ich würde diese Hinrichtung wirklich stoppen.«
»Das kann ich nicht.«
»Du bist der mächtigste Mann Nordlands. Du musst doch irgendeine Möglichkeit haben, das hier zu stoppen.«
Davide betrachtete das Volk und blinzelte mehrmals. Ein Hinweis an Erik? Kommandos an die Sicherheit? Sollte sie sich tatsächlich durchgesetzt haben? Ihr Vater schien zufrieden zu sein. »Die Männer da unten haben alles im Griff«, twinkerte er. »Es geht weiter wie geplant.«
Lillith schüttelte heftig den Kopf. »Bitte!«, flüsterte sie. »Begnadigt ihn. Das gibt sonst eine Katastrophe.« Davide beugte sich zu ihr und flüsterte so leise, dass sie ihn kaum verstand: »Wir müssen diesen Mann hinrichten, damit das Kapitel Duhnkreih beendet ist. Manchmal ist das Opfer eines einzelnen der einzige Weg, um das Leben aller anderen zu schützen.«
Zwei Polizisten nahmen Thorn die Handschellen ab, nur um seine Hände gleich wieder auf den Armlehnen des stählernen Drehstuhls zu fixieren.
Aus den Lautsprechern tönte das Urteil. In Lilliths Ohren rauschte es. »Im Namen des Volkes: Joris Thorn …« Sie fühlte sich so hilflos und so wütend und würde am liebsten aufspringen und diese ganzen Lautsprecher von ihren Masten reißen …, »verheiratet, zwei Kinder, arbeitslos, ist des Mordes an dem ehrenwerten Bürgerschaftspräsidenten Willem Duhnkreih für schuldig befunden worden.« Warum begriff ihr Vater nicht, was gleich passieren würde? »… eine Begnadigung ist angesichts der Schwere der Schuld nicht möglich. Zur Abschreckung und Besserung wird die Strafe öffentlich vollzogen.«
Vereinzelt hörte man ein Schluchzen, geflüsterte Worte. Aber die große Mehrheit schwieg. Und ballte die Fäuste.
Der Henker schritt auf die Bühne, ein Arzt in der weißen Uniform seiner Zunft. Sein Gesicht war dank optischer Effekte so verpixelt, dass seine Identität geheim blieb. In der Hand hielt er die Schachtel mit den beiden Druckinjektoren. Wenn schon Todesurteile vollstreckt werden mussten, dann so human wie möglich. Kein Erhängen oder Erschießen, wie es in China und Russland üblich war. Nein. Ein Injektor, der den Verurteilten einschlafen ließ, und einer, der ihm den Tod brachte.
Bevor er mit seiner Arbeit anfangen konnte, ging eine Welle durch die Menge. Zahlreiche Menschen hielten Zettel hoch. Einzelne Buchstaben nur, die aber aneinandergereiht zu Wörtern und ganzen Sätzen wurden: »Warum?«, »Hilflos – Rechtlos – Staatenlos«, »Gegen die Willkür – Für die Freiheit!« und »Iniqua numquam regna perpetuo manent«. Lillith konnte kein Latein, aber ihre Vidja hatte sofort die Übersetzung parat: »Ungerechte Reiche währen niemals ewig.« Es dauerte nicht lange, bis die Polizei die Demonstranten festgenommen hatte. Aber lange genug, dass der Mann, der nur noch wenige Minuten zu leben hatte, ihre Botschaften lesen konnte. Tränen liefen ihm über das Gesicht, während die Protestierenden von den Sicherheitskräften mitgeschleift wurden.
Mitleid, soviel Mitleid. Lillith setzte ihre Sonnenbrille auf und war froh, dass niemand ihre Tränen sehen konnte. Sie suchte Trost bei ihrem Vater, aber der hatte seine Hand von ihrem Arm genommen, drückte auf seinen Vidja-Manschettenknopf und war mit seinen Gedanken offenbar schon wieder bei seinen Geschäften. Ganz kurz übernahm die Verachtung die Kontrolle in ihrem Gefühlschaos. »Kannst du eigentlich auch mal zwei Minuten ohne deine Vidja auskommen?«, hätte sie ihn gerne gefragt. Aber dann überwältigte die Traurigkeit der Menschen unter ihr sie erneut.
Lillith versuchte, sich auf etwas anderes zu konzentrieren, auf die Menschen um sie herum im Aquarium. Aber selbst die schienen zu spüren, dass etwas nicht so lief wie geplant.
Unten stieg Erik Drach die kleine Treppe zur Bühne hoch, ging auf den Henker zu und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der runzelte die Stirn, nickte dann aber und holte den ersten Injektor aus der Schachtel, ein silberglänzender Stift, von dem er langsam die Kappe abschraubte.
»Joris Thorn!«, dröhnte es aus dem Lautsprecher. »Du hast jetzt die Möglichkeit, etwas zu sagen.«
Welch’ ein Elend. Da saß dieser Mann und schluckte seine Tränen hinunter. Lillith rechnete nicht damit, dass er überhaupt ein Wort herausbekommen würde. Seine Gelassenheit war verschwunden. Thorns festgebundener Oberkörper hob und senkte sich, als er versuchte, sich und seine Schmerzen unter Kontrolle zu bekommen. Er holte ein weiteres Mal Luft. »25 Jahre habe ich dem Schicksal abtrotzen können«, flüsterte er, die Stimme nicht mehr als ein Krächzen. Die ausgefeilte Mikrofontechnik verteilte seine letzten Worte trotzdem gut hörbar an jeden einzelnen Punkt des Rathausmarktes. »25 Jahre, in denen ich hoffte, dass alles wieder gut wird, wenn wir uns anpassen, wenn wir uns nicht weiter wehren.« Seine Stimme wurde fester. Und lauter. »25 Jahre, in denen dieses Nordland«, er spuckte den Namen förmlich aus, »seine Schuld hätte wiedergutmachen können. 25 vergebliche Jahre. Es wäre besser gewesen, wenn ich damals an der Seite meiner Freunde gestorben wäre. Im Kampf für eine gerechtere Gesellschaft.«
Ein Techniker sorgte für eine Rückkopplung. Das Volk hielt sich die Ohren zu, selbst auf dem Balkon konnte man dem Ton nicht ausweichen. Davide und einige andere Männer schickten wütende Kommentare in Richtung Tontechnik. Sofort verstummte die Rückkopplung und man hörte wieder Joris Thorn: »Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt.« Der Lederriemen um Joris’ Kopf wirkte wie die verrutschte Krone eines Königs. »Das Alpha und das Omega. Vergesst das nie!«
Der Henker drückte Thorn den Injektor auf den Arm. Joris schrie, er schrie, wie Lillith noch nie jemanden hatte schreien hören. Es war der Schrei einer gequälten und gefolterten Seele, direkt aus einem der Höllenbilder von Hieronymus Bosch. Sie krallte ihre Finger in die Lehnen ihres Sitzes. Das war der falsche Stift gewesen, der Henker hatte auf die Betäubung verzichtet. Trotz der Distanz spürte Lillith das Brennen in den Adern, das Feuer, das sich durch ihr gesamtes Blutsystem schob. Davide sprang auf und brüllte über seine Vidja Befehle, während er zum Ausgang des Aquariums drängte.
Lillith fühlte das Entsetzen und die Wut der Menschen unten auf dem Platz, sie hörte, wie auch das Volk zu schreien begann. Sie wollte aufstehen, fort, nur fort von hier. Aber das Feuer in ihrem Innern schob sich in Richtung Gehirn und ihre Beine knickten weg. Unten auf dem Platz kletterten Menschen über die Absperrung und liefen auf die Bühne zu, Sicherheitskräfte schossen in die Luft, Erik Drach wies sie mit wütenden Handbewegungen an, die anstürmenden Menschen zu erschießen, Lillith hörte weitere Schüsse, aber noch schien Joris der einzige Sterbende zu sein.
Wer konnte, rannte durch die schmalen Straßen davon, weg vom Platz der Hinrichtung, weg von der Polizei, die vom Rathaus her auf die Menge zukam. Nur in der Mitte des Platzes, dort wo Thorn auf der Bühne lag, sich wand und zuckte und schrie, drängten weiter Menschen nach vorn. Aus dem Augenwinkel sah Lillith eine Hundertschaft gepanzerter Polizisten, aber sie kamen von der falschen Seite, sie würden sich den Weg freischießen müssen. Lillith krümmte sich und rief nach ihrem Vater.
Niemand hörte sie. Dicke Wolken hüllten ihren Verstand ein. Die Schreie, das Getümmel, die Panik auf dem Rathausmarkt erreichten sie kaum noch. Sie hörte weitere Schüsse, warf einen vernebelten Blick nach unten, wo endlich jemand auf die Idee gekommen war, das im Boden der Bühne eingelassene Panzerglas hochzufahren. Ihr Körper krampfte, zuckte unkontrolliert und rutschte vom Stuhl. Sie sah noch, wie einer der Sicherheitskräfte auf der Bühne auf Joris Thorn zielte und abdrückte. Der alte Mann verstummte, Lillith schnappte nach Luft und versank in Dunkelheit.
Eine Reihe von Ohrfeigen holte sie zurück. Lillith blinzelte und schüttelte den Kopf, um das Grau um sich herum zu vertreiben. Bibi Kropp kniete über ihr und verpasste ihr weitere Ohrfeigen. »Schon gut, ich bin wieder da«, sagte Lillith und atmete tief ein. Irgendjemand hatte das Korsett gelockert. Etwa die alte Hexe? Das würde sie Überwindung gekostet haben. Ganz im Gegensatz zu den Ohrfeigen. Fritjof und Otwin standen neben ihr und halfen ihr auf die Füße. Außer ihnen war niemand mehr im Aquarium. Lillith warf einen Blick hinunter. Rauchschwaden zogen über den Platz, aber im Scheinwerferlicht der Bühne erkannte sie, wie ihr Vater neben Erik Drach stand und den Arm des Heimatschutzsenators hinunterdrückte. Lillith blinzelte, Drach hatte eine Halbautomatische in der Hand. Er würde nicht wagen, ihren Vater … Warum war Davide eigentlich dort unten? Sie lag ohnmächtig neben ihm und er stritt sich lieber mit Erik Drach. Wenigstens schien die Polizei die Lage wieder unter Kontrolle zu haben. Sie hatten die Menschen in der Nähe der Bühne eingekesselt und führten nun einen nach dem …
Lilliths Empathie drängte sich in ihr Bewusstsein. Sie verkrampfte und kippte vornüber und wäre ohne den Halt von Fritjof und Otwin erneut gestürzt. Ihr Leib fühlte sich an, als ob er zusammengeprügelt, ihre Augen brannten, als ob sie selbst dem Tränengas ausgesetzt worden war. Ihr Körper wollte in die nächste Ohnmacht fliehen. Die beiden Männer trugen sie aus dem Aquarium hinaus. Im Treppenhaus filterten die dicken Rathausmauern die Schmerzen der anderen aus ihrem Kopf. Sie waren nur noch ein dumpfes Echo, wie die kaleidoskopischen Flecken auf ihrer Retina, wenn sie zu kräftig auf ihre Augen drückte. Sie hörte die Rufe derer, die sich gegen ihre Festnahme wehrten, sie hörte die stumpfen Schläge der Stöcke, die Schmerzensschreie der Verhafteten. Aber sie fühlte sie nicht mehr.
»Was machen die da?«, fragte sie.
»Sie sorgen für Recht und Ordnung«, antwortete Fritjof.
»Komm, Lillith, schnell, die Konvois fahren gleich los«, drängte Otwin. Bibi Kropp war bereits durch den Hinterausgang des Rathauses verschwunden.
Sie sah ihn fragend an.
»Du kannst jetzt nicht allein durch die Straßen fahren«, sagte er. »Das Volk ist aufgebracht. Wir fahren in Konvois, bis wir aus dem Gröbsten heraus sind.«
Ihre Limousine wartete mit laufendem Motor. Der Fahrer trommelte nervös auf dem Lenkrad herum. Die Leibwächter schoben ihre Maschinenpistolen schussbereit in die Fensteröffnungen. Um das Rathaus herum hatte die Polizei die Straßen gesäubert, aber als sie Benz’ Grundstücksmauer erreichten, drängten sich die Menschen und Lillith konnte nicht mehr unterscheiden, ob sie sich dort sammelten, weil sie nicht schnell genug durch das kleine Fußgängertor kamen, oder ob sie sich sammelten, um auf den Konvoi loszustürmen.
»Nur Warnschüsse, und die auch nur, wenn absolut nötig«, twinkerte sie an ihre Leibwächter.
Das große Tor stand offen, aber auch hier war alles voller Menschen. Der Konvoi verlangsamte das Tempo, ihr Auto war das letzte, und plötzlich waren die Menschen direkt neben ihr, trommelten gegen die Fenster, auf das Dach, auf die Motorhaube, zogen an den Türgriffen, die schwere Limousine schwankte …
Lillith schrie. Die Leibwächter schossen und die Menschen ließen von ihrem Auto ab. Sobald sie auf der anderen Seite der Mauer waren, gab ihr Fahrer Vollgas und raste über die Straße und über alles, was ihm im Weg war.
Hinter ihr, auf dem Rathausmarkt, fielen Schüsse.
Warum hatte Davide nicht auf sie gehört und alles abgeblasen, als er noch konnte?