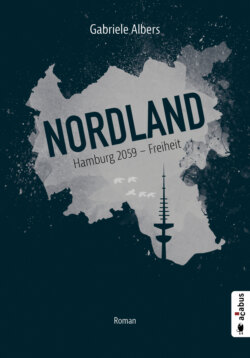Читать книгу Nordland. Hamburg 2059 - Freiheit - Gabriele Albers - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Markt
ОглавлениеLillith roch den Fliederduft ihrer Bettwäsche und spürte weiche Finger an ihrer Wange. So beruhigend. Schlafen.
»Wach auf, Lillith, du musst aufwachen.«
Die Stimme wurde drängender, eine Hand rüttelte an ihrer Schulter. Nein. Sie hatte schlimm geträumt, sie wollte weiterschlafen.
»Bitte, Lillith, wach auf, dein Vater ist sehr ungehalten.«
Mühsam kämpfte sich Lilliths Bewusstsein an die Oberfläche. Sie öffnete die Augen, alles um sie herum war in grelles Licht getaucht. Sie stöhnte und zog die Decke über das Gesicht.
Majas Stimme strahlte vor Erleichterung. »Endlich! Dein Vater versucht schon den ganzen Vormittag, dich zu erreichen. Ich habe ihn bis eben hinhalten können, aber gerade war er … egal. Möchtest du ein Kühlkissen für deine Augen?«
»Den ganzen Vormittag?« Ihre Stimme krächzte. »Wie spät ist es?«
»Kurz vor zwölf.«
Gerade eben hatte sie doch noch im Auto gesessen, war weggefahren von der … der Hinrichtung. Sofort sah sie wieder Thorns Todeskampf vor sich, hörte seinen entsetzlichen Schrei, spürte deutlich, wie ihre Limousine mit mehreren bu-bumm, bu-bumm über Körper gefahren war, oder waren das die im Boden eingelassenen Sicherheitsschranken gewesen?
Alles andere – der Weg nach Hause, in die Arme von Maja und in ihr Bett – war nur noch schemenhafte Erinnerung.
»Kannst du bitte die Vorhänge wieder zuziehen, liebe Maja? Das Licht tut weh.«
Noch bevor ihre alte Kinderfrau zurück war, hörte Lillith den Klang einer Oboe, die das Hauptthema des Filmklassikers »Der Pate« spielte – ihr persönlicher kleiner Scherz, über den sie gerade nicht lachen konnte. Jeder einzelne Ton schlug von innen an ihren Kopf wie der Klöppel an eine Kirchenglocke. Sie drückte auf die kleine Vertiefung ihres goldenen Vidja-Armbands. Davides Hologramm baute sich vor ihr auf, sie hörte den kopfspaltenden Lärm eines Hubschraubers; das grelle Rot von Davides Überlebensanzug schmerzte in ihren Augen. Und nein, natürlich galt die Vidja-Etikette nicht für ihn. Er hatte es nicht nötig, vorher zu fragen, ob ihr die Videoübertragung genehm war. Er drängte sich in ihre privaten Räume und sah sie genauso deutlich vor sich wie Lillith ihn. Sie regelte die Lautstärke an ihrem Ohrstecker herunter.
»Hast du endlich ausgeschlafen?« Der gnadenlose Zynismus ihres Vaters war nicht zu überhören.
Lillith war zu erschöpft für einen Streit. »Wo bist du?«, fragte sie, um ihre Schwäche zu überspielen.
»Auf dem Weg nach Ventus 3.« Die Rotoren des Hubschraubers drehten sich durch sämtliche Schmerznerven in ihrem Kopf. Sie schloss die Augen. »Lillith, reiß dich zusammen!«
Sie riss die Augen auf und reduzierte die Lautstärke so weit herunter, dass sie ihren Vater gerade noch verstand. Dankbar nahm sie das Kühlkissen von Maja entgegen und legte es sich auf die Stirn. »Entschuldige, Vater, mir geht es wirklich nicht gut.«
Davide beugte sich nach vorne, als wollte er überprüfen, dass sie ihm nichts vorspielte. Kaum hörbar sagte er: »Du musst dieses Frauenleiden in den Griff bekommen. Dein tagelanges Ausruhen ist nicht hilfreich für unsere Arbeit.«
Hatte er nicht erst vor zwei Tagen gesagt, dass er ab sofort auf ihre Dienste verzichten wollte? Lillith drückte das Kühlkissen fester auf ihre Stirn.
»Alles hat seinen Preis«, murmelte sie leise. »Wenn ich gestern hätte zu Hause bleiben dürfen, würde es mir jetzt nicht so schlecht gehen. Aber dir sind deine Mitmenschen ja sowieso egal, ob sie leben oder ob sie sterben. Hauptsache dein blöder Pakt bleibt intakt.«
»Werde endlich erwachsen, Lillith. Es wird Zeit, dass du dich von deiner Kinderfrau und ihren überholten Vorstellungen von falsch und richtig löst.«
»Maja ist wenigstens hier und kümmert sich um mich.«
Davide reagierte nicht auf ihren Vorwurf, sondern schien mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein. Was Lillith noch wütender machte. Ihr Kopf war kurz davor zu explodieren. Zu allem Überfluss spürte sie nun auch noch Majas Sorgen; Lillith wünschte sich in die Bewusstlosigkeit ihres Schlafes zurück.
»Moment noch, ich bin gleich fertig«, sagte Davide zu jemandem, der mit ihm im Hubschrauber war.
»Sobald du dazu in der Lage bist, Lillith, fährst du in die Stadt und findest heraus, wie die Stimmung ist. Wir haben die Situation auf dem Rathausmarkt gestern in den Griff bekommen, aber …«
»Gab es Tote?«, unterbrach Lillith ihn.
»Nein. Ich habe Erik angewiesen, nur Warnschüsse abzugeben. Es gab allerdings zahlreiche Verletzte, vor allem aufgrund der Massenpanik an Benz’ Grundstücksgrenze. Natürlich macht das Volk uns für die Vorfälle verantwortlich. Gestern Abend gab es mehrere unangemeldete Demonstrationen.« Davides Ader an der Schläfe pulste sichtbar, als er fortfuhr. »Erik will Foth und seine Männer auf das Volk hetzen, aber wenn er jetzt seine Hunde aus dem Zwinger lässt, wird die Situation auf der Straße eskalieren. Straßenkämpfe sind das Letzte, was ich während unserer Jubiläumsfeier sehen möchte. Wir müssen die Lage behutsam unter Kontrolle bekommen. Foth und seinen Männern fehlt dafür das nötige Fingerspitzengefühl.«
Maja reichte Lillith ein weiteres Kühlkissen. Ganz langsam ließ der Druck im Kopf nach.
»Was ist mit den Überwachungskameras? Haben die nichts angezeigt?«
»Bislang nicht. Aber du kannst sicher sein, dass sich die Chaoten nicht direkt vor einer Kamera versammeln und den Aufstand gegen das System planen werden.«
»Aber doch auch nicht direkt vor meinen Augen.«
»Lillith.«
Die Verachtung klang so deutlich mit, als ob er ihr direkt gesagt hätte, was für ein dummes Ding sie sei. In Lilliths Bauch knüllte sich das Gefühl von Ungerechtigkeit.
»Dein Auftrag ist nicht, die Männer zu finden, die uns möglicherweise Schwierigkeiten machen können«, fuhr Davide fort. »Mit einzelnen Personen werden wir fertig. Ich will wissen, wie die Stimmung im Volk ist. Sind die Leute genug mit ihren Alltagssorgen beschäftigt oder unterstützen sie die Chaoten? Sind sie bereit, für etwas anderes zu kämpfen als für ihr tägliches Überleben? Ist die Wut so groß, dass aus dem kleinen Funken, den diese Hinrichtung geschlagen hat, ein Flächenbrand wird? Die Masse sollst du beobachten, Lillith, nicht die einzelnen. Ich erwarte deinen Bericht heute Abend, 19 Uhr.«
Neben Davide tauchte sein persönlicher Assistent auf, ebenfalls in grellrotem Überlebensanzug. Maja ging einen Schritt zur Seite als hätte sie Angst, im Weg zu stehen. Davide hatte seine Videoübertragung auf »komplett« gestellt, eine prinzipiell sehr praktische Funktion für die täglichen Konferenzen, die ihm eine Menge Reisen ersparte. Aber Titus hatte nichts in ihrem Schlafzimmer verloren, Lillith unterbrach die Bildübertragung sofort. Sie wollte gerade die Audio-Verbindung trennen, als sie Titus sagen hörte: »Bezüglich der Eheschließung: Måns Åkesson möchte mehr über die gestrigen Unruhen wissen, bevor er ein Angebot abgibt. Innokenty Sorokin will wissen, wie viel Zeit Sie für die konkreten Vertragsverhandlungen einplanen. Und Erik Drach lässt ausrichten, dass er nach wie vor interessiert sei und kein Problem mit dem Gleichgewicht in Nordland sehe.«
Lillith hörte ihren Vater schnauben.
»Der Mann ist wirklich hartnäckig. Wenn er als geeigneter Kandidat in Frage käme, hätten Alexander und ich uns schon vor Jahren geeinigt. Ignoriere seine Anfrage. Sorokin kannst du mitteilen, dass die Dauer der Verhandlungen von den Angeboten abhängt. Aber ich gehe davon aus, dass die Hochzeit im April oder Mai stattfinden wird. Und mit Måns mach mir bitte einen Termin. Das bespreche ich mit ihm persönlich.« Der Hubschrauberlärm verstummte. Davide hatte die Verbindung unterbrochen.
Maja setzte sich aufs Bett und reichte ihr ein Glas Wasser, in dem sich gerade eine Kopfschmerztablette auflöste. Ihre alte Kinderfrau, die einzige wirklich vertraute Person in ihrem Leben, strich ihr sanft über die Wange. »Vielleicht klappt es ja mit einem der Schweden oder Norweger«, sagte sie. »Dann wird das mit der Ehe schon nicht so schlimm werden.«
Lillith wertete es als gutes Zeichen, dass ihr Vater ihre Unterstützung einforderte und sein »deine Ausbildung ist beendet« offenbar vergessen hatte. Vielleicht überlegte er es sich doch noch mal mit der überstürzten Vermählung. Vielleicht hatte er sich wieder daran erinnert, wie wichtig sie für ihn war. Sie würde ihm beweisen, dass er nicht auf sie verzichten konnte.
Sie probierte alles, was sie an Hausmitteln hatte, um auf die Beine zu kommen. Trotzdem dauerte es noch drei Stunden, bis die hochdosierten Schmerztabletten, die Wechselduschen, das Minzaroma und die Koffeinpillen Wirkung zeigten. Ein transdermales Pflaster im Nacken schickte ein stetiges, wohl dosiertes Rinnsal von Opioiden in ihre Blutbahn, packte das scharfe Messer in ihrem Kopf in mehrere Lagen Leinen und ließ in ihrem Schädel nur das drückende Gefühl einer vollgestopften Schublade zurück.
Fahr in die Stadt und finde heraus, wie die Stimmung ist, hatte ihr Vater ihr aufgetragen. Am liebsten wäre sie bis nach Neugraben gefahren, um nach Tonja und Peer zu sehen und sie bei der Gelegenheit zu fragen, ob sie nicht für die Civettas arbeiten wollten. Aber Maja hatte sie überzeugt, dass solch eine Fahrt zu lang und damit viel zu gefährlich wäre. Also einigten sie sich auf eine Runde durch die umliegenden Viertel mit einem Abstecher zum Hafen und einem Besuch auf dem zentralen Markt in der Mundsburg.
Was nach den Ereignissen gestern riskant genug war.
Lillith hatte sich als einfaches Dienstmädchen getarnt: graue Hose, beigefarbene Uniformjacke, unbequeme Kunstlederschuhe. Ihre dunkelbraunen Locken waren unter einer aschblonden Kurzhaarperücke verschwunden. Eine große Sonnenbrille verdeckte Lilliths halbes Gesicht und war gleichermaßen Tarnung wie Schutz. Das Tageslicht brannte sich direkt durch die Netzhaut in ihr Gehirn. Aber noch länger durfte sie nicht warten.
Victor, Lilliths persönlicher Chauffeur, stand vor einem kleinen, silberfarbenen Denza, dem Kleinwagen-Exportschlager der Chinesen, und genoss die Sonnenstrahlen, die sich immer wieder durch die Wolken stahlen. »Wartest du schon lange?«, fragte Lillith. »Entschuldige.«
Victor stutzte einen Moment, erkannte seine Chefin, rannte um das Auto herum und öffnete die Beifahrertür. »Kein Problem.« Sein ausgeglichenes, fast immer gut gelauntes Wesen war einer der Gründe, weshalb er für sie arbeitete. »Ich habe mir die Beine vertreten, dann lässt es sich besser in der Sardinenbüchse aushalten. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch eine der Limousinen nehmen möchten?«
Lillith zeigte auf ihre Tasche, in der eine fast schon antike Hasselbladkamera steckte. »Ich möchte das Licht nutzen und Schiffe fotografieren, bevor es wieder zu regnen beginnt. Dafür brauche ich nicht den ganzen Pomp eines offiziellen Staatsbesuchs. Wo ist Yaren?«
Victor verdrehte kurz die Augen und zeigte zum Dienstmädchenhaus. »Er flirtet mit einem der neuen Mädchen. Muss die Zeit nutzen, solange sich sein Ruf nicht bis zu ihr herumgesprochen hat.«
Lillith schickte über ihre Vidja einen kurzen Rüffel an ihren Leibwächter. Sekunden später kam er über den Hof gerannt, knöpfte beim Laufen seine Jacke zu und strich sich über die raspelkurzen Haare. Lillith schickte ein kurzes »falscher Knopf« hinterher, bevor sie sich vorne neben Victor setzte. Sie konnte spüren, wie Yaren rot anlief, als er seinen Fehler korrigierte. Ihr lag nichts daran, ihre Mitarbeiter zu demütigen, vor allem nicht diejenigen, die ihr Leben für sie aufs Spiel setzen sollten. »Ist sie hübsch?«, twinkerte sie deshalb lautlos und versöhnlich hinterher.
»Sehr«, schrieb Yaren zurück. Auch er hatte eine Kontaktlinse im Auge. Das Privileg der Leibwächter.
Kurz nachdem sie ihr Anwesen verlassen hatten, entdeckte Lillith den ersten Frosch, der von einer Werbefläche herabgrinste. Hinter ihm lief ein Film mit animierten Bildern aus der von Erik Drach geplanten, neuen Siedlung. Der Film zeigte hunderte weiße Häuser mit roten Dächern, fünf bis sechs Stockwerke hoch, dazwischen Rasenflächen, Bäume, Spielplätze, gerade, saubere Straßen, Laternen an jeder Ecke, sogar Ampeln und Zebrastreifen hatten die Planer in die Bilder programmiert. Dazu der Werbespruch: »Sichern Sie sich die Zukunft« und kleiner darunter: »Unsere Mitarbeiter kommen gerne zu Ihnen nach Hause.«
»Warum hat Senator Drach einen Frosch als Logo gewählt?«, fragte Maja, die darauf bestanden hatte, sie zu begleiten.
»Keine Ahnung«, sagte Yaren. »Aber meine Schwester hat gestern einen Brief von der Behörde bekommen, die dafür zuständig ist. Anscheinend planen die erstmal eine Volkszählung, um zu prüfen, wie viele neue Wohnungen tatsächlich gebraucht werden. Vielleicht soll der Frosch vorab für gut Wetter sorgen? Zum Glück verlangen die nicht, dass man dafür zu denen ins Amt kommt. Das soll am anderen Ende der Stadt sein.«
»Am Poggendiek in Wilhelmsburg«, ergänzte Victor. »Senator Drach hat eines seiner leer stehenden Gebäude dafür zur Verfügung gestellt. Ich habe Ihren Vater gestern früh dort hingefahren, Fräulein Civetta.«
»Damit hätten wir auch die Erklärung für den Frosch«, sagte Maja. »Poggendiek ist plattdeutsch für Froschteich.«
Yaren lachte. »Und ich dachte immer, der neue Senator wollte mit dem Froschlogo für das schöne Leben draußen in der Natur werben.«
Erneut fiel Lillith auf, wie kahl und grau hier alles war. Natur gab es im Armenviertel wirklich nicht. Sie erinnerte sich an einen kurzen Abschnitt in ihrem Geschichtsbuch. Während der beiden Hungerwinter hatten die Menschen hier jeden Baum zu Feuerholz gemacht. Und danach hatte sich niemand mehr für dieses Viertel verantwortlich gefühlt.
Graue Wolken zogen vor die Sonnenstrahlen. Lillith nahm die Sonnenbrille ab. Bei Regen konnte sie ihre Mission gleich abbrechen. Die wenigen Menschen, die sich dann noch draußen aufhielten, würden missmutig sein, weil sie nass wurden. Und nicht, weil die Heimatschutzbehörde einen der ihren hingerichtet hatte.
Das Schanzenviertel war ihr erstes Ziel, die Gegend, in der Thorn gewohnt hatte. Lillith spekulierte darauf, dass möglicher Ärger am ehesten in der unmittelbaren Nachbarschaft zu spüren sein würde. Mit Tempo 30 rollten sie lautlos an einer vermüllten Brachfläche vorbei, in deren Mitte die Ruine eines Wasserturms thronte. Ein Stück weiter lag die alte S-Bahn-Station Sternschanze, vor der sich ein paar Männer versammelt hatten, alle in dunkle Kapuzenpullis, Bomberjacken oder schwarze Mäntel gehüllt.
»Hier wurde Willem Duhnkreih totgeprügelt, nicht wahr?«, fragte Maja von hinten. Ein Hauch von Trauer strömte für kurze Zeit durchs Auto, bevor Maja ihre Gefühle wieder unter Kontrolle bekam.
»Ja.« Lillith konzentrierte sich auf die Männer, die Ärger ausstrahlten. Ob der noch flüchtige Kapuzenträger dabei war? Lillith suchte in ihrer Vidja nach der aktuellen Fahndung. Das Bild, das auf der Windschutzscheibe des Denza erschien, hatte nicht an Qualität gewonnen. Offenbar hatte Drach mit der Veröffentlichung des Stimmprofils keinen Erfolg gehabt. Immerhin hatte er die Belohnung für »sachdienliche Hinweise« auf 5.000 Nordmark erhöht.
»Da stehen sie wieder, die Ratten.« Yarens Verachtung war nicht zu überhören. »Alles Kriminelle, die den Menschen das Leben noch schwerer machen, als es sowieso schon ist.« Er zog seine Vidja-gesteuerte Beretta aus dem Holster und ließ die Männer nicht aus den Augen, während sie an ihnen vorbeifuhren.
»Sie haben die Gewehre und damit die Macht«, sagte Maja. »So ist die Welt.«
Wie um ihre Worte zu bestätigen, löste sich einer der Männer aus der Gruppe, zog eine alte Pistole und zielte auf die Reifen ihres Autos. Maja schrie auf, Lillith hörte einen Schuss, der Angreifer fiel auf die Knie, die Pistole neben ihn auf den Boden, den Oberköper über die zerschossene Hand gekrümmt. Erst als die Gruppe nicht mehr zu sehen war, schloss Yaren die kleine Öffnung im Heckfenster und blinzelte, vermutlich um das Fadenkreuz des Zielerfassungsprogramms von der Kontaktlinse zu löschen.
»Warum nimmt die Polizei diese Männer nicht fest?«, fragte Lillith.
»Die Polizei interessiert nicht, was in den Elendsquartieren dieser Stadt passiert«, antwortete Yaren.
Maja legte dem Leibwächter versöhnlich die Hand auf den Arm. »Eure Leute, Lillith, haben andere Sachen zu tun. Die Menschen hier kommen zurecht. Sie haben sich ihre eigene Polizei aufgebaut, nette Jungs, die gegen einen Kanten Brot oder für ein paar Nordmark die Ratten aus der Gegend verscheuchen. Wollen wir jetzt zur Elbe runter? Sonst ist es dunkel, bevor wir die Promenade erreicht haben.«
»Da unterschätzt du aber diese Seifenkiste, liebe Maja«, sagte Victor und klopfte liebevoll auf den Joystick, mit dem er – theoretisch – den Wagen selbst steuern konnte. »Soll ich das Kommando übernehmen, Fräulein Civetta? Dann sind wir in Nullkommanichts am Ziel.«
»Danke, lieber nicht. Ich fühl mich besser, wenn du weiter darauf achtest, dass wir genug Energie haben.«
Victor fügte sich mit einem spaßhaft gebrummelten »Na gut« und konzentrierte sich auf die Überwachungsinstrumente, die anzeigten, ob die Energieübertragung durch die Induktionsschleifen, die in unregelmäßigen Abständen unter den Straßen vergraben waren, funktionierte. In den Armenvierteln wollte niemand mit seinem Auto liegenbleiben. Auch Victor nicht.
Lillith ließ die Welt draußen weiter an sich vorbeiziehen. Kinder spielten auf der Straße Kästchen-Hüpfen. Frauen hängten auf ihren absturzgefährdeten Balkonen Wäsche auf. Eine alte Frau kippte schmutziges Waschwasser aus und kehrte zufrieden gnickernd ins Haus zurück, als die Kinder laut schreiend dem Wasser auswichen, das ihr Spielfeld wegwusch. Lillith spürte Gram und Leid, aber auch Glück und Freude – vor allem bei den Kindern, die sich mit einem Kreidestein bereits ein neues Spielfeld malten.
So wie sich ihr Vater aufgeführt hatte, hatte sie mit unangemeldeten Demonstrationen gerechnet, mit großen Versammlungen, bei denen sich die Menschen über das Unrecht beklagten oder wenigstens mit wehklagenden Frauen. Aber es war das gleiche Bild wie immer, wenn sie auf dem Weg zum Rathaus oder zu einem der Geschäftspartner ihres Vaters an der Elbe durch diese Viertel fuhr: Dreck, Armut, Elend. Eine Parallelwelt, mit der sie nichts zu tun hatte. Die Menschen waren mit dem Überleben beschäftigt. Nicht mit einem Aufstand.
Sie näherten sich der monumentalen Statue von Fürst Bismarck, der in ewigem Stillstand die steinerne Hand auf sein Schwert gestützt und den Blick drohend auf die Armenviertel gerichtet hatte. Schräg hinter ihm begann das Gemeinschaftsgebiet des Hafens. Auch auf dieser Elbseite war der Hafen durch eine lange Mauer geschützt. Immerhin funktionierte hier die automatisierte Einlasskontrolle.
Victor fuhr weiter stromabwärts, bis sie die kurze Promenade erreichten, die Hawiks Getreidesilos von Civettas Speichertanks für das mit Windenergie gewonnene Methangas trennte. Am Terminal Tollerort lag ein Containerschiff, den Bauch voll Waren aus aller Welt, die von hier aus für viel Geld in den Rest Nordlands und in die angrenzenden Länder transportiert wurden. Ein anderes Schiff legte gerade ab – einer der Tanker, der das Windgas ihres Vaters zu einem Kunden brachte. Vermutlich nach Indien oder China, Länder mit einem nie endenden Energiehunger.
Lillith holte ihre Kamera aus der Tasche und tat, als ob sie nach einem passenden Motiv suchte. Was für eine Scharade. Die Jungs mussten sie wirklich für das dumme, verwöhnte Gör vom alten Civetta halten, das nichts Besseres zu tun hatte, als bei schlechtem Wetter quer durch die Stadt zu fahren, um Schiffe zu knipsen. Dabei fotografierte sie wirklich gerne. Aber nicht unbedingt Landschaften, und schon gar nicht bei so einem schlechten Wetter. Sie liebte Portraits. Sie genoss es, wenn es ihr gelang, für einen winzigen Moment die Fassade ihrer stets kontrollierten Mitmenschen zu durchbrechen und das Echte dahinter festzuhalten. Es waren nicht immer schöne Aufnahmen, die sie in ihren privaten Unterlagen gespeichert hatte. Aber es waren wahrhaftige Bilder. Die anderen, die schönen Bilder, auf denen die Menschen so aussahen, wie sie aussehen wollten, verschenkte sie.
Ein Segelboot wich einem weiteren Containerschiff aus, es wirkte winzig neben dem voll beladenen Dickschiff aus Indonesien. Ein hübscher Kontrast, Lillith drückte auf den Auslöser. Ein Regentropfen fiel auf ihre Hand, dann noch einer. Sie packte ihre Kamera ein und ging zurück zum Auto. Wenn sie ihrem Vater Ergebnisse präsentieren wollte, dann musste sie sich jetzt beeilen.
»Schade, dass das Wetter nicht gehalten hat«, sagte Lillith, als sie wieder ins Auto stieg. »Aber so bleibt mehr Zeit für den Besuch auf dem Markt.« Sie spürte Yarens Sorgen, der dieser ganzen Runde nicht viel abgewinnen konnte.
Hinter der Mauer, die den Hafen vom Rest der Stadt trennte, war fast niemand mehr auf der Straße. Aus den einzelnen Regentropfen war ein typischer Hamburger Dauerregen geworden, Yarens Sorge war völlig überflüssig gewesen. Und ihr Versuch, auf diesem Weg mehr über die Stimmung in der Stadt zu erfahren, ebenfalls. Lillith lehnte den Kopf an die Kopfstütze und schloss die Augen.
Hinter ihr erschrak jemand heftig. Sie riss die Augen auf und drehte sich um. Maja starrte aus dem Fenster. Auf eine Mauer hatte jemand wilde Zeichen geschmiert. Die Farbe war noch frisch und leuchtete. Nein, keine Zeichen. Nur ein einziges, aber das immer und immer wieder: Ω.
»Maja?«, fragte Lillith. »Alles in Ordnung?«
Ihre Kinderfrau wirkte wie ein grauer Panther in einem Käfig. Lillith spürte ihre Konzentration. Und ihre Furcht. Majas Hand zitterte, als sie auf die Mauer mit den Graffiti zeigte.
»Ich hatte gehofft, ich würde das nie wieder sehen«, flüsterte Maja.
»Die Schmiererei an der Mauer?«
»Lillith, das ist nicht einfach nur eine Schmiererei.«
»Sondern?«
Maja zögerte, schien nach den richtigen Worten zu suchen.
»Omega ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet und steht für ›Ende‹«, mischte sich Yaren ein.
»Alpha und Omega, Alphatiere und Omegatiere, ja, danke Yaren, davon hab ich schon gehört.«
»Elektrischer Widerstand wird in Ohm gemessen und mit dem Ω gekennzeichnet«, fügte Maja hinzu. »Deshalb haben die Menschen das Zeichen damals gewählt. In der Zeit des Umbruchs. Als dein Vater Nordland gegründet hat. Es war das Zeichen der Menschen, die mit der neuen Ordnung nicht einverstanden waren, das Zeichen des Widerstands.«
»Ich wusste gar nicht, dass es so eine Gruppe gab. Warum haben mir meine Hauslehrer nichts davon erzählt?«
Maja schaute an Lillith vorbei auf die regennasse Straße. »Das gehört wohl nicht zum Lehrplan.«
»Aber warum bin ich dann nicht an anderer Stelle darüber gestolpert? In irgendwelchen Büchern oder Dokumenten müssen die doch erwähnt sein.«
Maja schüttelte langsam ihren grauen Kopf. »Alle, die auch nur entfernt damit zu tun hatten, sind in der Blutnacht verschwunden«, erklärte sie. »Joseph Foth ist damals gerade Polizeichef geworden – das war die Zeit, in der er sich seinen Ruf aufgebaut hat.«
Die Blutnacht. Ein dunkles Kapitel im gerade gegründeten Nordland. Lillith hatte die Bilder sofort vor Augen. Eine Demonstration, die aus dem Ruder gelaufen war. Unfähige Politiker. Überforderte Polizisten. Schüsse auf dem Rathausmarkt. Panik. Und am Ende hunderte Tote. Niemand konnte genau sagen, wie es angefangen hatte. Oder wie viele Menschen in dieser Nacht ums Leben gekommen waren. Die Blutnacht war der Wendepunkt gewesen. Danach hatten sich die wichtigen Männer der Stadt zusammengesetzt und ein neues Gesellschaftssystem geschaffen. Eines, in dem panikblinde Politiker nicht länger den Befehl für solch ein Massaker geben konnten – weil die wirtschaftliche Elite nun auch offiziell die politischen Posten übernommen hatte. Als Ehrenamt. Mit freiwilligen Sozialleistungen hatten sie die Ärmsten der Armen abgesichert, mit gemeinsamen Anstrengungen auf Grundlage ihres Pakts für Sicherheit und wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt. Seit 24 Jahren funktionierte dieses Gesellschaftssystem, in dem jedermann ungestört seinen Geschäften nachgehen konnte.
Was wollten diese komischen Omega-Leute jetzt?
»Bist du sicher, dass alle Widerständler verschwunden sind? Vielleicht haben sie sich am Ende mit dem neuen System abgefunden und arrangiert?«
Majas Verachtung war kurz, aber grenzenlos.
»Nein, Lillith, nein. Die Widerstandskämpfer hätten sich nie damit abgefunden. Nicht die Männer und Frauen, die damals in der ersten Reihe standen und gegen die Macht des Geldes gekämpft haben. Foth hat gründliche Arbeit geleistet und alles ausgerottet, was er mit Omega in Verbindung bringen konnte.«
Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr. Endlich wusste Lillith wieder, wo sie das letzte Mal von Omega gehört hatte. » ›Das Alpha und das Omega. Vergesst das nie!‹ – das waren die letzten Worte von Joris Thorn.«
Maja seufzte. »Das erklärt die Graffiti.«
Erneut spürte Lillith Majas Trauer, dieses Mal tiefer, verzweifelter.
»Kanntest du diesen Thorn?«
»Jeder in dieser Gegend kannte ihn. Er war Arzt, einer der wenigen, der den Armenvierteln geblieben war.«
»Und ein Mörder.« Nicht, dass es um die besoffene Krähe schade gewesen wäre.
»Ich weiß nicht, warum er Duhnkreih umgebracht hat. Wahrscheinlich aus blinder Not. Glaub mir, Lillith, das Leben außerhalb deiner Mauern ist so elend, dass manche Menschen schon für eine warme Jacke morden.«
Victor kam ohne Probleme durch das Armenviertel auf der östlichen Alsterseite. Aber auf Mauern und Wände war immer wieder mit frischer Farbe das Ω geschmiert worden, den ganzen Weg hoch bis zur Mundsburg. Sollte Davide Recht behalten? Ein Flächenbrand? Aber doch nicht wegen ein paar Schmierereien an den Wänden. Oder?
Der Autoverkehr nahm zu, je näher sie dem Marktgelände kamen. Lillith registrierte einige Wagen aus dem Fuhrpark der Civettas. Vermutlich Küchenpersonal, das frisches Gemüse einkaufte. An der breiten Straße vor dem Marktgelände waren mehr Menschen zu sehen als auf ihrer ganzen bisherigen Fahrt.
Keine Frau ging ohne männliche Begleitung.
Die Bettler bemerkten Lillith als erste und hielten ihr wehklagend die Hände hin. Das Elend drohte sie schon am Eingang zu überwältigen. Der saure Geruch von Urin und Schweiß vermengte sich mit Kohl- und Zwiebeldüften. Dazu Ströme von Hoffnungslosigkeit. Lillith ging einen Schritt schneller. Sie hakte sich bei Maja unter, ging gebückt, unauffällig, unscheinbar.
In der Markthalle war es so voll, dass das Elend der Bettler nicht länger ins Gewicht fiel. Die Musiker direkt hinter dem Eingang vertrieben mit jazziger Musik alle schlechten Gefühle. Lillith vergewisserte sich, dass Yaren keine Gefahr sah und ging tiefer hinein, Majas Arm fest umklammernd. Es gab hier so viel mehr Emotionen als in ihren Kreisen, aber die meisten davon waren auszuhalten. Die Menschen um sie herum waren zufrieden und verdrossen und neugierig und gelangweilt und angespannt und entspannt und fröhlich und traurig. Sie bewältigten ihren Alltag. Sie lebten. Und beachteten die junge Frau mit den aschblonden, kurzen Haaren nicht weiter, die durch die langen Gänge schlenderte.
Auf den Tischen lagen fein säuberlich aufgeschichtet Kohlrabi und Wirsing, Kartoffeln und Rotkohl, Kürbisse und Sellerie, Pastinaken und Schwarzwurzeln, Äpfel und Quitten. Daneben eingekochte Früchte des Sommers, Marmeladen, Bohnen, getrocknete Tomaten, kleine Fässer mit Apfelsaft.
Ein Stück weiter pries ein junger Mann einen schmalen, schwarzen Kasten mit Kurbel an. »Der MP3-Player läuft super und hat die Hits der 80er, 90er und das Beste von heute – also den 2000ern – gespeichert.« Er zwinkerte Lillith verschwörerisch zu. »Und manchmal kannst du sogar ein ausländisches Radioprogramm damit empfangen. Das ist natürlich illegal, pssst.« Er legte den Zeigefinger auf seine Lippen. Lillith nickte konspirativ und ging weiter.
Einen Gang weiter meckerten Ziegen. Hühner standen in einem kleinen Drahtkäfig. Die Verkäuferin lächelte ihr zahnlos entgegen. »Ein paar Eier, mein Kind? Beste Bioqualität.«
Als Lillith um die nächste Ecke ging, schwappte ihr der Gestank von totem Fleisch entgegen. Gerupfte Vögel in allen Größen hingen auf Kopfhöhe: Hühner, Tauben, kleine Singvögel. Lilliths Magen begann sich zu drehen. Ein weiteres gehäutetes Tier von der Größe eines kleinen Hundes oder einer großen Katze hing von einer Stange herab und stank, als ob der Verwesungsprozess schon eingesetzt hatte. Fliegen schwirrten um die Tierleichen herum, setzten sich in Klumpen darauf, bevor der Verkäufer sie mit einer gelangweilten Handbewegung zu verscheuchen suchte. Lillith machte auf dem Absatz kehrt. Drei Gänge weiter holte sie zum ersten Mal wieder Luft und konzentrierte sich auf die Menschen um sich herum. Auf ihre Aufgabe: die Stimmung im Volk zu erspüren.
Hinter einem Stand mit Jacken, Hosen, Schals und Mützen aus gewalkter Wolle zeterte eine kleine, kompakte Frau. »Wir lassen uns nicht zählen. Diese Frösche kommen mir nicht ins Haus.« Sie stemmte die Arme in die Hüften und blickte den vor ihr stehenden Mann herausfordernd an. Er war fast zwei Köpfe größer als sie und zeigte leichte Spuren von Verzweiflung: »Sofie, bitte, wir müssen jetzt wirklich unsere Sachen zusammenpacken, um pünktlich zu Hause zu sein.«
»Wenn du vor den Birds kuschen willst, ich halte dich nicht auf. Aber ich lass die nicht in meine Wohnung. Wir zahlen pünktlich unsere Marktsteuern, das muss reichen! Die kümmern sich doch sonst auch einen Scheißdreck um uns. – Was guckst du so blöd? Entweder kaufst du was oder gehst weiter. Ich hab nichts zu verschenken.«
Das Letzte war eindeutig an Lillith gerichtet.
Im Weggehen hörte sie das Flehen des Mannes. »Wenn wir nicht kooperieren, können die uns das Leben richtig schwer machen. Wir brauchen die Markterlaubnis. Das weißt du genauso gut wie ich. Wenn wir hier nicht verkaufen dürfen …«
»Wir sollten umdrehen«, las sie auf ihrer Kontaktlinse. Auch Lillith spürte die steigende Anspannung, je tiefer sie sich in diesen Mikrokosmos hinein verirrte. Nur diesen einen Gang noch. Da war etwas, das sie nicht einordnen konnte, flatterige Bewegungen, aufgeregtes Flüstern. An einem Tisch mit alten Büchern und Zeitschriften blieb sie stehen, der Besitzer schien gerade etwas Wichtiges unter dem Tisch zu tun zu haben, jedenfalls sah sie nur seinen gebeugten Rücken und spürte seine Anspannung. Sie nahm sich eines der Hefte, »Brigitte« stand auf dem verblichenen Titel, daneben eine hübsche junge Frau im Bikini und der Titel »Die neue Sommerdiät«.
»Hast du was gefunden?« Eine tiefe, extrem wohlklingende Stimme. Lillith fiel die Zeitschrift aus der Hand, die Härchen auf ihren Armen stellten sich auf. Ein junger Mann stand hinter dem Tisch, schüttelte mit einer unwirschen Kopfbewegung seine hellblonden Strähnen aus dem Gesicht, hob die Zeitschrift auf, blätterte darin, blickte auf den Titel und dann Lillith in die Augen. »Zwei Mark für den Traum von einer besseren Welt.«
Lillith senkte den Blick, unsicher, was sie tun sollte. Das war die Stimme vom Video, die Gänsehautstimme. Das war der Mann in dem Kapuzenpulli. Der Mann, der neben Joris Thorn auf dem Video zu erahnen gewesen war. Mörder sollten nicht so gut aussehen dürfen. Niemand sollte so gut aussehen dürfen.
»Tut mir leid, aber ich habe kein Geld.« Das war nicht mal gelogen. Sie musste Drach Bescheid geben, sofort.
Der Verkäufer musterte sie und bemerkte dann Maja und Yaren.
»Zahlt Civetta, der alte Eulenvogel, tatsächlich so schlecht, wie immer behauptet wird? Hallo Maja.« Die Wangen von Lilliths alter Kinderfrau färbten sich rosa. »Ausbeutung der Schwachen ist immer noch die einfachste Möglichkeit zu Geld zu kommen. Hier«, er hielt Lillith das Heft entgegen, »ich schenke es dir.«
Lillith sah ihn erstaunt an. »Danke. Aber …«
Er schaute an ihr vorbei, zuerst überrascht, dann entschlossen, und schnappte sich eine alte Sporttasche, die unter dem Tisch gestanden hatte. »Sorry, ich hab noch was Dringendes zu erledigen«, sagte er, drehte sich um und ließ seinen Verkaufstisch zurück. Er quetschte sich zwischen zwei Stände hindurch und verschwand in der Menschenmenge.
Lilliths Mund war staubtrocken. Sie suchte in ihrer Vidja nach Drachs Kontaktdaten. »Wer war das?«, fragte sie.
»Bosse Thorn.« Maja drängte sie in Richtung Ausgang. Lillith spürte, dass Maja verwirrt war von der Begegnung mit diesem Bosse – Thorn.
»Thorn?« Ihr wurde schlecht. Sie brach die Suche ab. Nichts überstürzen. In ihrem Kopf war ein heilloses Durcheinander, die Opioide hatten die Kopfschmerzen reduziert, aber ebenso ihre Fähigkeit für klare Analysen.
»Joris’ Sohn, Bo Thorn«, bestätigte Maja.
»Warum kann er italienisch?«
Maja brauchte einen Moment, bevor sie begriff. »Ach, wegen des Eulenvogels?« Sie lachte kurz und trocken auf. »Lillith, jeder, der sich ein bisschen für Nordland interessiert, weiß, dass Civetta italienisch für Eule ist.«
Bevor Lillith weiterfragen konnte, nahm Maja sie an die Hand und zog sie mit schnellem Schritt hinter sich her. Die steigende Unruhe in der Mundsburg war mit Händen greifbar. Lillith sah den Grund: Polizisten in den verschlissenen, braunen Uniformen der Heimatschutzbehörde standen vor den Händlern, kontrollierten die Papiere und waren nicht zufrieden mit dem, was sie sahen. Der Gefühlsmix aus Verärgerung, Angst, Verzweiflung und Panik stieg Lillith übel auf. Sie musste raus hier, bevor es schlimmer wurde.
Vor ihr stockte es. Sie wusste Yaren in ihrem Rücken, trotzdem ging ihr Atem schnell und flach. Sie drängte sich an Maja vorbei durch eine Lücke in der Menschenmenge – und stand drei Männern in langen, schwarzen Mänteln gegenüber, die ihre Schlagstöcke lässig in den Händen hielten. Die Stöcke schimmerten rot, sie waren auf maximale Kraft gestellt.
Lillith versuchte, einen Schritt zurückzutreten, in der Masse zu verschwinden, aber die Lücke hinter ihr hatte sich geschlossen. Die Männer in den Mänteln beachteten sie nicht weiter. Ihre Aufmerksamkeit war auf einen alten Händler gerichtet, der für wenige Pfennige Saft verkaufte.
»Wo ist die Bestätigung der Poggendiekbehörde?«
Der Mann hob hilflos die Schultern. »Die hab ich noch nicht.«
»Warum nicht?« Die Männer traten auf den alten Mann zu. Der wich zurück, suchte nach etwas, das ihn vor diesen Männern mit ihren Schlagstöcken schützen könnte. Seine Angst wurde zu Lilliths.
»Die waren noch nicht da. Ich habe doch gerade erst das Schreiben …«
Eine laute Ansage übertönte ihn. »Alle Marktbeschicker ohne offizielle Genehmigung der Poggendiek-Behörde verlieren mit sofortiger Wirkung ihre Verkaufserlaubnis«, dröhnte eine offizielle Stimme durch die Halle. »Ihre Stände werden beschlagnahmt und können bei der Heimatschutzbehörde gegen Vorlage der offiziellen Meldebestätigung zurückgefordert werden.«
»Du hast es gehört, Alter.«
»Aber …« Ein Schlag in die Magengrube, der alte Mann kippte vornüber. Lillith blieb die Luft weg. Yaren drängte sich endlich vor sie und gab ihr Deckung vor dem Schmerz des alten Mannes und vor den Saftflaschen, die herunterprasselten, nachdem einer der Männer dem einfach zusammengezimmerten Regal einen Schlag verpasst hatte. Roter Traubensaft sprenkelte Lilliths Gesicht, unter ihren Füßen knirschten Glassplitter. Der alte Mann krümmte sich in einer braunen Lache aus Trauben- und Apfelsaft, als die Männer abwechselnd gegen ihn und gegen die Reste seines Verkaufsregals traten.
»Wo ist dein Geld, Alter?«, fragte der Mann, dem es besonders viel Freude machte, seinen stahlkappengeschützten Stiefel in den dürren Körper zu versenken. Der Alte gab keine Antwort, aber bevor der Mann ein weiteres Mal zutreten konnte, hatte Lillith sich an Yaren vorbeigedrängelt und sich vor dem Mann aufgebaut.
»Stopp!«, rief sie mit all ihrer Autorität. Die Wut war stärker als der Schmerz.
»Geduld, Schätzchen, zu dir kommen wir gleich – ah da!« Der Mann schubste sie grob zur Seite, bevor er sich bückte und mit einem Messer den Geldbeutel des Alten vom Gürtel schnitt.
»Was erlaubt ihr euch?« Lillith hatte komplett vergessen, dass sie wie ein Dienstmädchen aussah. Sie wollte ihn gerade auffordern, sich zu identifizieren, als sie Yarens Hand an ihrem Arm spürte, der sie wegzog und gleichzeitig Botschaften auf die Vidja schickte. »Nicht einmischen … schnell weg hier … höchste Gefahr!«
Und mit einem Mal waren alle Gefühle um sie herum wieder da. Höllischer Schmerz. Angst. Wut. Verzweiflung. Fassungslosigkeit. Panik. Blinde Panik. Lilliths Beine wurden wacklig. Sie umklammerte Yarens Arm und ließ sich von ihm und von der Menge zum Ausgang ziehen. Im Vorbeigleiten sah sie, wie Polizisten Händler hinter ihren Ständen herauszerrten und ihnen wie Schwerverbrechern Handschellen anlegten. Sie sah, wie Frauen aus der Besuchermasse herausgezogen und weggeführt wurden – aber nicht von Polizisten. Jedenfalls trugen diese Männer nicht die braunen Uniformen der Heimatschutzbehörde, sondern lange, schwarze Mäntel. Wie die drei, die eben den alten Mann zusammengeschlagen hatten. Was waren das für Männer? Wen hatte Foth da für diese Aktion organisiert?
Die schwarzgekleideten Männer waren es auch, die alles, was sie in die Finger bekamen, mit großer Geste wegwarfen oder einsteckten. Die Gläser mit Eingekochtem zerschmetterten und weiche Birnen unter ihren Stiefeln zerquetschten. Die Tische umwarfen und mit ihren Schlagstöcken zertrümmerten.
An den Ausgängen erfassten Polizisten, die offiziellen, braun-uniformierten, mit großformatigen, mobilen Vidjas die Fingerabdrücke und erfuhren in Sekundenbruchteilen alles, was zu diesem Fingerabdruck je an persönlichen Daten gespeichert worden war. Die Männer arbeiteten schnell. Lillith spähte an ihnen vorbei nach draußen. Nicht weit vom Eingang entfernt stand ein riesiger Geländewagen. Auf dem Beifahrersitz saß Polizeichef Joseph Foth persönlich und beobachtete die Arbeit seiner Leute durch die offene Tür.
Lilliths Fingerabdruck verriet sie. Foth blickte überrascht über die Menschenmenge hinweg, als ihre Daten durch das System liefen, und hielt nach ihr Ausschau. Ihr lief es kalt über den Rücken. Diesem Mann wollte sie nicht ohne Beistand ihres Vaters gegenüberstehen. Sie duckte sich und eilte, geschützt von den Menschen um sie herum, zu dem kleinen silberfarbenen Denza. Hatte Davide nicht etwas von Deeskalation gesagt? Warum waren die Polizisten so brutal gegen die Händler vorgegangen? Was waren das für Männer, die im Auftrag oder zumindest mit Billigung der Heimatschutzbehörde die Stände zerstörten und die Händler ausraubten?
Ihr Puls beruhigte sich erst wieder, als sie die Mundsburg hinter sich gelassen hatten. Über ihre Kontaktlinse liefen Warnhinweise: »Meiden Sie die Viertel östlich der Alster. Chaoten überfallen beliebten Markt in der Mundsburg. Deeskalationsstrategie der Polizei schlägt fehl. Zahlreiche Verletzte. Weitere Eskalation nach Verhaftung der Rädelsführer nicht ausgeschlossen. Meiden Sie die Viertel östlich der Alster.«
Was?
Deeskalationsstrategie? Und welche Rädelsführer?
Ihre Hände waren schweißnass und umklammerten immer noch die zusammengerollte Zeitschrift, die der junge Thorn ihr geschenkt hatte. Ein Blatt Papier mit einem fetten, grinsenden Frosch ragte an einer Seite heraus. Sie schlug das Heft auf. Der Zettel hatte nichts mit den Schönheitstipps vergangener Zeiten zu tun:
Ω.
Wehrt Euch.
Lasst euch nicht zählen.
Werft die Frösche raus.
Es ist Zeit für ein Ende der Willkür und für ein besseres Leben.
Für uns alle.
Ω.
Lillith schlug das Heft wieder zu und lehnte den Kopf an die Stütze.
Der Widerstand versammelte sich. Direkt vor ihren Augen. Und Bo Thorn gehörte zu ihnen. Zu den Menschen, die sich gegen die Willkür der Heimatschutzbehörde wehrten.
Er war außerdem der Mann im Kapuzenpulli, der Mann, der Willem Duhnkreih auf dem Gewissen hatte. Mit dieser Information konnte sie ihrem Vater beweisen, wie hilfreich ihre Fähigkeit war. Sie könnte behaupten, dass sie aus der Masse der Menschen gezielt diesen Mann hatte herausspüren können. Was gelogen war, aber das wusste Davide nicht.
Bo Thorn war ihr Ticket in die Freiheit. Sie würde ihrem Vater gleich von Duhnkreihs Mörder berichten.
Und dann?
Davide hätte keine Skrupel, Bo hinrichten zu lassen. Er hätte auch keine Skrupel, die Hochzeit trotz ihrer Hilfe für Mai zu terminieren.
Der Willkür auf dem Markt war sie knapp entkommen. Ihre Hände zitterten.