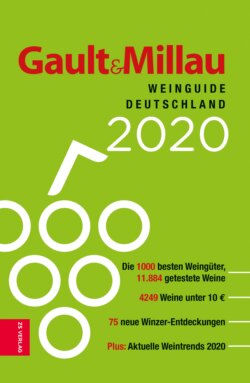Читать книгу Gault&Millau Weinguide Deutschland 2020 - Gault Millau - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Konkurrenz belebt den Wein
ОглавлениеIn deutschen Weinbergen haben die Reben meist reichlich Platz. Doch einige Spitzenwinzer pflanzen ihre Stöcke so dicht, dass kaum mehr eine Maschine durchpasst. Was der Platzmangel mit den Weinen macht, ist beeindruckend.
© NGUKIAW/SHUTTERSTOCK.COM
Eigentlich war es nur ein Experiment. Der Schlossberg des badischen Weinguts Huber ist so steil, dass die Familie die Weinberge dort oben schon immer in Handarbeit pflegen musste. Hier entschied Bernhard Huber etwas auszuprobieren: Er setzte die Reben dichter zusammen. In Deutschland stehen üblicherweise circa 4000 Pflanzen auf einem Hektar. Doch in manchen Toplagen wird es neuerdings enger. Die Winzer pflanzen doppelt, manchmal dreimal so viele Rebstöcke auf die gleiche Fläche. Dichtpflanzung nennt man das, und das Weingut Huber gehörte 1996 zu den Ersten, die das ausprobieren wollten. Denn es gibt gute Gründe dafür.
Rund 20 Kilometer von Hubers entfernt befindet sich das Weingut Dr. Heger, und dort war damals ein junger Winzer in der Ausbildung, der die Experimente aufgeregt beobachtete. „Ich dachte: Endlich macht das mal einer!“, sagt Stephan Attmann. Der mittlerweile 47-Jährige leitet heute das Weingut von Winning in der Pfalz. Attmann ist ein wacher, dynamischer Mann, der schnell spricht und am Satzende die Stimme leicht hebt, wie es hier in der Pfalz üblich ist. An diesem spätsommerlichen Tag ist er zu seiner Lieblingslage gefahren, um wenige Tage vor der Lese die Traubenreife zu kontrollieren: im Deidesheimer Weinbachhübel, einem Teil des berühmten Paradiesgartens. Immer wieder kann sich Attmann für diesen Ort begeistern: der Gesteinsmix aus Basalt, Kalk und Kiesel, die kühle Ausrichtung, die alte Gesteinsmauer, der Blick auf Deidesheim.
Als ihm die Lage angeboten wurde, war ihm nicht nur klar, dass er diesen Hang unbedingt wollte. Es sollte auch der Weinberg für seine erste eigene Dichtpflanzung sein. So fuhr Attmann wenige Wochen später ins Burgund. Denn um die Faszination und das Know-How der dichten Rebstöcke zu verstehen, muss man nach Frankreich blicken. Während in Deutschland 4000 Stöcke pro Hektar üblich sind, stehen beispielsweise in Bordeaux 7000 bis 10.000 Pflanzen auf der gleichen Fläche. Doch nirgendwo wird die Dichtpflanzung so forciert wie im Burgund: In dortigen Grand-Cru-Lagen sind 10.000 Rebstöcke pro Hektar sogar vorgeschrieben. Hier wachsen Weine von legendärer Dichte und Komplexität.
„Ich war mir sicher, dass das auch in Deutschland funktioniert, wenn man bestimmte Regeln kennt“, sagt Attmann heute. Von den französischen Kollegen erfährt er beispielsweise, dass es bestimmte Unterlagsreben braucht, damit die Anlage im Gleichgewicht bleibt. Er sieht, dass man auch den Abstand der Zeilen verringern muss, weil die Reben sich sonst den Platz in die andere Richtung suchen. Im Frühling 2008 setzt er dann in seiner Lieblingslage Sauvignon Blanc in einem Stockabstand von 80 Zentimetern bei 1,30 Meter breiten Rebzeilen. Auf einem Hektar bringt er so knapp 10.000 Pflanzen unter. Es dauert nicht lange, bis sich bestätigt: Der Weinberg entwickelt sich anders als üblich. Denn die Rebe hat einen faszinierenden Mechanismus. Bringt man sie in künstliche Konkurrenz, wurzelt sie tiefer. Sie wird dadurch resistenter gegen Trockenheit und kann mehr Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Für Claus Burmeister vom badischen Weingut Heiltinger war das der Hauptgrund auf Dichtpflanzung umzustellen. Seit 2011 hat er dichtgepflanzte Anlagen. „Wir haben extrem karge Kalkgesteinböden mit hohem Trockenheitsrisiko. In unseren dichtgepflanzten Anlagen ist der Wasserberdarf deutlich geringer, da sie tiefer wurzeln“, sagt der Winzer.
Dichtgepflanzte Reben – hier im Pfälzer Weingut von Winning – bilden eine deutlich höhere Wurzelmasse.
© Z.V.G.
© FOTOSR52/SHUTTERSTOCK.COM
Dass dieser Effekt nicht nur ein Gefühl der Winzer ist, zeigt die Forschung. Im Jahr 2003 starteten Studierende vom Weincampus Neustadt einen Versuch. Sie pflanzten verschiedene Spätburgunder-Anlagen nebeneinander und variierten lediglich den Stockabstand. Zehn Jahre später gruben sie die Wurzeln aus. „In den Dichtpflanzungen können wir eine deutliche höhere Wurzelmasse feststellen. Das heißt, die Pflanze kann kann mehr Wasser aufnehmen und ist deutlich resistenter gegenüber Stress“, sagt Matthias Petgen vom Institut für Weinbau und Oenologie am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt. Wer allerdings glaubt, mit mehr Pflanzen auch höhere Erträge zu erzielen, liegt falsch. „Der Flächenertrag muss gleich bleiben, damit ein positiver Effekt erzielt wird“, sagt auch Petgen. Die Leistung des Weinbergs wird damit auf mehr (Reb)-Schultern verteilt. Für Julian Huber vom Weingut Huber war genau das der Grund, warum er die Pionierarbeit seines Vaters weiter vorantreibt. „Die einzelnen Stöcke werden entlastet. Und je weniger die Pflanze an Trauben tragen muss, desto interessanter werden die Weine“, sagt er. Davon ist auch Stephan Attmann in der Pfalz überzeugt.
An diesem Tag Ende August sind es nur noch wenige Tage bis zur Lese, die Trauben sind so gut wie reif. Doch die in den Dichtpflanzungen sehen anders aus als die anderen: Die Beeren sind kleiner, manche sind gerade mal so groß wie grüne Perlen. „Das bedeutet mehr Dichte, mehr Komplexität, mehr Salzigkeit in den Weinen. Das bekomme ich nur durch Dichtpflanzung hin“, sagt Attmann. Mittlerweile hat er fünf der 50 Hektar des Weinguts dichtgepflanzt. Das bedeutet letztlich zwar deutlich höhere Kosten. Nicht nur für mehr Pflanzen, sondern auch für die Mehrarbeit – schließlich müssen alle Schnittarbeiten doppelt geleistet werden. Julian Huber ist trotzdem überzeugt: „Wenn die Anlage einmal steht, ist das wunderbar: minimale Erträge am Stock und hochkonzentrierte Weine“, sagt er.
Vorbild Burgund: In den dortigen Grand-Cru-Lagen ist Dichtpflanzung Pflicht.
© HANS-JÜRGEN VAN AKKEREN, RICIFOTO/SHUTTERSTOCK.COM
Das einstige Experiment, der Schlossberg, ist mittlerweile komplett dichtbepflanzt. Genau wie der Huber’sche Bienenberg, dessen Spätburgunder im vergangenen Jahr mit 100 Punkten im Gault&Millau bewertet wurde. Die Maximal-Punktzahl erreichte übrigens noch ein anderer Wein aus dem Markgräflerland. Der „Jaspis 10hoch4“ vom Weingut Ziereisen. Sein Name steht für die Dichte der Rebstöcke. Es sind – genau: 10.000 pro Hektar.
Katharina Matheis