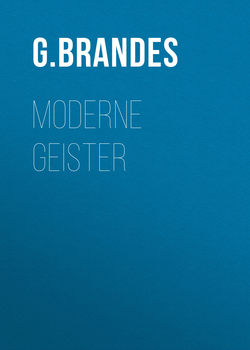Читать книгу Moderne Geister - Георг Брандес - Страница 19
Ernest Renan.
(1880.)
I
ОглавлениеIn ganz jungen Jahren hatte ich mich von Renan's Werken zurückgestossen gefühlt; er ist überhaupt kein Schriftsteller für die Jugend. Sein „Leben Jesu“, das mir zuerst in die Hände fiel, ist ausserdem wohl sein schwächstes Werk; seine Sentimentalität, eine hier bisweilen störend hervortretende Salbung, dieser letzte Rest einer priesterlichen Erziehung, alles das, was einem Jüngling entweder weichlich oder unecht erscheinen musste, liess mich nicht zur gerechten Würdigung seiner grossen schriftstellerischen Eigenschaften kommen. Jener erste Eindruck hatte sich später verloren; die schöne Sammlung „Études d'histoire religieuse“ hatte meine Augen für das fast weibliche Feingefühl geöffnet, das nur einem jugendlichen, noch spröden Geist wie dem meinen, oder einer revolutionären, ungeduldigen Jugend wie der des heutigen Italien, als etwas Unmännliches erscheinen kann, und ich fand es ganz natürlich, dass er, den man mit Recht „den Furchtsamsten unter den Kühnen“ genannt hat, sich nicht ohne Wehmuth über seine Ausnahmestellung aussprach: „Die schlimmste Qual, durch welche der Mann, der sich zu einem Leben im Gedanken durchgekämpft hat, für seine Ausnahme-Stellung büsst, ist die, aus der grossen religiösen Familie, der die besten Seelen der Erde gehören, sich ausgeschlossen zu sehen, und von den Wesen, mit denen er am liebsten in geistiger Vereinigung leben möchte, als ein verderbter Mensch betrachtet zu werden. Man muss seiner selbst sehr sicher sein, um nicht erschüttert zu werden, wenn die Frauen und die Kinder die Hände falten und einem sagen: O glaube wie wir!“
Ich hatte mich jedoch in der Annahme geirrt, dass etwas von diesem elegischen Ton in Renan's alltäglicher Redeweise durchklänge. Der Grundzug seiner Unterhaltung war eine vollständige geistige Freiheit, die grossartige Flottheit des genialen Weltkindes. Der Nerv seiner Worte war eine so unbegrenzte Verachtung der Menge und des Haufens, wie ich sie nie früher bei Jemanden getroffen hatte, der weder Menschenhass noch Bitterkeit spüren liess. Schon das erste Mal, da ich ihn sah, führte er das Gespräch auf die menschliche Dummheit; er sagte, augenscheinlich um dem jüngeren Commilitonen Gemüthsruhe in den kommenden Stürmen des Lebens einzuflössen: „Die meisten Menschen sind gar nicht Menschen, sondern Affen“, aber er sagte es ohne Zorn. Géruzez's Wort fiel mir ein: L'âge mûr méprise avec tolérance. Man spürt diese ruhige Verachtung in seinen Vorreden; sie erhielt viele Jahre später einen dichterischen Ausdruck in seiner Fortsetzung von Shakespeare's „Der Sturm“; aber in seinem Aufsatze über Lamennais hat er sie fast definirt. Er schreibt hier: „Es findet sich bei Lamennais allzu viel Zorn und nicht genug Verachtung. Die literarischen Folgen dieses Fehlers sind sehr ernst. Der Zorn hat Declamation, Plumpheit, oft grobe Injurien zur Folge, die Verachtung dagegen bringt fast immer einen feinen und würdigen Stil hervor. Der Zorn hat das Bedürfniss, sich getheilt zu fühlen. Die Verachtung ist eine feine und durchdringende Wollust, die der Theilnahme Anderer nicht bedarf; sie ist diskret, sich selbst genug“.
Die Gesprächsweise Renan's hatte einen gewissen Schwung, etwas Lebhaftes und Ueberströmendes, ohne welches Niemand bei den Franzosen zu dem Lobe kommt, das in Paris immer Renan ertheilt wird, in Verkehr und Gespräch „charmant“ zu sein. Von dem Feierlichen, das sein Stil oft hat, war in seiner mündlichen Form nichts übrig. Er hatte gar nichts Priesterartiges und gar nichts von dem Pathos eines Märtyrers des freien Gedankens. Er leitete gern eine Einwendung mit seinem Lieblingsausruf Diable! ein, und war so weit entfernt, bittere und elegische Töne anzuschlagen, dass sein Gleichgewicht eher etwas olympisch Heiteres hatte. Wer die kindisch gehässigen Angriffe kannte, denen er täglich von orthodoxer Seite ausgesetzt war, und wer wie ich in dem Journalistenkreise Veuillot's Zeuge gewesen war, wie man dazwischen schwankte, ob das Aufgeknüpft- oder das Erschossenwerden die gerechte Strafe für seine Ketzerei sei, dem lag es nahe, zu fragen, ob Renan nicht recht viel für seine Ueberzeugung ausgestanden habe. „Ich“, lautete die Antwort, „nicht das Geringste. Ich verkehre nicht mit Katholiken, ich kenne nur einen; wir haben nämlich einen in der Académie des inscriptions, und wir sind sehr gute Freunde. Die Predigten, die gegen mich gehalten werden, höre ich nicht; die Broschüren, die gegen mich geschrieben werden, lese ich nicht. Welchen Schaden sollten sie mir denn zufügen?“ Nach Renan's Ansicht würden die gläubigen Katholiken Frankreichs ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen und diese seien weit fanatischer als die katholischen Orthodoxen anderswo, weil der Katholizismus in Spanien und Italien fast als Gewohnheitssache zu betrachten sei, während er in Frankreich durch die intelligente Opposition gereizt werde.
Ich fand Renan im Juni 1870 durch die Begebenheiten in Rom sehr erheitert. „Man sollte Pius IX. eine Statue errichten“, sagte er, „er ist ein ausserordentlicher Mann. Seit Luther hat Niemand der religiösen Freiheit so grosse Dienste geleistet wie er. Er hat die Sachen um dreihundert Jahre gefördert. Ohne ihn hätte der Katholizismus wie in einem geschlossenen Raum mit seinem Spinngewebe und seinem dicken Staub sich sehr gut noch dreihundert Jahre unverändert erhalten können. Jetzt lüften wir aus, und Jedermann sieht, dass der Raum leer ist, und nichts darin steckt“. Er hatte die Furcht gehegt, dass man während der Verhandlungen über die Unfehlbarkeit des Papstes noch im letzten Augenblick irgend ein Kompromiss abschliessen würde, durch welches Alles faktisch so bliebe, wie es sei; diese Möglichkeit war aber eben in jenen Tagen verschwunden, und es liess sich voraussehen, dass man keine Konsequenz scheuen werde, nicht einmal die von Renan angenommene, dass man eine ähnliche Zersplitterung innerhalb des Katholizismus hervorbringe wie die, in welcher der Protestantismus sich befindet. Es hat sich gezeigt, dass die Politik der katholischen Kirche richtiger war, als ihre Gegner im ersten Augenblick meinten. Die eingetretene Spaltung ist weder tief noch bedeutend gewesen und zu einer Zersplitterung, die sich nur annähernd mit dem Sektenwesen des Protestantismus vergleichen liesse, ist nicht die geringste Aussicht vorhanden. Renan, der am meisten an Frankreich dachte, hoffte aber besonders, dass der französische Bürgerstand, der seit der Februarrevolution sich ganz in die Arme der Kirche geworfen hatte, und mit unruhigen Blicken dem kulturfeindlichen Auftreten der päpstlichen Macht zuschaute, endlich die Augen aufmachen werde.
In dem schönen, gediegenen Roman „Ladislaus Bolski“ hat Victor Cherbuliez einen milden Spott mit gewissen Lieblingstheorien Renan's getrieben, indem er dem gutmüthigen aber zum Handeln ganz unfähigen Mentor des Helden die Renan'schen Lehren von der zarten Natur der Wahrheit und von der daraus fliessenden Nothwendigkeit, nur mit der äussersten Vorsicht und Umsicht sich ihr zu nähern, in den Mund gelegt hat. George Richardet glaubt wie Renan, dass es überall auf die Nuance ankommt, dass die Wahrheit nicht einfach weiss oder schwarz, sondern eine Schattirung ist, und scheitert daran, dass man nicht in Schattirungen handeln kann. George Richardet will im Leben die Idee verwirklichen, die Renan an einer Stelle unter vielen so ausgedrückt hat: „Man könnte ebenso gut ein geflügeltes Insekt mit einer Keule zu treffen versuchen, als mit den groben Klauen des Syllogismus die Wahrheit in einer Geisteswissenschaft fassen wollen. Die Logik ergreift die Nuancen nicht, aber die moralischen Wahrheiten beruhen ganz und völlig auf Nuancen. Es nützt deswegen nichts mit der plumpen Gewaltsamkeit eines wilden Schweines sich auf die Wahrheit loszustürzen; die flüchtige und leichte Wahrheit entschlüpft und man verliert nur seine Mühe“. Wer mit Renan's schriftstellerischer Wirksamkeit vertraut ist, weiss, wie vollständig dieser Gedanke ihm gegenwärtig ist, wenn er schreibt. Wenn er aber spricht, wo sind dann seine lieben Nuancen! Während Taine, der in seinen Schriften so derb ist, im Gespräch unaufhörlich moderirt und dämpft, sich nur von den strengsten Gerechtigkeits- und Billigkeitsrücksichten leiten lässt, geht Renan, wenn er spricht, zum äussersten und ist durchaus nicht der Ritter der Nuance. Nur in einem Punkte waren sie beide gleich entschieden in ihren Ausdrücken. Das war, wenn das Gespräch auf jene spiritualistische Philosophie Frankreichs kam, die ihre Stärke in ihrer Allianz mit der Kirche und ihrer Erhebung zur officiellen Staatsphilosophie gesucht hat, die ursprünglich das Herz der Familienväter dadurch gewann, dass sie Dogmen und Tugend in ihrem Schilde führte und die statt der Entdeckung neuer Wahrheiten die Versehung des ganzen Landes mit guten Sitten als Frucht ihrer wissenschaftlichen Fortschritte versprach. Sie hatte ja damals noch alle Lehrstühle Frankreichs inne. In der Sorbonne war sie von Janet und Caro vertreten, von welchen Janet als der feinere und geschmackvollere Geist die Gegner zu verstehen und ihnen gerecht zu sein bestrebt war, während Caro (Bellac in Pailleron's „Le monde, où l'on s'ennuie“) als ächte Mittelmässigkeit mit priesterlichen Armbewegungen und kräftigen Schlägen gegen seinen breiten Brustkasten, durch Appelliren an die Freiheit des Willens und den Glauben an Gott, den Beifall der Zuhörer errang. Für Renan, der doch in einem so eleganten Essay Cousin als Redner und Schriftsteller gelobt hat, war die ganze eklektische Philosophie mündlich nur „offizielle Suppe“, „Kinderbrei“, „Produkt der Mittelmässigkeiten, für die Mittelmässigkeit berechnet“. Ja, so hartnäckig war er in diesem Punkte, dass er, der Fürsprecher der Nuancen, sich niemals ausreden lassen wollte, dass der Spiritualismus unbedingt falsch sei. Für Taine dagegen hegte er eine Bewunderung, die fast leidenschaftlich war. Taine, c'est l'homme du vrai, l'amour de la vérité même. Trotz der so in's Auge springenden Verschiedenheit ihrer Naturen – Taine's Stil hat die Kraft eines Springbrunnens, Renan's Stil fliesst aus der Quelle wie der Vers Lamartine's – erklärte Renan sich mit dem Freund in allen Hauptfragen einig. Und als ich eines Tages einen in Paris oft erörterten Gegenstand zur Sprache brachte, die Frage, wie weit die allgemeine Stimmung Recht habe, die immer über Frankreichs geistigen Niedergang klagte, kam Renan wieder auf Taine zurück: „Niedergang! was heisst das? Alles ist relativ. Ist Taine z. B. nicht bedeutender als Cousin und Villemain zusammen? Es ist noch viel Geist in Frankreich“, und er wiederholte mehrmals diese Worte: Il y a beaucoup d'esprit en France.
Wie die meisten gebildeten Franzosen war Renan ein fast ehrfurchtsvoller Bewunderer George Sand's. Diese ausgezeichnete Frau hatte vermocht, ihre Herrschaft über die jüngeren Generationen Frankreichs auszudehnen, ohne deswegen ihren Jugendidealen untreu zu werden. Einen Idealisten wie Renan gewann sie durch ihren Idealismus, einen Naturalisten wie Taine durch die geheimnissvolle Naturmacht ihres Wesens, der jüngere Dumas, von dem man glauben sollte, dass die Helden und Heldinnen George Sand's, über die seine Dramen manchmal eine bittere Kritik üben, ihm ganz besonders zuwider seien, war vielleicht derjenige unter den nachromantischen Schriftstellern, der ihr persönlich am nächsten stand. Dumas' Begeisterung für George Sand war nur eine Folge seiner literarischen Empfänglichkeit überhaupt, der Enthusiasmus Renan's war von tieferer Art. Ebenso stark wie er Béranger hassen muss, in dem er eine Personifikation all' des Leichtfertigen und Prosaischen in dem französischen Volkscharakter sieht, und dessen philisterhafter Dieu des bonnes gens dem Herder'schen, pantheistischen Denker und Träumer ein Dorn im Auge ist, ebenso lebhafte Sympathien musste er naturgemäss für die Verfasserin von „Lélia“, „Spiridion“ und so vieler anderen schwärmerischen Schriften haben.
Trotz seines weiten Blicks ist Renan jedoch in seinen literarischen Sympathien nicht ohne nationale Beschränkung. Er hatte in einem Gespräche über England durchaus nichts Gutes über Dickens zu sagen; nicht einmal für Billigkeit war er gestimmt. „Der anspruchsvolle Stil von Dickens“ sagte er, „macht auf mich denselben Eindruck, wie der Stil einer Provinzial-Zeitung“. Sein bekannter ungerechter Artikel über Feuerbach setzt Einen weniger in Erstaunen, wenn man hört, in welchem Grade er über die Mängel bei Dickens dessen Vorzüge übersieht. Er ist derselbe bis zum Krankhaften entwickelte Sinn für eine klassische und temperirte Ausdrucksweise, der Renan die humoristischen, an die Shakespearischen Clowns gemahnenden Sonderbarkeiten in Dickens' Stil und die leidenschaftliche Form bei Feuerbach antipathisch macht; die geniale Manierirtheit des Engländers kommt ihm provinziell vor, die Gewaltsamkeit des Deutschen scheint ihm einen so zu sagen tabaksartigen Beigeschmack von der Pedanterie des studentischen Atheismus zu haben. Er ist in seinem literarischen Geschmack Romane und Pariser, classisch und gedämpft.