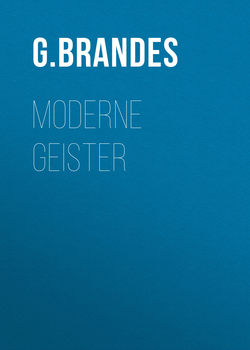Читать книгу Moderne Geister - Георг Брандес - Страница 25
Ernest Renan als Dramatiker.
(1893.)
II
ОглавлениеObgleich heutigen Tages die Theater fast gänzlich Unterhaltungsanstalten für die Armen im Geiste, für jenen beträchtlichen Theil des Bürgerstandes, der nicht lesen kann oder mag, geworden sind, bewahrt die dramatische Form nichtsdestoweniger für Viele ihren Reiz. Es ist die bündigste, geschlossenste Form, in welcher man ein Lebensbild, eine Handlung kennen zu lernen vermag. Wer über zwei Stunden und nicht mehr verfügt, wird nicht nach einem Romane, sondern nach einem Schauspiel greifen. Er weiss, alles nicht streng zur Sache Gehörige ist hier ausgeschieden.
Auch andere Männer als eigentliche Dichter haben sich von der Gesprächsform angezogen gefühlt. Es sind das solche, deren Gedanken sich in Sphären bewegen, in welchen es keine unanfechtbare Wahrheit, keine volle Sicherheit gibt, wo vielmehr verschiedene Meinungen, Auffassungen, Ueberzeugungen zu Worte kommen können. Ausserhalb der Mathematik und der exacten Wissenschaften gibt es wenig unbedingt Sicheres, Vieles, worüber sich Verschiedenes für und wider sagen lässt. Innerhalb der Geisteswissenschaften ist beinahe Alles Gegenstand immer erneuerter Erörterung. Von diesem Gefühle beherrscht, schrieb Plato seine Werke in Dialogform. Das gleiche Gefühl führte in unseren Tagen Renan zu deren Anwendung. Kurz nach der Beendigung des französisch-deutschen Krieges schrieb er erst eine Reihe philosophischer Gespräche und brachte hierauf einige seiner Lieblingsideen in bestimmterer dramatischer Form zum Ausdrucke. In den Pausen zwischen seinen streng wissenschaftlichen Arbeiten hat er vier philosophische Schauspiele und ein Paar dialogisirte Prologe geschrieben.
Sein Ausgangspunkt als Dramatiker war Shakespeare's „Sturm“, welcher – an und für sich höchst merkwürdig als der wahrscheinliche Schlussstein an Shakespeare's dramatischem Bau, wie als diejenige Arbeit des Dichters, die mehr als irgend eine andere tief und deutlich symbolisch ist – Renan durch das Sinnbildliche der drei Hauptpersonen: Prospero, Caliban und Ariel, ergriff.
Caliban ist das formlose Naturwesen, der Urbewohner, halb Thier, halb Kannibale, roh und furchtbar, niedrig und dumm, eine Station erst auf dem Wege zum Menschthum. Prospero ist der Zukunftstypus einer höchsten Veredlung der Menschennatur, ein Wesen, das in gleich königlicher, genialer Weise sich die äussere Natur unterworfen und seine innere ins Gleichgewicht gebracht hat, alle Bitterkeit über erlittenes Unrecht in der Harmonie ertränkend, die seinem reichen Seelenleben entströmt.
Prospero beherrscht die Naturkräfte. Statt ihm aber den Zauberstab der Ueberlieferung zu leihen, hat Shakespeare die Naturkraft selber zu seinem dienstbaren Geist gemacht. Ariel, das ist der Geist. Shakespeare, so scheint es, hat sich selbst als jenen Magus auf der verzauberten Insel des Theaters darstellen wollen, dem der Lichtgeist Diener, der Geist der Rohheit Sklave ist.
Diese Gestalt musste auf Renan nothwendig einen starken Eindruck machen, passte sie doch ganz merkwürdig in den Ideengang hinein, zu dem seine Lebensansicht ihn geführt hatte. Früh hatte sich ihm die Erkenntniss aufgedrängt, dass das Werthvollste am Menschen ihn in allen weltlichen Beziehungen des Kampfes um das Dasein in einen Zustand der geringeren Widerstandskraft versetze. Echtes Talent, tiefinnige Güte, vollkommener Hochsinn sind häufig Bedingungen des Unterliegens. Wer im Spiele betrügt, wirft die meisten Augen, wer mit Schneiderhieben zur Hand ist, verwundet seinen Gegner.
Es wollte ihm scheinen, dass die Welt fast ausschliesslich von der Rohheit, der Unwahrheit, der Marktschreierei regiert werde. Kein Wunder also, dass Prospero aus seinem Reiche vertrieben wird.
Renan neigte zu der Ansicht, dass Alle, die da arbeiten und wirken, von der Weltenmacht zu einem höheren Zwecke kraft dessen ausgebeutet werden, was Hegel, der einen ungemeinen Einfluss auf Renan geübt, die List der Idee, er selbst jedoch den Macchiavellismus der Natur nannte.
Diese Ansicht hat eine stete Ironie in Renan's Haltung zur Folge gehabt. Er will sich zwar um Genüsse betrügen lassen, ohne Lohn arbeiten und entsagen, da doch alle Arbeit viel Entsagung fordert, allein er will dem All gegenüber, das er als alter Theologe gerne personificirt, eine Haltung bewahren, die bezeugt, er wisse sich getäuscht. Daher liegt ihm aller Pharisäismus so ferne. Er ist nicht stolz auf seine Tugenden. Er weiss, als tugendhaft wird er geprellt. Doch er willigt ein, sich prellen zu lassen.
Wenn Renan gleich Hegel und Schopenhauer an einen Macchiavellismus der Natur glaubt, so kommt es daher, dass ihm die Vorstellung eines Naturzweckes vorschwebt. Nun hat die moderne Wissenschaft diesen Begriff bekanntlich geschleift und erst wirkliche Fortschritte gemacht, nachdem er geschleift worden. Ueberall späht jetzt die Wissenschaft nach wirkenden Ursachen, wo man früher ohne Nutzen nach Zweckursachen gesucht hat. Jener grosse Theil der modernen Forschung, der in den Darwinismus mündete, hat seine Stärke darin, die Vorstellung von einem Zwecke in der Natur überflüssig gemacht zu haben. Was sich den Verhältnissen und Umgebungen anpasst, überlebt das Andere. Es nimmt sich nur aus, als entspräche es einem Zwecke, weil die Lebensmöglichkeit von der eingetretenen Aenderung abhing.
Der Darwinismus berührt indessen durchaus nicht die höchsten Fragen, beschäftigt sich nicht mit dem uranfänglichen Lebenstriebe, dem Streben (nisus), welches das Princip der Bewegung ist.
Die Mathematik ist bekanntlich eine grosse Tautologie. Wie verwickelt die Berechnungen und Messungen auch sein mögen, stets bleibt gleich viel auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens, und Alles lässt sich auf den Identitätssatz a = a zurückführen. Aber auch das Weltall ist eine grosse Tautologie. Das Gesetz der Erhaltung der Kraft zeigt es uns als solche: kein Staubkorn und keine Bewegung kann verschwinden; Alles ist blosser Umsatz; bei der grossen Verbrennung wird nichts vernichtet; die Summe ist unabänderlich dieselbe.
Nichtsdestoweniger ist die Welt in keinem Zustande der Ruhe. Desshalb hält Renan sich für berechtigt, ein Ziel in der Natur vorauszusetzen und von einer Gottheit zu sprechen. Diese Gottheit ist der Lebenstrieb, und das Ziel ist, wie Hegel sagte, Bewusstsein. Die Natur strebt nach einem immer vollkommeneren Bewusstsein. Renan drückt dies so aus, dass die kleine Ernte an Vernunft, Hochsinn, Schönheitswerken und Weisheit, die jeder Planet im Laufe seiner Lebenszeit einzuheimsen vermag, der Endzweck dieses Planets sei, wie Gummi der des Gummibaumes. Wir glauben, es lasse sich in jedem Zeitalter ein kleiner Zuschuss an Vernunft und Güte beobachten, und leiten davon den Glauben an einen Fortschritt ab.
Wie aber diesen Fortschritt sichern, diesen endlichen kleinen Ernte-Ertrag?
Sein Schicksal kann zuweilen von einem Manne oder doch von einigen wenigen Männern abhängen. Nur zu leicht kann die Weltentwicklung unterbrochen werden. Der christliche Dogmatismus unterbrach sie ein Jahrtausend lang. Sie lässt sich von Barbarei, oder Inquisition, oder niederer Selbstsucht unterbrochen denken. Der einer allgemeinen Entwicklung förderlichen Menschen sind nur äusserst wenige, und leicht sind sie auszurotten oder lahmzulegen. Man bedenke nur, wie viele die Religionen und die Despotien zu Grunde gerichtet haben, oder nur Mächte, wie die Inquisition in Spanien, die Regierung in Russland.
Der Gedanke, die zwei Milliarden Menschen der Erde, einen um den andern zur Vernunft zu bekehren, ist ein leerer Traum. Die Bekehrung ist unmöglich, aber auch unnöthig. Es handelt sich nicht darum, dass alle Menschen das Wahre erkennen, sondern darum, dass es von einigen Wenigen erkannt, und die Ueberlieferung bewahrt werde. Abel's Theorien sind um nichts weniger unanfechtbar, weil es auf Erden nur etwa hundert Menschen gibt, die sie verstehen. Für die Wahrheit ist nicht nöthig, dass alle Welt sich zu ihr bekenne; die sie nicht verstehen, sollen sich ihr nur beugen.
Die höchste Cultur aber kann von der Menge weder verstanden noch gewürdigt werden. Da gilt es denn, sie gegen die Menge sicherzustellen. In alten Tagen kam die Gefahr besonders von der Kirche. In den unseren wird die Entwicklung vornehmlich von der herrschenden Anschauung, der Staat brauche nur das materielle Wohl der Individuen im Auge zu haben, bedroht.
Ein Genie ist ja etwas sehr Seltenes und Kostbares. Es scheint, dass etliche Millionen Menschen auf Eine für den Fortschritt massgebende Persönlichkeit kommen, ja dass, um Geister ersten Ranges hervorzubringen, Gesellschaftskörper von dreissig, vierzig Millionen Menschen vonnöthen seien. Diese Geister aber werden von der Mittelmässigkeit instinktiv gehasst. Sie weiss Leinwand, allenfalls Tuch zu würdigen, nicht aber Spitzen.
Der grosse Mensch ist Renan gleichwohl kein Luxus. In Wirklichkeit bedeutet er das vorläufige Ziel, und worauf es mit Rücksicht auf die Ziele der Natur ankommt, ist denn, dass der grosse Mensch zur Macht gelange. Nur so ist die Vernunftentwicklung sicherzustellen.
In der Urzeit galt der bedeutende Mann für einen Zauberer. Man zitterte vor ihm. Die Brahmanen haben jahrhundertelang vermöge des Aberglaubens regiert, dass ihr Blick dem Angehörigen einer niederen Kaste, auf den er falle, tödtlich sei. Die Kirche, die einst die Culturmacht war, hatte die Höllenstrafen als Waffe – eine gar wirksame, so lange an sie geglaubt wurde. Als die Königsmacht die Culturträgerin wurde, schuf auch sie sich ihre Waffen: Heere und Kanonen, Richter und Gefängnisse. Ein Jeder ist nur stark im Verhältnisse zu der Furcht, die er einzuflössen vermag.
Das von Renan erträumte Ziel ist demnach, die Träger der Entwicklung, die Culturträger mit den entscheidenden Machtmitteln auszustatten, sie aufs neue zu einer Art von Zauberern zu machen. In ihren Händen allein würde die Macht nicht odios, sondern wohlthätig sein. Sie würden als die menschgewordene Vernunft erscheinen, als eine wahrhaft unfehlbare päpstliche Macht. Mit den Schreckmitteln, welche die moderne Wissenschaft in ihre Hand legte, würden sie einen Terrorismus der Vernunft einführen.
Wir erleben in unseren Tagen, wo wir das Dynamit in den Händen der zerstörenden und die Millionenheere mit den verfeinerten Mordwerkzeugen in der Gewalt der reactionären Elemente sehen, eine Schreckensherrschaft der Brutalität. Renan stellt sich nun vor, dass der Bund aller der höchsten und reinsten Begabungen unwiderstehlich sein würde, weil er über die Existenz des Planeten selbst geböte. Er übersieht merkwürdigerweise, dass selbst wenn dies nicht eine blosse Phantasie wäre, sich die Drohung mit der Vernichtung des Planeten aus dem Grunde als unbrauchbar erwiese, weil sie den Widersetzigen gegenüber sich nicht stückweise ausführen liesse.
Zur selben Zeit, als Eduard v. Hartmann den Traum einer freiwilligen Selbstvernichtung der Menschheit auf ähnliche Art durch einen Beschluss der höchststehenden Menschen träumte, hat Renan von dieser Drohung als Mittel in der Hand der höchststehenden Wesen geträumt. Wesen müssen sie genannt werden, nicht Menschen; denn sie sind es, die später bei Nietzsche mit dem Namen Uebermenschen belegt werden.
Ist nur einmal der Begriff der Entwicklung gesichert, wird, nach Renan's Meinung, wie die Menschheit aus der Thierheit hervorging, das Göttliche aus dem Menschlichen hervorgehen können. Wesen werden entstehen können, welche die Menschen so gebrauchen, wie jetzt wir die Thiere.
Er hat zunächst im Scherze Phantasien über eine Art Stuterei solcher genialer Herrschergeister, eine Art Asgaard, entwickelt. Allen Ernstes glaubt er an die Möglichkeit des Entstehens einer höheren Menschenart, und an diesem Punkte eben ist es, wo Renan die Anknüpfung an die Shakespeare'sche Dichtung sucht.
Prospero ist der Zukunftsmensch, der Uebermensch. Renan erblickt daher in ihm das erste Exemplar der höheren Menschheit, den wirklichen Zauberer.
Die Handlung des Schauspiels „Caliban“ bildet Caliban's Empörung gegen Prospero und der siegreiche Ausgang dieser Empörung.
Folgendes bildet die Voraussetzung des Stückes: Jedes Wesen ist undankbar, alle Erziehung kehrt sich wider den Erzieher; das Erste ist stets, die Waffen, die er die subalterne Persönlichkeit gebrauchen lehrte, gegen ihn zu kehren. So im Verhältnisse der Klassen zu einander, so im Verhältniss der einzelnen Persönlichkeiten im öffentlichen Leben.
Caliban verabscheut seinen Erzieher, Wohlthäter und Zuchtmeister Prospero. Ariel hingegen verehrt ihn, denn er erfasst Prospero's Gedanken. Prospero glaubt, dass Gott die Vernunft ist, und arbeitet darauf hin, dass Gott, das heisst die Vernunft, sich die Welt mehr und mehr unterthan mache. Prospero glaubt an den Gott, der das Genie im genialen Manne, die Güte in der zärtlichen Seele, überhaupt das allgemeine Streben nach der Existenz dessen ist, was allein in Wahrheit existirt.
Man verachtet den Herzog an seinem Hofe, wie man einen Regenten, der gelehrt ist, verachtet. Man hat nur vor demjenigen Respect, der todtschlägt, und Prospero wird von einer „Revolution der Verachtung“ bedroht.
Wir sehen hierauf Caliban den gemeinen Mann aufwiegeln. Er spiegelt diesem vor, Prospero beute das Volk aus. Es gelte, sich seiner Bücher und Destillirkolben zu bemächtigen. Man bittet Caliban, die allgemeine Glückseligkeit zu decretiren. Er verspricht, es zu thun, wenn die Zeit dazu komme: Später, später! – Es lebe Caliban, der grosse Bürger! – Er empfängt Processionen, Deputationen und Gesuche, wird Volksredner, verspricht, Alle zufrieden zu stellen: Wir sind aus euch hervorgegangen, wir wollen für euch wirken, wir existiren durch euch.
Abends legt er sich in Prospero's Bett zur Ruhe. Er grübelt: Ich war ungerecht gegen Prospero. Welche Begehrlichkeit nach Genuss! Welches Umsturzverlangen! Eine Regierung muss Widerstand leisten. Ich will Widerstand leisten.
Schon ist er hoch conservativ, sieht ein, dass Schlösser, Hoffeste, fürstliche Pracht die Zierde des Lebens seien.
Da Künstler und Schriftsteller die Ehre eines Reiches sind, will er Kunst und Literatur heben und fördern. Doch der Mittelpunkt aller seiner Gedanken bildet Imperia, die reizende Courtisane – wohl bekannt aus Balzac's „Contes drôlatiques“ – die kürzlich bei einem Feste in Prospero's Palaste, bei welchem verschiedene Lebensanschauungen zur Erörterung gekommen, die Sache der Liebe verfocht. Er will ihre nähere Bekanntschaft machen.
Es bleibt Prospero nicht lange unbekannt, dass Caliban, sein Thier, sein Ablöser geworden. Ariel's Phantasmagorien haben sich den Schaaren Caliban's gegenüber als unwirksam erwiesen; Niemand unter diesen Schaaren glaubt mehr an Zauber, und die Aufrührer haben Prospero's Pulver und Kriegsmaschinen in Gebrauch genommen. Bei der nun folgenden Berathung über die zu ergreifenden Massregeln äussert sich Renan über den geringen Nutzen, welchen er sich von dem Elementar-Unterrichte verspricht, indem er „Simplicon“ die Replik in den Mund legt, „allgemeiner obligatorischer Schulunterricht würde allen Uebeln abhelfen“. Der gemässigte Bonaccorso aber spricht das erlösende Wort, die neue Regierung scheine wohlgesinnt; Caliban sei bereits der Mittelpunkt der gemässigten Partei.
Die Inquisition tritt auf. Caliban beschützt Prospero. Er ist nicht nur massvoll, er ist anti-clerical, hat also eine gute Eigenschaft mehr. Allmälig beschützt er Alles und Alle: den Papst, die Künstler, die Wissenschaften und Prospero gegen den päpstlichen Legaten: „Ich will ihn nicht ausliefern, sondern ausnützen“.
Prospero resignirt, und die Moral des Stückes wird vom Prior des Karthäuser-Klosters ausgesprochen: „Ist er nur ordentlich gekämmt und gewaschen, so wird Caliban sehr präsentabel“.
Es liegt eine Verachtung, deren Tiefe sich schwer ermessen lässt, in dieser Huldigung der einst revolutionären, jetzt moderaten oder conservativen Demokratie. Und ebenso birgt sich eine tiefe Ueberzeugung von der Nichtigkeit des Weltlebens hinter dem leichten Spiel der Handlung.
Das Gespräch der Hofleute im zweiten Acte erörtert die Frage nach einem festen Halt im Leben. Die Familie, schlägt der Eine vor. – Da müsste man überzeugt sein, die eigene Familie sei die beste, und sich sogar davon nicht beirren lassen, dass alle Anderen der gleichen Ueberzeugung sind. Das ist denn also Vorurtheil, Eitelkeit. Und was von der Familie gilt, gilt auch vom Vaterlande. Man geht nur darin auf, so lange man an dessen besondere Vortrefflichkeit glaubt. – Nein, sagt ein Zweiter, auserlesene Genüsse, das ist das einzig Solide. – Gut, wenn nun aber Alle geniessen wollen? – So halten wir sie mit gewappneter Hand nieder. – Wie aber, wenn die Waffe sich gegen den kehrt, der sie gebrauchen will? Nein, besser doch, sich auf die Nation zu stützen. – Was wir unter Nation verstehen, entspricht nur den Interessen einer Minderzahl. Wie soll man in der Zukunft die Vielen dazu bringen, ihr Leben für die Interessen der Wenigen aufs Spiel zu setzen? – Dadurch, dass man sie aufklärt? – Keineswegs, gerade im Gegentheile. Sich für eine Sache todtschlagen zu lassen, ist eine grosse Naivetät, die grösste Naivetät, da sie nicht wieder gut zu machen ist. Bedenken Sie, dass Millionen sich todtschlagen liessen für collective Wesen, wie der Staat, die Kirche! – Gleichviel. Nun wären sie dennoch todt. – Wenn Türken und Christen sich schlagen, so glauben sie ins Paradies zu kommen, wofern sie in dem heiligen Kriege fallen. Gibt es aber das Paradies der Einen, so gibt es das der Anderen nicht. Noch denken sie nicht, dass es also wahrscheinlich keines der beiden Paradiese gebe. Eitelkeit! – Sehen Sie die Türken! Man treibt sie mit Hilfe falscher Wechsel auf das ewige Leben in die Schlacht. – Solche falsche Wechsel sollten verboten werden. Sie führen eine Inferiorität der civilisirten Völkerschaften, die nicht daran glauben, herbei. Der Roheste bleibt Sieger und wird als Sieger noch roher. – Mit anderen Worten: Die Aufklärung vernichtet die Widerstandskraft der Völker. Alles ist eitel. Die Philosophie, welche die Vorurtheile zerstört, zerstört damit das Fundament des Lebens selbst.
Nur die Schönheit tritt während dieser Niedermetzlung anerkannter Mächte, in der Gestalt Imperia's verkörpert, als eine bewunderte Wirklichkeit hervor. Wie zum Trotze, doch nicht aus Trotz hat Renan in seinem Schauspiele die grosse Courtisane zur Vertreterin der Schönheit und Liebe gemacht. Sie personificirt die Welt der Schönheit, wie Prospero die des Gedankens. Balzac hatte sie mit künstlerischer Begeisterung gemalt; Renan erkennt sie als vollberechtigte Lebensmacht an und verhandelt mit ihr wie von Macht zu Macht.
Er lässt sie die Unvergänglichkeit der Schönheit und der Liebe verkünden. Alles ist flüchtig, doch das Flüchtige ist zuweilen göttlich. Seht den Schmetterling. Nur innerhalb eines ganz kurzen Abschnittes im Leben des Wurmes existirt er, wie im Dasein der Pflanze nur wenige Augenblicke die Blume ist. Die Liebe aber thut das Wunder, dass das plumpe kriechende Insect beflügelt und ideal wird. Das Leben des Falters ist während einiger Stunden das Höchste: blühen, lieben, sterben.
Imperia kommt aufs neue als Brunissende, die Liebhaberin des Papstes, im Schauspiele „Der Jungbrunnen“ vor, hier leichtfertiger, doch in den Augen Renan's deshalb nicht minder sympathisch. Sie ist hier tiefer weiblich, ist eitel Stärke und Schmachten. Sie hat jede Schwäche und nimmt dennoch die Welt in Besitz. Sie vertheilt alle Einnahmen des päpstlichen Stuhles nach Lust und Laune. Um so besser! heisst es. Des Weibes Schönheit ist ein Gut von höchstem Range, von gleich hohem Range wie Vernunft und edle Gesinnung: „Alle geistlichen Einnahmen sollten zu Toiletten-Ausgaben für schöne Frauen und zu Jahrgeldern für geistvolle Männer verwendet werden“.
„Der Born der Jugend“ ist trotz seiner Mängel ein von Geist sprudelndes Stück. Es spielt am päpstlichen Hofe in Avignon und hat eine ganz schwache Localfärbung, auch keine stark historische, die sie sogar ausdrücklich vermeiden will.
Renan hat hier seinen Prospero wieder aufgenommen und ihn als die überlegene Intelligenz erscheinen lassen, die zur Zeit ihrer Autorität über die Menschheit verlustig geworden ist. Seine magischen Mittel haben ihre Kraft verloren. Doch ob schwach und entwaffnet, er verfolgt gleichwohl sein Problem: die Erlangung der Macht mittelst der Wissenschaft. Er hat verschiedene wunderbare Essenzen erfunden, darunter ein Lebenselixir, das verjüngende Kraft besitzt. Der Papst, der nach einer etwas übermässig angestrengten Jugend sehr mitgenommen ist, behält ihn in seiner Nähe, um von den Resultaten seiner wissenschaftlichen Versuche Nutzen zu ziehen. Doch hat er grosse Mühe, ihn vor den Nachstellungen der Inquisition zu schützen.
Man glaubt, dass Prospero Gold machen könne. Er hegt gar nicht diesen Wunsch. Wozu auch? Könnte man doch, wenn es möglich wäre, ebensogut Blei machen wollen. Er zieht es vor, Licht aus Koth, Geist aus Stoff zu erschaffen. Und er zweifelt nicht, dass es einst gelingen werde, denn langsam sickert Vernunft in die Welt; vielleicht, dass zuletzt sogar ein wenig Gerechtigkeit in sie dringt. (Renan's ganze Skepsis äussert sich in diesem Satze.)
Prospero ist der Ueberzeugung, dass die Welt beinahe gänzlich von Brutalität regiert werde. Die unabhängigen Bauern der Schweiz, sagt er mit feiner Ironie, sind nicht viel aufgeklärter als die Herren. (Man erwartete die umgekehrte Wendung.) Ungerechtigkeit ist demzufolge das eigentliche Princip im Laufe der Welt. Allen Wohlthätern der Menschheit ergeht es übel. Man verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen ihrer Entdeckung, und Andere nützen aus, was sie gefunden haben.
Ein Grundgedanke wird im Zusammenhange damit ausgesprochen, der sicherlich schon Manchem gekommen ist, ehe er ihn bei Renan fand. Prospero, der sich collegial mit Papst Clemens unterredet, sagt diesem offen, dass ihn der Papst enttäuscht habe. Er spricht (schon um das Jahr 1310) das gewichtige Wort: „Ich hatte von einer Papstmacht geträumt, die an der Spitze der Renaissance schritt“. – Der Papst: „Also das Christenthum durch das Papstthum zerstört?“ – Prospero: „Ja!“.
Renan berührt hier eine für den denkenden Betrachter der Geschichte fesselnde Frage, die Nietzsche so stark beschäftigende, ob die lutherische Reformation die Renaissance nicht abgebrochen und vereitelt habe, ob nicht die Deutschen aus Mangel an Verständniss für das, was damals in Europa vorging, sie vergeudet.
Was sah Luther in Rom? Sehr wenig. Nicht einmal Michelangelo. Er beobachtete mit Entsetzen die schlechten Sitten der Geistlichen, sah, dass ihnen weder Dogmen noch evangelische Vorschriften am Herzen lagen. Das war so ungefähr Alles. Die Renaissance hatte alle Bedingungen wie auch den Willen, von oben her, mittelst der päpstlichen Macht die Menschheit zu befreien. Einzelne Päpste hatten – gleichwie die grössten Kaiser des frühen Mittelalters (Friedrich II., der Hohenstaufe zum Beispiel) – sich an die Spitze einer Bewegung für Wiedereinführung der tausend Jahre brach gelegenen Cultur gestellt. Da kam Luther, zwang den Katholicismus in die Gegen-Reformation hinein und machte das Papstthum reactionär.
Prospero hat das richtige Gefühl, dass das allmächtige Papstthum, geschirmt von der Ehrfurcht, die es einflösste, fast all den Aberglauben und die Irrthümer, deren Haupt es war, zu unterdrücken vermöchte. Doch stattet Renan seinen Helden mit der prophetischen Furcht aus, das Papstthum werde, erschreckt von seiner eigenen Kühnheit, die Segel reffen und die Bewegung, die es selbst begünstigt habe, ins Stocken zu bringen suchen. Mit anderen Worten, er lässt Prospero vorhersagen, was wirklich eintraf. Er lässt auch Brunissende mit Prospero sympathisiren: „Wir Frauen sind von den gleichen Gedanken erfüllt wie du. Der Aberglaube hat das Leben verringert. Wir wollen es aus dem Vollen leben“. Und sie fragt Prospero: „Willst du nicht uns Frauen ein Buch schreiben?“ Renan erwidert durch seinen Wortführer: „Andere werden dies thun, schöne Brunissende. Ich bin zu alt, mein Ende ist nahe“. Wohl nie zuvor hat Renan sich auf so directe Selbstschilderung eingelassen.
Der Papst fragt ihn: „Wie kommt es, dass die anderen Doctoren mir alle mit einander nicht so viel zu schaffen machen, wie du allein?“ – „Weil sie mit Abstractionen arbeiten, während ich mit Wirklichkeiten hantiere“. – „Doch nicht einmal die Doctoren mögen deine Ideen theilen, und der Haufe wird sie nicht verstehen. Du erlangst weder über die Kirche noch über die Schule Macht“. Man hört Renan's eigenen Schmerz aus dieser Aeusserung heraus.
Persönlich ist auch die folgende Wendung, gelegentlich einer von der Inquisition vorgenommenen Durchsuchung seiner Schriften, bei der man ihm räth, dies und das zu widerrufen. – „Es nützt nichts. Alles an mir ist dennoch Ketzerei“. – „Eben, das schadet weit weniger“. – Mit anderen Worten, es ist allein die geistlos isolirte Einzelheit, welche die Ketzerverfolger verstehen.
Ungeachtet aller Widerwärtigkeiten, Verfolgungen, Enttäuschungen verliert Prospero seine Zukunftshoffnung nicht. Dies sein Gedanke: Der Fall des Würfels, der tief unten an den Lebensquellen geworfen wird und entscheidet, ob ein Hirn begabt oder unbegabt, ein Weib schön oder unschön sei, findet so häufig statt, dass die Zukunft des Wahren, des Guten, des Schönen gesichert ist. Die Natur hat unendliche Zeit vor sich. Was liegt daran, ob hunderttausendmal der Schuss fehlgehe, wenn unzählige Male geschossen wird und nur Eine Kugel ins Centrum trifft. – Prospero selbst ist mit seinem Lose zufrieden: „Ich war eine seltene Quarterne in der grossen Lotterie. Der Kelch des Lebens ist herrlich. Es ist thöricht, zu klagen, weil man ihm auf den Grund schaut“. – Er hat nur einen Wunsch: „Lasst mich kein betrübtes Antlitz sehen, keinen Seufzer hören, wenn ich nun sterbe!“ Und er verscheidet, von Brunissende zum Abschiede geküsst.
Die Cardinäle bemächtigen sich seines Leichnams, lassen ihn in ein Boot legen, auf die Rhône hinausrudern und ins Wasser werfen. „Findet man seine Leiche auf, so sagen wir der Bevölkerung, er hätte sich ertränkt; findet sie sich nicht, so sagen wir, der Teufel habe ihn geholt“.
Es liegt echt Renan'sche Ironie in der Perspective, die sich hiemit für Prospero's Andenken eröffnet. Im selben Geiste bespricht er in der Vorrede zu seinem letzten Buche die gegen ihn gerichtete Beschuldigung, er hätte von Rothschild eine Million dafür bekommen, „Die Geschichte Israel's“ zu schreiben. Seine Feinde behaupten, seine Freunde bestreiten es. Die unparteiische Geschichtsschreibung der Zukunft wird, meint er, einen Mittelweg einschlagen und feststellen, dass er 500,000 Francs empfangen habe.