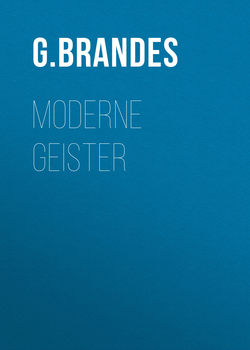Читать книгу Moderne Geister - Георг Брандес - Страница 20
Ernest Renan.
(1880.)
II
ОглавлениеRenan stand im Vorsommer 1870 in Begriff, eine Reise nach Spitzbergen in Begleitung des Prinzen Napoleon anzutreten. Kurz vor dieser Reise sprach er eines Tages von Politik. „Sie können“, sagte er, „den Kaiser vollständig durch seine Schriften kennen lernen.23 Er ist ein Journalist auf dem Thron, ein Publicist, der immer die öffentliche Meinung ausfragt. Da seine ganze Macht auf ihr beruht, braucht er trotz seines geringeren Gehalts mehr Kunst als Bismarck, der sich über alles hinwegsetzen kann. Bis jetzt ist er nur körperlich, nicht geistig geschwächt, aber er ist äusserst vorsichtig geworden (extrêmement cauteleux) und hat ein Misstrauen in sich selbst, das er früher nicht kannte“. Renan urtheilte über Napoleon ungefähr wie Sainte-Beuve in dem bekannten nach seinem Tode herausgegebenen Fragment über „Das Leben Cäsars“, in welchem er die Cäsaren „zweiter Classe“ schildert, jene die „im Purpur oder neben dem Purpur geboren“ sind und „etwas Gequältes, Ausgearbeitetes, Fabricirtes“ an sich haben. Ollivier, den Renan schon sehr lange kannte und der eben in jenen Tagen seine kurze Rolle als anscheinend constitutioneller Premierminister spielte, beurtheilte er mit Strenge. Er sagte: „Er und der Kaiser passen vorzüglich zusammen. Sie sind geistig verstanden Verwandte, sie haben dieselbe Art von ehrgeiziger Mystik, sind so zu sagen durch die Chimäre verschwägert“. Schon im Jahre 1851 hatte Ollivier oft zu Renan gesagt: „Sobald ich ans Ruder komme, sobald ich Premier-Minister werde …“
Wenn ich nun in diesen Gesprächen mit meinem damaligen einfachen politischen Grundgedanken, der Nothwendigkeit des Schulzwangs, des unentgeltlichen oder doch äusserst billigen Unterrichts auch für Frankreich, hervorrückte, einem Gedanken, den ich überall zu vertheidigen Anlass hatte und der überall wie eine Ungereimtheit oder eine alte längst aufgegebene Schrulle behandelt wurde, war Renan nach meinen Vorstellungen so paradox, dass ich kaum an seinen Ernst glauben konnte. Seine Argumente haben besonders deswegen Interesse, weil man sie (nur in anderer Form) allenthalben in Frankreich von den Männern des zweiten Kaiserreichs vorbringen hörte. Renan behauptete erstens, gezwungener Unterricht sei eine Tyrannei. „Ich habe selbst“, sagte er „ein kleines Kind, das gebrechlich ist. Wie despotisch, es von mir zu nehmen, um es zu unterrichten!“ Ich entgegnete, dass es durch das Gesetz Ausnahme gäbe. „Dann würde Niemand die Kinder in die Schule schicken“, antwortete er. „Sie kennen nicht unsere französischen Bauern. Sie würden sich nie was daraus machen. Lassen Sie sie die Erde bauen und ihre Steuern zahlen oder geben Sie ihnen ein Gewehr in die Hand und einen Sack auf den Rücken, und sie sind die besten Soldaten der Welt. Aber was für die eine Race passt, passt für die andere nicht. Frankreich ist kein Land wie Schottland oder Skandinavien; die puritanischen und germanischen Gewohnheiten finden hier keinen Boden. Frankreich ist z. B. kein religiöses Land und jeder Versuch, es dazu machen zu wollen, wird scheitern. Es ist ein Land, das zwei Sachen hervorbringt; was gross und was fein ist (du grand et du fin). Die respektable Mittelmässigkeit wird nie hier gedeihen. In diesen zwei Worten ist das ideale Bedürfniss der Bevölkerung ausgedrückt; im Uebrigen will sie nur eins, sich amüsiren, durch Vergnügungen empfinden, dass sie lebt. Und endlich, glauben Sie mir, es ist meine feste Ueberzeugung, dass der elementare Unterricht geradezu ein Uebel ist. Was ist ein Mensch, der lesen und schreiben kann, ich meine: ein Mensch, der nicht mehr als lesen und schreiben kann? Ein Thier, ein dummes und eingebildetes Thier. Geben Sie den Menschen einen Unterricht von 15 bis 20 Jahren, wenn Sie es können, sonst Nichts! Was dazwischen liegt, ist so fern davon, sie klüger zu machen, dass es nur ihre liebenswürdige Natürlichkeit, ihren Instinkt, ihre gesunde Vernunft verdirbt, und sie unerträglich macht. Gibt es etwas Schlimmeres, als von Seminaristen regiert zu werden? Die einzige Ursache, warum wir uns jetzt mit dieser Frage beschäftigen müssen, ist, weil dieser Haufen Gassenbuben (ce tas de gamins) uns zu seiner Zeit das allgemeine Stimmrecht aufzwang. Nein, seien wir darüber einig, dass nur bei den Hochgebildeten die Bildung ein Gutes ist und dass die Halbgebildeten nur wie unnütze und hochmüthige Affen zu betrachten sind“. Ich sprach von Dezentralisation, davon, die Provinzialstädte, Lyon z. B. zu heben. „Lyon“, brach er in vollem Ernste aus, „es würde doch wohl Niemanden einfallen, die Provinzial-Hauptstädte zu geistigen Brennpunkten zu machen, sie kämen sogleich unter die Bischöfe“. „Nein“, fügte er mit drolliger Ueberzeugung hinzu, „in solchen Städten wird man nie etwas anderes als Dummheiten machen“. Man wird nach diesen Aeusserungen des Mannes in Frankreich, der mehr als irgend ein anderer für eine Reform des höheren Unterrichtswesens gekämpft hat, vielleicht besser verstehen, warum da zu Lande die Gleichgültigkeit der Liberalen Hand in Hand mit dem Eifer der katholischen Geistlichkeit ging, wenn die Rede davon war, jener Unwissenheit der niedrigeren Klassen abzuhelfen, die sich später so gefährlich für die äussere und innere Sicherheit des Landes zeigte. Der alte Philarète Chasles, der doch wahrlich kein Chauvinist war, machte sich eines Abends im Mai 1870 bis zu dem Grad über mein Vertrauen in die wirksame Kraft des gezwungenen Unterrichts lustig, dass er ihn mein Revalenta arabica nannte und behauptete, ich hoffe, durch ihn das Menschengeschlecht für alle Zeiten glücklich zu machen. Auch er fragte mich, ob ich nicht meinte, dass die Bauern ohne Schulmeister hinlänglich gute Familienväter und gute Soldaten seien. Der Krieg lehrte bald diese Männer, dass es eine bis dahin nicht genug beachtete Stärke des Soldaten ist, dass er lesen und schreiben kann. Merkwürdig war es aber, zu sehen, wie Ideen, von denen man versucht war, sie ausschliesslich der katholischen Geistlichkeit zuzuschreiben, wie z. B. diese Idee von der unbedingten Schädlichkeit unvollständiger Kenntnisse, nach und nach eine solche Autorität in einem von dem Katholizismus durchdrungenen Lande gewonnen hatten, dass sie mit einer geringen Formveränderung selbst die ausgesprochensten, entschiedensten Gegner des katholischen Glaubens beherrschten.
Eine andere, ebenso interessante Anwendung der Renan'schen Lehre: dass, was in Deutschland oder im Norden gut sei, nicht desshalb für Frankreich tauge, hörte ich eines Tages – Renan selbst war nicht zugegen – in seinem Landhaus in Sèvres. Das Gespräch fiel auf die französische Convenienzehe. Seine Gattin, eine geborene Deutsche, die Tochter des Malers Henri Scheffer, die jedoch ganz von seinen Ideen durchdrungen war, vertheidigte die französische Weise, auf eine Verabredung zwischen dem Freiwerber und den Eltern hin, nach ganz wenigen pflichtschuldigen Besuchen die Hochzeit zu halten. „Diese Weise die Ehen zu schliessen“, sagte sie, „würde nicht existiren, wenn sie nicht ihren guten Grund hätte. Obwohl in Frankreich erzogen, habe ich, die ich deutsch geboren bin, mich nicht so verheirathet. So oft man mir vorschlug, einen Freier in Augenschein zu nehmen, erklärte ich ihn nicht sehen zu wollen; schon dass er als Freier kam, war genug, um ihn in meinen Augen abscheulich zu machen. Ich habe meinen Mann viele Jahre vor unserer Verheirathung gekannt. Wer kann aber etwas einwenden, wenn man sieht, wie ich es bei so vielen unserer Freunde gesehen habe – sie nannte diesen und jenen – dass man eine Woche vor der Hochzeit einander vorgestellt worden, und dass eine solche Ehe sich glücklich und befriedigend für beide Parteien gestaltet hat!“
Während ich in diesen Worten halbwegs eine Ausflucht sah, um nicht die Verhältnisse naher Freunde beurtheilen zu müssen, halbwegs ein Anzeichen der französischen Eigenschaft, jede Nationaleigenthümlichkeit, wie unglücklich sie auch sei, als unabänderliches Racenmerkmal darstellen zu wollen, legte ein Anwesender, einer der vorurtheilsfreiesten französischen Schriftsteller seine Hand auf den Kopf seiner kleinen Tochter, eines Kindes von zwei Jahren und sagte: „Sie meinen also, ich sollte mein kleines Mädchen dem ersten besten Manne geben, der, ohne sich an uns, ihre Eltern zu wenden, sich ihr Herz erschleichen könnte. Erinnern Sie sich doch, wie gross die Unerfahrenheit eines jungen Mädchens ist, vergessen Sie doch nicht die Beschaffenheit der wirklichen Welt, nicht, welche Schufte es gibt, nicht, welche Vorzeit, welche Krankheiten, welche bestialischen Neigungen ein junger Mann haben kann, Eigenschaften, die das Auge eines Vaters ahnt, deren Anwesenheit aber das unschuldige Gemüth eines jungen Mädchens nicht für denkbar halten kann oder darf. Die Welt ist ein Feind. Sollte ich denn nicht nach Kräften meine kleine Tochter gegen den Feind vertheidigen? Wenn einmal in fünfzehn Jahren sich Freiwerber für sie anmelden, so wollen wir, wenn wir bis dahin am Leben sind, uns solcherweise betragen: wir werden die aussondern, die nicht in Betracht kommen können entweder wegen ihrer bürgerlichen Stellung oder wegen moralischer oder körperlicher Schwächen, wir werden eine Auslese (triage) unternehmen, und erlauben dann im Uebrigen, wie alle Eltern, dem jungen Mädchen, zu wählen, wie es will“. Als Voraussetzung dieser Betrachtungsweise muss man sich der abgesperrten Erziehung der Töchter in dem Kloster oder in der Pension erinnern. Mit dieser – selbst wenn jede Rücksicht auf die grössere Feurigkeit und Sinnlichkeit der romanischen Nationen genommen wird – ungereimten Voraussetzung vor Augen, wird die gezogene Folgerung vielleicht vernünftig.
23
Anatole Leroy-Beaulieu hat später einen wohlgelungenen Versuch gemacht, ihn auf Grund derselben zu charakterisiren. (Un Empereur. 1879.)