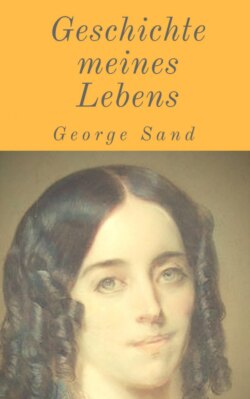Читать книгу Geschichte meines Lebens - George Sand - Страница 70
На сайте Литреса книга снята с продажи.
19. Kapitel. Die Zeit dieser Arbeit. — Mein Signalement. — Naive Ansichten meiner Mutter über die Civil-Ehe und kirchliche Ehe. — Das Mieder der Madame Murat. — Allgemeine Ungnade des Generalstabes. — Herzensqualen. — Mütterliche Diplomatik.
ОглавлениеAlles Vorhergehende ist unter der Regierung Ludwig Philipp's geschrieben. Am 1. Juni 1848 nehme ich die Arbeit wieder auf und bewahre die Erzählung alles dessen, was ich während dieses Zeitraums gesehen und empfunden habe, für eine andere Phase meiner Geschichte auf.
Ich habe viel gelernt, viel erlebt, viel gealtert während dieser kurzen Unterbrechung, und vielleicht trugen diese verspäteten und plötzlichen Erfahrungen über das allgemeine Leben dazu bei, mich die Ideen, die mein ganzes Leben erfüllten, so würdigen zu lehren, wie ich jetzt thue. Ich werde nicht weniger streng gegen mich selbst sein, aber Gott weiß, ob ich noch denselben unbefangenen Glauben, denselben vertrauenden Eifer haben werde, die mich innerlich stützten. Wenn ich mein Buch vor der Revolution beendigt hätte, würde es ein anderes geworden sein, nämlich das eines Einsiedlers, eines großherzigen Kindes, wie ich zu sagen wage, denn ich hatte die Menschheit nur an Individuen studirt, die oft Ausnahmen waren und von mir immer mit Muse beobachtet wurden. Seitdem habe ich, mit den Augen, einen Feldzug in der Welt der Thatsachen mitgemacht und bin nicht so daraus hervorgegangen, wie ich war, als er begonnen wurde. Ich habe dabei die Illusionen der Jugend verloren, die ich, als ein Vorrecht meines zurückgezogenen und beschaulichen Lebens, länger bewahrt hatte, als dies gewöhnlich der Fall ist.
Mein Buch wird also ein trauriges sein, wenn ich unter dem Einflusse des Eindrucks bleibe, den ich in der letzten Zeit empfangen habe. Aber wer weiß? Die Zeit geht schnell und endlich ist die Menschheit nicht anders als ich bin, d. h. sie läßt sich mit großer Leichtigkeit entmuthigen und wieder ermuthigen. Gott behüte mich, wie J. J. Rousseau zu glauben, ich sei besser, als meine Zeitgenossen, und ich hätte das Recht, sie zu verfluchen. Jean Jacques war krank, als er seine Sache von der der Menschheit trennen wollte.
Wir haben Alle in diesem Zeitalter mehr oder weniger von der Krankheit Rousseau's gelitten — wir wollen uns bemühen mit Gottes Hülfe zu genesen.
Ich kam also am 5. Juli 1804 zur Welt, während mein Vater die Violine spielte und meine Mutter ein hübsches rosa Kleid trug, und hatte wenigstens den Theil des Glückes, das meine Tante Lucie mir prophezeite, daß ich meiner Mutter keine langen Leiden bereitete. Ich wurde als legitime Tochter geboren, das würde aber nicht geschehen sein, hätte mein Vater die Vorurtheile seiner Familie nicht so entschlossen bei Seite geworfen. Es war ein Glück für mich, ohne das sich meine Großmutter vielleicht meiner nicht so liebevoll angenommen hätte, wie sie später that, und ich würde dann eines kleinen Schatzes von Ideen und Kenntnissen beraubt worden sein, der mein Trost in den Schmerzen des Lebens gewesen ist.
Ich war von starker Constitution und versprach während meiner ganzen Kindheit sehr schön zu werden — ein Versprechen, das ich durchaus nicht gehalten habe. Vielleicht ist es meine Schuld, denn in dem Alter, wo die Schönheit erblüht, verbrachte ich meine Nächte schon mit Lesen und Schreiben. Als Tochter zweier vollkommen schöner Menschen hätte ich nicht ausarten sollen, und meine arme Mutter, die Schönheit höher schätzte, als alles Andere, machte mir oft naive Vorwürfe darüber. Ich meinestheils habe mich niemals entschließen können, große Sorgfalt auf meine Person zu verwenden. Ebenso sehr wie ich die äußerste Reinlichkeit liebe, ebenso sehr scheint mir eine gesuchte Weichlichkeit unerträglich. Der Arbeit zu entsagen, um ein klares Auge zu haben; sich nicht dem Sonnenschein auszusetzen, wenn Gottes schöne Sonne uns unwiderstehlich anzieht; nicht in guten, großen Holzschuhen zu gehen, aus Furcht, die Form der Füße zu verderben; Handschuhe zu tragen, d. h. auf die Geschicklichkeit und Kraft seiner Hände zu verzichten, sich zu einem ewig linkischen Wesen, zu einer ewigen Schwäche zu verurtheilen; sich niemals anzustrengen, wenn doch Alles uns auffordert, uns nicht zu schonen; mit einem Worte: unter einer Glocke zu leben, um nicht von der Sonne gebräunt zu werden, nicht rauhe Haut zu haben und vor der Zeit zu welken — das ist mir nie möglich gewesen. — Meine Großmutter verschärfte noch die Verweise meiner Mutter und das Kapitel der Hüte und Handschuhe war die Verzweiflung meiner Kindheit, aber obgleich ich nicht gern widerspenstig war, konnte mich der Zwang doch nicht beugen. — Ich bin nur einen Augenblick frisch und niemals schön gewesen. Meine Züge sind ziemlich regelmäßig, aber ich dachte nie daran, ihnen den geringsten Ausdruck zu geben. Die Gewohnheit einer Träumerei, von der ich mir selbst nicht Rechenschaft ablegen könnte, die mir aber fast schon in der Wiege eigen war, gab mir frühzeitig ein „einfältiges“ Ansehen. Ich sage das Wort gerade heraus, denn mein ganzes Lebenlang: während meiner Kindheit, im Kloster, im Schooße meiner Familie hat man es mir gesagt, und so muß es wohl wahr sein.
Im Ganzen war ich in meiner Jugend, mit meinen Haaren, Augen und Zähnen und ohne irgend eine Verunstaltung, weder häßlich noch schön zu nennen — ein Vortheil, der nach meiner Ansicht sehr wichtig ist; denn die Häßlichkeit stößt Vorurtheile in dem einen Sinne ein, die Schönheit in einem andern. Von einem glänzenden Aeußern erwartet man zuviel, einem abstoßenden mißtraut man zu sehr. Es ist besser ein gutes Gesicht sein eigen zu nennen, das Niemand blendet und Niemand erschreckt — und ich habe mich dabei mit meinen Freunden beider Geschlechter immer wohl befunden.
Ich habe von meinem Gesichte gesprochen, um damit nun fertig zu sein. In der Geschichte eines Frauenlebens droht dieses Kapitel sich unendlich in die Länge zu ziehen und könnte den Leser erschrecken. Ich habe mich dem Gebrauche gefügt, das Aeußere der Personen zu beschreiben, die man auftreten läßt, und that es gleich bei den ersten Worten, die mich selbst betreffen, um mich dadurch dieser Kinderei völlig und für die ganze Folge meiner Erzählung zu entledigen. Vielleicht hätte ich mich auch gar nicht darauf einlassen sollen, aber ich richtete mich nach der herrschenden Sitte und fand, daß selbst sehr ernste Männer nicht glaubten, sich dieser entziehen zu dürfen — es würde also vielleicht den Anschein einer Anmaßung gehabt haben, wenn ich der, oft ein wenig einfältigen Neugier des Lesers die kleine Schuld nicht bezahlt hätte.
Indessen wünsche ich, daß man sich in Zukunft von dieser Anforderung der Neugierigen frei macht, und daß man, wenn man durchaus gezwungen ist, sein Portrait zu entwerfen, sich damit begnügt, das Signalement seines Reisepasses zu copiren, welches, durch den Polizei-Commissär des Bezirkes ausgestellt, in seinem Style weder etwas Emphatisches noch Compromittirendes hat. Hier ist das meinige: Augen schwarz, Haare schwarz, Stirn gewöhnlich, Gesichtsfarbe blaß, Nase wohlgeformt, Kinn rund, Mund mittel, Größe vier Fuß zehn Zoll. Besondere Kennzeichen, keine.
Aber gerade bei dieser Gelegenheit muß ich einen seltsamen Umstand erwähnen, nämlich, daß ich erst seit zwei oder drei Jahren gewiß weiß, wer ich bin. Ich weiß nicht, welche Gründe oder welche Einbildungen mehrere Personen — die behaupteten, bei meiner Geburt gegenwärtig gewesen zu sein — veranlaßten mir zu sagen, man habe mir nicht mein wirkliches Alter beigelegt, und zwar aus Gründen, die sich bei einer heimlichen Ehe leicht errathen lassen. Nach dieser Lesart würde ich 1802 oder 1803 in Madrid geboren sein, und der Geburtsschein mit meinem Namen wäre also der eines andern seitdem geborenen und kurz nachher wieder verstorbenen Kindes. Und diese Erzählung, mit der man mich irre führte, war nicht so unwahrscheinlich, als man glauben könnte, da die Register zu jener Zeit noch nicht mit der strengen Pünktlichkeit geführt wurden, die sie jetzt durch die neue Gesetzgebung erhalten haben, und da bei der Heirath meines Vaters in Wahrheit eigenthümliche Unregelmäßigkeiten vorgekommen waren, die jetzt unmöglich noch vorkommen könnten und von denen ich bald sprechen werde. Als man mir die Entdeckung machte, fügte man hinzu, daß meine Verwandten mir die Wahrheit über diesen Punkt nicht sagen würden — ich vermied deshalb sie zu fragen und blieb in dem Glauben, daß ich in Madrid geboren und ein oder zwei Jahr älter sei, als man angenommen hatte. Zu jener Zeit las ich die Correspondenz meines Vaters mit meiner Großmutter in Eile durch, und ein unrichtig datirter und irriger Weise der Sammlung von 1803 beigefügter Brief bestärkte mich in meinem Irrthume. Dieser Brief, den man an seinem richtigen Platze finden wird, machte mich nicht mehr irre, als ich die Correspondenz, um sie zu übertragen, einer genaueren Prüfung unterwarf; und endlich erhielt ich Gewißheit über meine Identität durch den Zusammenhang von Briefen, die ich bis dahin nicht geordnet und nicht gelesen hatte, die ohne Interesse für den Leser, aber von großer Wichtigkeit für mich sind, da sie diesen Punkt feststellen. Ich bin also wirklich zu Paris am 5. Juli 1804 geboren, ich bin mit einem Worte ich selbst, und das ist mir sehr angenehm, denn es hat immer etwas Störendes, in Zweifel über seinen Namen, sein Alter und sein Vaterland zu sein. Länger als zehn Jahre habe ich diese Zweifel ertragen, ohne zu wissen, daß sich in einem alten, noch nicht untersuchten Schranke die Mittel befanden, sie gänzlich zu zerstreuen. Es ist wahr, daß ich in dieser Sache die Unthätigkeit zeigte, die mir in allen mich persönlich betreffenden Angelegenheiten eigen ist, und ich hätte wohl sterben können, ohne zu wissen, ob ich in eigener Person oder an der Stelle einer andern gelebt habe, wenn mir nicht die Idee gekommen wäre, über mein Leben zu schreiben und zu diesem Zwecke seinen Anfang zu ergründen.
Mein Vater hatte sich in Boulogne-sur-Mer aufbieten lassen und schloß die Heirath in Paris ohne Vorwissen seiner Mutter. Dies würde jetzt nicht möglich sein, aber damals war es möglich, Dank der Unordnung und Unsicherheit, welche die Revolution in alle Verhältnisse gebracht hatte. Das neue Gesetzbuch ließ noch einige Möglichkeit die Einwilligung der Eltern zu umgehen, und der Fall der „Abwesenheit“ war in Folge der Emigration leicht unterzuschieben und wurde oft gebraucht. Es war damals ein Moment des Ueberganges von der alten Gesellschaft zur neuen, und das Räderwerk der letzteren wollte noch nicht recht in den Gang kommen. — Weitere Einzelheiten will ich nicht angeben, obgleich mir die betreffenden Papiere vorliegen, um den Leser nicht mit trockenen Rechtsfragen zu langweilen. Gewiß ist, daß man einige Formalitäten, die jetzt unentbehrlich wären, die man damals aber nicht für unbedingt nöthig hielt, gar nicht oder nur ungenügend erfüllt hatte.
Meine Mutter war ein lebendiges Beispiel dieser Uebergangsperiode. Alles, was sie von dem Civil-Akte ihrer Heirath begriffen hatte, war, daß er die Legitimität meiner Geburt sicherte.
Sie war fromm und blieb es immer, ohne sich der Frömmelei zu ergeben — und was sie als Kind geglaubt hatte, glaubte sie so lange sie lebte, aber sie kümmerte sich nicht um die bürgerlichen Gesetze und dachte nicht daran, daß ein Akt des Municipal-Beamten ein Sakrament ersetzen könnte. Sie machte sich also auch keine großen Skrupel wegen der Unregelmäßigkeiten, welche die Schließung der Civil-Ehe erleichterten, aber sie trieb dieselben soweit, als es sich um die kirchliche Trauung handelte, daß meine Großmutter derselben, trotz ihrer Abneigung, beiwohnen mußte. Aber das fand später statt, wie ich erzählen werde.
Bis dahin hielt sich meine Mutter nicht für die Mitschuldige einer rebellischen Handlung gegen die Mutter ihres Mannes, und wenn man ihr sagte, Madame Dupin sei sehr aufgebracht gegen sie, so pflegte sie zu antworten:
„— Wirklich, das ist sehr ungerecht — sie kennt mich noch nicht; sagen Sie ihr doch, daß ich mich, ohne ihre Einwilligung, nicht mit ihrem Sohne in der Kirche trauen lassen werde.“
Mein Vater sah wohl, daß er dieses naive und zugleich achtungswerthe Vorurtheil niemals besiegen würde, das im Grunde auf wahrem Glauben beruhte, denn wenn man Gott nicht leugnet, muß man auch wünschen, daß der Gedanke an ihn eine heilige Handlung begleite, wie die Schließung eines Ehebundes ist. Er wünschte dringend den seinigen durch die Kirche weihen zu lassen, denn bis dahin fürchtete er noch immer, daß Sophie sich nicht durch ihr Gewissen gebunden halten und Alles wieder in Frage ziehen würde. Er zweifelte nicht an ihr — er konnte nicht an ihrer Zuneigung und Treue zweifeln, aber sie hatte Anfälle eines entsetzlichen Stolzes, wenn er sie den Widerstand seiner Mutter merken ließ. Sie sprach dann von nichts Geringerem, als fort zu gehen und mit ihren Kindern von ihrer Hände Arbeit zu leben, um zu beweisen, daß sie weder Almosen noch Verzeihung von dieser hochmüthigen „großen Dame“ verlange, von der sie sich einen sehr falschen und schrecklichen Begriff machte.
Wenn Moritz sie überreden wollte, daß ihre Ehe unauflöslich sei und daß seine Mutter früher oder später doch ihre Einwilligung geben würde, entgegnete sie: „O nein, Euere Civil-Ehe hat nichts zu bedeuten, denn sie läßt die Scheidung zu, welche die Kirche nicht erlaubt, also sind wir nicht verheirathet und Deine Mutter hat mir nichts vorzuwerfen. Es genügt mir, Das Schicksal meiner Tochter (ich war damals schon geboren) gesichert zu sehen — für mich verlange ich nichts von Dir; und habe vor Niemand zu erröthen.“
Die Gesellschaft stimmte mit diesem einfachen und kräftigen Raisonnement nicht überein, das ist wahr, und sie würde jetzt, wo sie auf ihrer neuen Basis feststeht, noch weniger damit übereinstimmen, aber zu der Zeit, in der diese Dinge vorgingen, hatte man schon so viele Erschütterungen und so viel Unglaubliches gesehen, daß man nicht gewiß wußte, auf welches Terrain man den Fuß setzte. Meine Mutter hatte die Meinung des Volkes über alles das. Sie beurtheilte weder die Ursachen noch die Folgen der neuen Grundlage der revolutionären Gesellschaft. „Alles wird sich noch ändern ,“ sagte sie. „Ich habe Zeiten erlebt, wo es keine andere als die durch die Kirche geschlossene Ehe gab — plötzlich behauptete man, diese tauge nichts und solle nicht mehr gelten, und man erfand dann eine andere, die nicht bestehen wird und auf die man nichts geben kann.“
Sie hat bestanden, aber sie ist wesentlich verändert worden. Die Ehe-Scheidung ist erlaubt gewesen, dann abgeschafft worden und jetzt spricht man davon, sie wieder einzusetzen. [Ich schreibe das am 2. Juni 1848 und weiß noch nicht, wie die Lösung des Projektes sein wird, welches der National-Versammlung durch den Minister Crémieux vorgelegt ist.] Man hätte keinen ungünstigeren Moment zur Besprechung einer so ernsten Frage wählen können, und obgleich ich über diesen Punkt zu festen Ansichten gekommen bin, würde ich doch, wenn ich bei der National-Versammlung wäre, verlangen, daß man zur Tagesordnung überginge. Man kann das Schicksal und die Religion der Familie nicht in einem Augenblicke ordnen, wo die Gesellschaft sich in einem Zustande moralischer Verwirrung, um nicht zu sagen Anarchie, befindet. Und dann, wenn man die Frage zur Verhandlung bringt, werden die kirchlichen und bürgerlichen Ideen auf's Neue in Streit gerathen, statt nach der Einheit zu streben, ohne die das Gesetz keinen Sinn hat und seinen Zweck nicht erreicht. Wird die Ehe-Scheidung verworfen, so heiligt man einen Zustand der Dinge, welcher der öffentlichen Moral widerstrebt — wird sie angenommen, so wird dies in einer Weise und unter Umständen geschehen, daß sie die Moral nicht fördert und den religiösen Bund der Familie nur noch mehr lockert. Ich werde meine Ansicht aussprechen, wenn es nöthig ist, und kehre jetzt zu meiner Geschichte zurück.
Als ich geboren wurde, zählte mein Vater sechsundzwanzig, meine Mutter dreißig Jahre. Meine Mutter hatte niemals Jean Jacques Rousseau gelesen, hatte vielleicht auch nicht viel von ihm sprechen hören, das hielt sie aber nicht ab, meine Amme zu sein, wie sie die aller ihrer andern Kinder wurde. Aber um Ordnung in die Folge meiner eignen Geschichte zu bringen, muß ich die meines Vaters verfolgen, dessen Briefe mir als Wegweiser dienen, denn man kann sich leicht denken, daß meine eignen Erinnerungen sich nicht bis zum Jahre XII zurückerstrecken.
Mein Vater brachte, wie ich schon früher mittheilte, nach seiner Verheirathung vierzehn Tage in Nohant zu, ohne daß es ihm möglich war, seiner Mutter das Geständniß zu machen. Er kehrte unter dem Vorwande, sich um das ewige Hauptmannspatent, das nicht ankommen wollte, zu bemühen, nach Paris zurück und fand alle seine Bekannten und Verwandten von der neuen Monarchie sehr wohl aufgenommen. Caulaincourt war Oberstallmeister des Kaisers; der General von Harville Oberstallmeister der Kaiserin Josephine; der gute Neffe René Kammerherr des Prinzen Louis; seine Frau Gesellschaftsdame der Prinzessin u.s.w. Die letztere überreichte Madame Murat einen Bericht über die Dienste meines Vaters, den Mad. Murat in ihr Mieder steckte. Mein Vater schrieb darüber am 12. prairial im Jahre XII: „Die Zeiten sind wiedergekommen, wo die Damen über Rang und Würden verfügen und wo das Mieder einer Prinzessin mehr verspricht, als das Schlachtfeld. Mag es sein! Ich hoffe, mich von diesem Mieder rein zu waschen, wenn es wieder Krieg giebt und meinem Vaterlande für das zu danken, was es mich auf eine unrechte Weise zu erlangen zwingt.“ Dann fährt er, auf seine persönlichen Unannehmlichkeiten kommend, fort: „Man bringt mir in diesem Augenblicke einen Brief von Dir, meine gute Mutter, durch den Du mich betrübst, indem Du Dich betrübst. Du behauptest, ich sei, als ich bei Dir war, sorgenvoll gewesen und habe mir Worte der Ungeduld entschlüpfen lassen. Aber habe ich denn je auch nur in Gedanken ein solches Wort an Dich gerichtet? Ich würde lieber sterben, als dies thun. — Du weißt wohl, daß diese Worte nur die Entgegnung auf Deschartres' verletzende und unzeitige Predigten waren. Niemals noch, wenn ich bei Dir gewesen bin, habe ich mit Ungeduld nach dem Tage verlangt, der mich von Dir entfernen sollte. Ach, wie grausam dies Alles ist — wie ich dabei leide! Ich kehre bald zu Dir zurück, um Dich nach Beweisgründen für Deinen Brief zu fragen, böse Mutter, die ich so sehr liebe!“
Am 12. messidor wurde ich geboren, meine Großmutter wußte nichts davon. Am 16. schrieb ihr mein Vater über ganz andere Dinge.