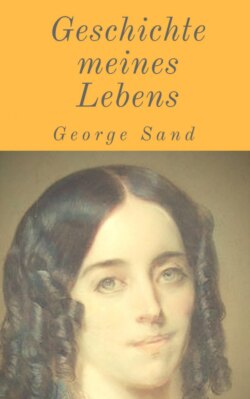Читать книгу Geschichte meines Lebens - George Sand - Страница 82
На сайте Литреса книга снята с продажи.
22. Kapitel. Die ersten Erinnerungen. — Die ersten Gebete. — Das silberne Ei der Kinder. — Der Vater Noël. — Das System J. J. Rousseau's. — Das Lorbeergehölz. — Polichinelle und die Straßenlaterne. — Die Romane zwischen vier Stühlen. — Militärische Spiele. — Chaillot. — Clotilde. — Der Kaiser. — Die Schmetterlinge und der Sohn der Jungfrau. — Der König von Rom. — Das Flaschenet. —
ОглавлениеMan muß wohl glauben, daß das Leben an und für sich etwas Schönes ist, da der Beginn desselben so lieblich und die Jugend eine so glückliche Zeit ist. Es giebt Keinen unter uns, dem diese Zeit nicht wie ein goldner, längst entschwundener Traum erschiene, mit dem Nichts im späteren Leben sich vergleichen läßt. Ich sage ein Traum, denn wenn wir in diese ersten Lebensjahre zurückdenken, wo unsere Erinnerung noch unbestimmt umherschweift und nur einzelne Eindrücke aus der Unsicherheit des Ganzen in uns zurückbleiben, so wissen wir nicht zu sagen, warum diese Lichtblicke, die Andern unbedeutend erscheinen, auf uns selbst einen so mächtigen Zauber ausüben.
Das Gedächtniß ist eine Fähigkeit, die sich bei jedem andern Individuum anders zeigt, und die, da sie bei Keinem vollständig ist, tausend Inconsequenzen hat. Bei mir, wie bei vielen andern Menschen ist sie in gewisser Beziehung außerordentlich entwickelt und in anderer außergewöhnlich schwach. Ich erinnere mich nur mit Anstrengung der kleinen Begebenheiten vom vergangenen Tage und den größten Theil der Einzelnheiten vergesse ich für immer — aber wenn ich den Blick weiter zurückwende, so finde ich Erinnerungen an ein Alter, in das die meisten Menschen nicht zurückzudenken vermögen. Hängt dies nun nothwendig von der Natur dieser Fähigkeiten in mir ab, oder von einer gewissen Frühreife des Selbstbewußtseins?
Vielleicht sind wir Alle in dieser Beziehung gleichmäßig begabt und vielleicht behalten wir eine klare oder dunkle Vorstellung der vergangenen Dinge nur im Verhältniß der größern oder geringern Erregung, die sie uns verursacht haben. Gewisse innere Vorgänge machen uns oft gleichgültig gegen Ereignisse, welche die Welt um uns her erschüttern. Es geschieht auch wohl, daß wir uns dessen, was wir schlecht begriffen haben, nur undeutlich erinnern und vielleicht ist das Vergessene nur eine Folge des Nichtbegreifens und der Unachtsamkeit.
Das mag nun sein, wie es will, meine erste Erinnerung, die ich hier mittheilen werde, schreibt sich aus dem frühesten Lebensalter her. Als ich zwei Jahr alt war, ließ mich meine Wärterin aus ihren Armen auf eine Kaminecke fallen; ich erschrak und verwundete mich an der Stirne. Dieser Stoß, diese Erschütterung des Nervensystems erweckte meinen Geist zum Gefühl des Lebens. Ich sah ganz deutlich und sehe noch den röthlichen Marmor des Kamins, mein dahinfließendes Blut und das verwirrte Gesicht meiner Wärterin. Ich erinnere mich eben so deutlich an den Besuch des Arztes, an die Blutigel, die man mir hinter das Ohr setzte, an die Unruhe meiner Mutter und an das Weggehen der Wärterin, die wegen Trunksucht verabschiedet wurde. Wir verließen das Haus; ich weiß nicht, wo es lag und bin nie dahin zurückgekehrt, aber wenn es noch existirt, so glaube ich, daß ich mich darin noch zurechtfinden würde.
Es ist daher gar nicht zu verwundern, daß ich mich der Wohnung, die wir ein Jahr später in der rue Grange-Batelière bewohnten, vollkommen erinnere. Von dort her datiren sich meine klaren und fast ununterbrochenen Erinnerungen. Aber von dem Unfall am Kamin bis zum Alter von drei Jahren kann ich mir nur eine unzählige Menge von Stunden zurückrufen, die ich schlaflos in meiner Wiege zubrachte und mit der Betrachtung einer Vorhangsfalte oder einer Tapetenblume ausfüllte.
Ich erinnere mich auch, daß die Bewegungen und das Summen der Fliegen mich viel beschäftigten, und daß ich die Gegenstände oft doppelt sah — ein Umstand, den ich nicht zu erklären vermag, dessen sich aber, wie mir gesagt ist, viele Menschen aus ihrer ersten Jugend erinnern. Vor Allem nahm die Flamme der Kerzen in meinen Augen diese Gestalt an und ich wußte, daß es eine Illusion war, konnte mich dem Eindrucke derselben jedoch nicht entziehen. Es scheint mir sogar, als hätten diese Einbildungen zu den einförmigen Unterhaltungen meiner Gefangenschaft in der Wiege gehört und dies Leben in der Wiege zeigt sich mir als ein außerordentlich langes und von einer sanften Eintönigkeit erfüllt.
Meine Mutter arbeitete früh an meiner Entwickelung, und wenn mein Gehirn auch keinen Widerstand leistete, so war es doch auch in keiner Weise voraus und hätte sich vielleicht erst spät thätig bewiesen, wäre man ihm nicht zu Hülfe gekommen. Gehen konnte ich, als ich zehn Monate alt war; sprechen lernte ich ziemlich spät, aber als ich angefangen hatte, einige Worte zu sagen, lernte ich die andern sehr schnell und mit vier Jahren las ich, sowie meine Cousine Clotilde; wir Beide waren wechselsweise durch unsre Mütter unterrichtet. Man lehrte uns auch Gebete und ich erinnere mich, daß ich sie ohne Anstoß von einem Ende zum andern hersagte, aber nicht das Geringste davon verstand — ausgenommen die ersten Worte des letzten Gebetes, das wir hersagen mußten, wenn wir, wie das oft geschah, unsere Köpfe auf ein Kissen legten. Es begann: Mein Gott, ich gebe dir mein Herz! Ich weiß nicht, warum ich dies besser als alles Andere verstand, denn es ist viel Metaphysik in diesen wenigen Worten; aber gewiß ist, daß ich es verstand, und daß es die einzige Stelle in meinen Gebeten war, bei welcher ich an Gott dachte und an mich selbst. Das Vater unser, den Glauben und das Ave Maria konnte ich sehr gut auf französisch, mit Ausnahme der Bitte: gieb uns heute unser täglich Brod! — aber wenn ich diese Gebete wie ein Papagei lateinisch hergeplappert hätte, würden sie nicht unverständlicher für mich gewesen sein.
Man ließ uns auch La Fontaine's Fabeln lernen; aber als ich sie fast alle konnte, waren sie mir noch immer ein verschlossenes Buch. Ich glaube, ich war es so müde, sie herzusagen, daß ich darum mein Möglichstes that, um sie recht spät zu verstehen und erst im Alter von 15 oder 16 Jahren wurde mir ihre Schönheit klar.
Man hatte sonst die Gewohnheit, das Gedächtniß der Kinder mit einer Unmasse von Schätzen anzufüllen, die über ihrem Begriffsvermögen stehen. Die kleine Anstrengung, die man ihnen dadurch verursacht, tadle ich nicht; Rousseau, der dieselbe in seinem „Emile“ ganz verwirft, setzt das Gehirn seines Zöglings der Gefahr aus, in Unthätigkeit so zu verdummen, daß es die Dinge, die für sein späteres Alter aufbewahrt sind, nicht mehr zu lernen vermag. Es ist gut, die Kindheit so früh als möglich an eine mäßige, aber tägliche Uebung der Geistesgaben zu gewöhnen; man beeilt sich nur zu sehr, ihnen köstliche Dinge darzubieten.
Es giebt keine Literatur zum Gebrauch für kleine Kinder, alle die hübschen Gedichte, die man ihnen zu Ehren gemacht hat, sind geziert und mit Worten überladen, die nicht aus ihrem Wörterbuche stammen. Die ersten Verse, die ich gehört habe, sind folgende, die wahrscheinlich Jedermann bekannt sind und mir meine Mutter mit der frischesten und sanftesten Stimme vorsang:
„Wir wollen in die Scheune geh'n,
Um das weiße Huhn zu seh'n;
Es legt ein Ei von Silber fein,
Das soll für unser Kindchen sein.“
Der Reim ist nicht eben reich; aber darauf kam es mir nicht an und das weiße Huhn, das silberne Ei, das man mir jeden Abend versprach und nach dem ich Morgens schon nicht mehr verlangte, machte auf mich den lebhaftesten Eindruck. Das Versprechen kam immer wieder und mit demselben die naive Erwartung. Freund Leclair, erinnerst Du Dich daran? auch Dir hat man jahrelang dies wunderbare Ei versprochen; es erweckte nicht Deine Habsucht, aber es erschien Dir als ein poetisches, anmuthiges Geschenk des guten Huhnes. Und wenn man Dir das silberne Ei gegeben hätte, was hättest Du damit gemacht? — Deine schwachen Hände hätten es nicht zu halten vermocht und Dein unstäter, wechselnder Sinn wäre dieses dummen Spielzeugs bald müde geworden. Was liegt an einem Ei, was liegt an einem Spielzeuge, das nie zerbricht? Aber die Einbildungskraft macht Etwas aus Nichts und die Geschichte dieses silbernen Eis ist vielleicht die aller materiellen Güter, deren Besitz unsere Begierde reizt. Der Wunsch ist viel, der Besitz ist sehr wenig.
Am Vorabend des Weihnachtsfestes sang mir meine Mutter ein ähnliches Lied vor; da dies jährlich aber nur einmal geschah, kann ich mich nicht mehr darauf besinnen. Desto deutlicher erinnere ich mich meines festen Glaubens an den Vater Noël, der als ein kleiner Greis mit weißem Barte erschien, durch den Schornstein in's Kamin hinunterstieg und um die Mitternachtsstunde ein Geschenk in meinen kleinen Schuh legte, das ich dann beim Erwachen fand. Mitternacht! diese phantastische Stunde, welche die Kinder nicht kennen, und die man ihnen als das unerreichbare Ziel ihres Wachens zeigt! welche unglaublichen Anstrengungen habe ich gemacht, um nicht vor der Ankunft des guten Alten einzuschlafen! ich hatte zugleich das größte Verlangen und die größte Angst, ihn zu sehen; aber es gelang mir nie, mich bis dahin wach zu erhalten, und am folgenden Morgen war mein erster Blick für den Schuh am Rande des Kamins. Welche Bewegung verursachte mir die Umhüllung von weißem Papiere! denn der Vater Noël war von außerordentlicher Reinlichkeit und versäumte nie, seine Gabe sorgsam einzuwickeln. Ich lief barfuß hin, um mich meines Schatzes zu bemächtigen; es war niemals ein sehr kostbares Geschenk, denn wir waren nicht reich. Es war nur ein kleiner Kuchen, oder eine Orange, oder ganz einfach ein schöner rother Apfel. Aber das erschien mir so köstlich, daß ich es kaum zu essen wagte. Die Einbildungskraft spielte auch hierbei ihre Rolle — sie ist das ganze Leben des Kindes.
Ich kann Rousseau, der alles Wunderbare als Lüge verwirft, durchaus nicht beistimmen. Die Vernunft und der Unglauben kommen früh genug und von selbst; ich erinnere mich genau des Jahres, als ich zuerst an der Existenz des Vaters Noël zu zweifeln begann. Ich war fünf oder sechs Jahr alt und dachte: es möchte wohl meine Mutter sein, die den Kuchen in meinen Schuh legte. Darum erschien er mir aber auch weniger schön und weniger wohlschmeckend, als die andern Male und ich fühlte eine Art von Bedauern, daß ich nicht mehr an den guten Alten mit weißem Barte glauben konnte. Ich habe meinen Sohn länger daran glauben sehen, denn Knaben sind einfältiger als Mädchen. Er machte, ebenso wie ich, große Anstrengungen, um bis Mitternacht wach zu bleiben; das mißlang ihm ebenso wie mir, aber am folgenden Morgen fand er, wie ich, den wunderbaren Kuchen, der in den Küchen des Paradieses gebacken ist. Aber auch für ihn war das erste Jahr des Zweifels das letzte, wo der gute Alte erschien. Man muß den Kindern die Speisen vorsetzen, deren sie gerade bedürfen und muß ihrem Alter nicht voraneilen, so lange ihnen das Wunderbare zusagt, muß man es ihnen geben; aber sobald sie anfangen, desselben überdrüssig zu werden, muß man sich wohl hüten, den Irrthum zu verlängern und den natürlichen Fortschritt ihrer Vernunft zu hemmen.
Das Wunderbare aus dem Leben des Kindes streichen, ist ein Eingriff in die Gesetze der Natur. Ist nicht die Kindheit selbst ein geheimnißvoller Zustand des Menschen und voll unerklärter Wunder? Woher kommt das Kind? Hat es nicht vielleicht, ehe es im Mutterschooße seine Gestalt gewann, im unergründlichen Schooße der Gottheit irgend ein Dasein gehabt? Entstammt das Theilchen Leben, das es erfüllt, nicht jener unbekannten Welt, in die es zurückkehren soll? Die rasche Entwickelung der Seele in unsern ersten Jahren; der wunderbare Uebergang aus einem chaotischen Zustande in ein verständiges und geselliges Dasein; die ersten Sprachbegriffe, die unbegreifliche Thätigkeit des Geistes, welcher lernt, nicht allein den äußern Dingen, sondern auch dem Thun, dem Gedanken, dem Gefühl einen Namen zu geben — dies Alles gehört zu den Wundern des Lebens und ich wüßte nicht, daß sie irgend Jemand erklärt hätte. Ueber das erste Zeitwort, das ich von kleinen Kindern aussprechen hörte, bin ich immer ganz erstaunt gewesen. Ich begreife, wie sie das Hauptwort lernen — aber die Zeitworte, und besonders die, welche Neigungen ausdrücken, sind etwas Wunderbares. Wenn das Kind seiner Mutter z. B. zum ersten Male sagen kann, daß es sie liebt, ist das nicht, als ob es eine höhere Eingebung empfangen und ausgedrückt hätte? Die äußere Welt, in welcher sich dieser arbeitende Geist bewegt, kann ihm noch keinen deutlichen Begriff von den Regungen der Seele gegeben haben. Er hat bis dahin nur in seinen Bedürfnissen gelebt und das Erwachen seines Verständnisses ist nur durch die Sinne vor sich gegangen. Das Kind will sehen, greifen, schmecken und alle äußern Gegenstände, deren Gebrauch es zum größten Theile nicht kennt, von deren Ursache und Wirkung es nichts weiß, müssen Anfangs wie eine räthselhafte Erscheinung an ihm vorübergehen. Hier beginnt nun die innere Verarbeitung: die Einbildungskraft erfüllt sich mit diesen Gegenständen; das Kind träumt im Schlafe; es träumt wahrscheinlich auch, wenn es nicht schläft, wenigstens kennt es während einer langen Zeit den Unterschied des schlafenden und wachenden Zustandes nicht. Wer kann sagen, warum es durch einen neuen Gegenstand erschreckt oder erheitert wird? Wodurch empfängt es den unbestimmten Begriff des Schönen und des Häßlichen? Durch eine Blume, durch einen kleinen Vogel wird es niemals erschreckt; eine mißgestaltete Maske, ein lärmendes Thier flößen ihm Furcht ein. Indem seine Sinne durch diese Gegenstände der Zuneigung oder des Widerwillens berührt werden, muß sich also seinem Begriffsvermögen eine Vorstellung des Vertrauens oder des Schreckens offenbaren, die ihm nicht beigebracht werden konnte, denn diese Anziehung und dies Abstoßen zeigt sich schon bei einem Kinde, das die Sprache noch nicht versteht. Es liegt also etwas in ihm, das allen Begriffen der Erziehung vorangeht und dies Etwas ist das Geheimniß, das mit dem Urquell des Menschenlebens im Zusammenhange steht.
Das Kind lebt natürlicherweise in einer, so zu sagen, überirdischen Umgebung; während Alles in ihm selbst wunderbar ist, muß ihm auf den ersten Blick Alles rings umher ebenso wunderbar erscheinen. Man erzeigt ihm keine Wohlthat, indem man sich bemüht, ihm ohne Schonung und Auswahl den Werth aller Dinge zu offenbaren. Es ist besser, wenn es selbst danach sucht, und wenn es sich in dem ersten Abschnitt seines Lebens auf eigene Weise einrichtet; denn anstatt seines unschuldigen Irrthums würden ihm unsere Erklärungen, die es nicht zu fassen vermöchte, nur andere Irrthümer geben, die vielleicht noch größer und für die spätere Klarheit seines Unheils, also für die Sittlichkeit seiner Seele auf immer verderblich wären.
Man mag daher noch so lange suchen, welchen Begriff der Gottheit man den Kindern geben könnte — es wird sich kein besserer finden lassen, als der jenes guten, alten Gottes, der im Himmel ist, und der Alles sieht, was auf Erden vorgeht. Später wird es Zeit sein, ihm begreiflich zu machen, daß Gott das unendliche Wesen ist, ohne Götzengestalt, und daß der Himmel nicht mehr in der blauen Wölbung, die uns umgiebt, zu suchen ist, als auf der Erde, die wir bewohnen und im Heiligthum unserer Gedanken. Aber warum sollten wir das Kind, für das jedes Symbol eine Wirklichkeit ist, auf das Symbolische hinweisen? Der unendliche Aether, der Abgrund der Schöpfung, der Himmel, in welchem die Welten kreisen, erscheint dem Auge des Kindes viel schöner und größer, als er durch unsre Erklärungen für seine Begriffe werden könnte, und wir würden das Kind mehr verwirren, als aufklären, wenn wir ihm die Maschinerie des Weltalls erklären wollten, so lange ihm das Gefühl von der Schönheit des Weltalls genügt.
Ist nicht das Leben des Individuums ein Abbild des allgemeinen Lebens? Wer die Entwickelungen des Kindes beobachtet, den Uebergang zur Jugend, zum Mannesalter und alle Umwandlungen bis zu den reifern Jahren, überblickt zugleich eine kurze Geschichte des Menschengeschlechts, das auch seine Kindheit, seine Jugend und sein Mannesalter gehabt hat. Versetzen wir uns in die Urzeiten der Menschheit zurück, so sehen wir alle Völker dem Wunderbaren huldigen; die Geschichte, die entstehenden Wissenschaften. die Philosophie und die Religion werden durch Symbole ausgedrückt, durch Räthsel, welche die moderne Vernunft löst oder erklärt. Die relative Wahrheit und Wirklichkeit der ersten Zeiten liegt in der Poesie, in der Fabel sogar. Es ist also ein ewiges Gesetz, daß der Mensch eine wirkliche Kindheit habe, wie das Menschengeschlecht die ihrige gehabt hat, und wie sie jetzt noch die Völkerschaften besitzen, die nur leicht durch unsere Civilisation berührt sind. Der Wilde lebt im Wunderbaren; er ist weder blödsinnig, noch verrückt, noch thierisch, er ist ein Dichter und ein Kind; er äußert sich nur durch Dichtungen und Gesänge, wie unsere Vorfahren, denen ebenfalls der Vers natürlicher zu sein schien, als die Prosa, der Gesang natürlicher als die Rede. Die Kindheit ist also das Alter der Lieder; man kann ihr deren nicht zu viele geben; so ist auch die Fabel, die nur ein Symbol ist, die beste Form, um im Kinde das Gefühl des Poetischen zu wecken, das wiederum die erste Bethätigung des Wahren und Schönen ist.
Lafontaines Fabeln sind für die erste Kinderzeit zu großartig und tief. Sie enthalten die herrlichsten Sittenlehren, aber das kleine Kind bedarf derselben noch nicht; es wird durch dieselben in ein Gedankenlabyrinth geführt, worin es sich verirrt, denn jede Moral setzt die Idee der Gesellschaft voraus und das Kind kann sich noch keinen Begriff von der Gesellschaft machen. Darum ziehe ich vor, ihm religiöse Begriffe in poetischer, gefühlvoller Form zu geben. Wenn mir die Mutter sagte, daß ich durch meinen Ungehorsam die heilige Jungfrau und die Engel im Himmel zum Weinen brächte, wurde meine Einbildungskraft lebhaft erregt. Diese wunderbaren Wesen und alle diese Thränen riefen eine unendliche Zärtlichkeit und Furcht in mir hervor. Wenn mich der Gedanke an ihr Dasein erschreckte, erfüllte mich die Vorstellung ihres Schmerzes mit Bedauern und Zuneigung.
Ich will also mit einem Worte, daß man dem Kinde das Wunderbare giebt, so lange es dasselbe liebt und sucht; und daß man es endlich von selbst aufhören läßt und nicht des Kindes Irrthum systematisch verlängert, sobald es sich vom Wunderbaren abwendet, das aufhört, seine natürliche Kost zu sein, und sobald es uns durch seine Fragen und Zweifel anzeigt, daß es in die wirkliche Welt einzutreten verlangt.
Weder Clotilde noch ich haben eine Erinnerung an die größere oder geringere Anstrengung, die uns das Lesenlernen verursacht haben könnte. Unsere Mütter haben uns seitdem gesagt, daß ihnen der Unterricht nur wenig Mühe gemacht hat, aber sie erwähnten eines kindischen Eigensinnes von mir. Als ich eines Tages nicht Lust hatte, mein ABC durchzunehmen, sagte ich zu meiner Mutter: „A will ich gleich sagen, aber B kann ich nicht sagen.“ Es scheint, daß mein Widerstand ziemlich lange dauerte, ich nannte alle Buchstaben des Alphabets, ausgenommen den zweiten, und wenn ich gefragt wurde, warum ich diesen überginge, antwortete ich regelmäßig: „Weil ich das B nicht kenne.“
Die zweite Erinnerung, die ich mir ohne Hülfe bewahrt habe, ist die an das weiße Kleid und den Schleier, den die Tochter des Glasers am Tage ihrer ersten Abendmahlsfeier trug. Ich war damals etwa drei und ein halbes Jahr alt; wir wohnten in der rue Grange-Batelière in der dritten Etage und der Glaser, dessen Laden im Parterre war, hatte mehrere Töchter, die mit mir und meiner Schwester spielten. Ihre Namen weiß ich nicht mehr und kann mich nur der ältesten deutlich erinnern, deren weißes Kleid mir als das schönste in der Welt erschien; ich wurde gar nicht müde, sie zu bewundern. Es that mir sehr weh, als meine Mutter plötzlich sagte: das Weiß wäre ganz gelb und das Mädchen wäre überhaupt schlecht angezogen. Mir war, als hätte mich ein großer Kummer getroffen, indem man mir den Gegenstand meiner Bewunderung zuwider machte.
Ich erinnere mich, daß einmal, als wir eine Ronde tanzten, dieselbe Kleine zu singen begann:
„Wir gehen nicht mehr in das Holz,
Die Lorbeerbäume sind gefällt.“
Ich war, so viel ich weiß, noch nie im Holze gewesen und hatte vielleicht noch niemals Lorbeerbäume gesehen, aber ich mußte wohl wissen, was damit gemeint war, denn diese zwei kleinen Verse versenkten mich in tiefe Träumerei. Ich verließ den Tanz, um darüber nachzudenken und wurde sehr wehmüthig. Auch mochte ich Niemand vertrauen, was mir im Sinne lag, aber ich hätte weinen mögen, so traurig war ich über den Verlust dieses lieblichen Lorbeergehölzes, in das ich nur im Traume eingetreten war, um sogleich wieder daraus vertrieben zu werden. Wer kann die Sonderbarkeiten des Kindesalters erklären? auf mich hatte dies Lied solchen Eindruck gemacht, daß sich der geheimnißvolle Einfluß desselben nie wieder verwischt hat. So oft dies Tanzlied gesungen wurde, fühlte ich mich von derselben Traurigkeit erfüllt und ich kann es auch jetzt nicht von Kindern singen hören, ohne dieselbe Wehmuth, dasselbe Bedauern zu empfinden. Ich sehe das Holz noch immer, wie es war, ehe es durch die Axt zerstört wurde und in der Wirklichkeit habe ich nie ein schöneres gesehen. Dann erblicke ich wieder die Erde mit den frisch gefällten Lorbeerbäumen bedeckt und es scheint mir, daß ich den Vandalen noch immer zürne, die mich auf ewig daraus vertrieben haben. Welche Absicht hatte wohl der kindliche Dichter, als er das kindlichste Tanzlied also begann?
Ich erinnere mich auch an das hübsche Liedchen von Giroflé, girofla, das alle Kinder kennen, und in welchem abermals von einem geheimnißvollen Holze die Rede ist, in welches man einsam eindringt, und wo man dem König oder der Königin, dem Teufel und der Liebe begegnet, lauter phantastische Wesen für den kindlichen Sinn. Ich wüßte nicht, daß ich mich vor dem Teufel gefürchtet hätte; wahrscheinlich glaubte ich nicht an ihn und man verhinderte mich, an ihn zu glauben, weil ich eine sehr rege Einbildungskraft hatte und leicht in Schrecken gerieth. Man schenkte mir einmal einen prachtvollen Polichinell, der von Gold und Scharlach glänzte. Ich fürchtete mich zuerst, besonders wegen meiner Puppe, die ich zärtlich liebte und die mir neben diesem kleinen Ungeheuer von großer Gefahr bedroht schien. Nachdem ich sie sorgfältig im Schranke verschlossen hatte, verstand ich mich endlich dazu, mit dem Polichinell zu spielen, der mir wegen seiner Porzellanaugen, die sich mittels einer Feder in ihren Höhlen bewegten, ein Mittelding zwischen Puppe und lebendem Wesen zu sein schien. Als ich zu Bett ging, wollte man ihn in den Schrank zu meiner Puppe legen, aber das wollte ich durchaus nicht erlauben. Endlich ging man auf mein Verlangen ein, ihn auf dem Ofen schlafen zu lassen, denn es stand ein kleiner Ofen in unserer Stube, die mehr als bescheiden war und deren mit Leimfarben in länglichen Quarrés gemalte Wände ich noch immer erblicke. Ein anderer Umstand, dessen ich mich erinnere, obwohl ich diese Wohnung seit dem Alter von vier Jahren nicht mehr betreten habe, ist, daß der Alkoven durch eine Gitterthür von Messingdraht mit grünen Gardinen verschlossen werden konnte. Außer einem kleinen Vorzimmer, das als Speisesaal diente und einer kleinen Küche, die mein Arrestlocal war, gab es kein anderes Gemach, als dieses Schlafzimmer, das am Tage als Salon benutzt wurde. Man sieht, daß dies nicht sehr luxuriös war. Abends wurde mein kleines Bett vor den Alkoven gestellt, und wenn meine Schwester, die damals in Pension war, zu Hause schlief, wurde neben mir auf dem Kanape ein Bett für sie zurecht gemacht. Dies Kanape war mit grünem Utrechter Sammet bezogen; alle diese Einzelnheiten stehen mir klar vor der Seele, obwohl ich in dieser Wohnung nichts Bemerkenswerthes erlebt habe; aber wahrscheinlich hat sich mein Geist in jener Zeit emsig arbeitend in sich selbst vertieft, denn es scheint mir, als wären alle jene Gegenstände von meinen Träumereien erfüllt, und als hätte ich sie durch meine immerwährende Betrachtung abgenutzt. Vor dem Einschlafen hatte ich noch eine besondere Unterhaltung; sie bestand darin, das Messinggitter der Alkoventhür neben meinem Bette mit den Fingern zu streichen. Der schwache Ton, den ich dadurch hervorbrachte, erschien mir wie eine himmlische Musik und meine Mutter pflegte dabei zu sagen: „Da spielt Aurora wieder das Gitter!“ Doch ich kehre zu meinem Polichinell zurück, der mit dem Rücken auf dem Ofen liegend, mit seinen gläsernen Augen und häßlichem Lachen die Decke des Zimmers betrachtete. Ich sah ihn nicht mehr, aber meine Einbildungskraft zeigte mir ihn noch — ich schlief ein, während ich mich mit dem häßlichen Wesen beschäftigte, das mir mit den Augen in alle Winkel des Zimmers folgen konnte und während der Nacht hatte ich einen schrecklichen Traum. — Polichinell war aufgestanden, sein mit einer Weste von rothem Goldbrokat bekleideter Buckel hatte auf dem Ofen Feuer gefangen; er lief überall umher und verfolgte bald mich, bald meine Puppe, die entsetzt vor ihm floh, während uns die langen Feuerstrahlen erreichten, die er auf uns abschoß. Meine Mutter erwachte von meinem Geschrei und meine Schwester, die nahe bei mir schlief, sah, was mich ängstigte und trug den Polichinell in die Küche, indem sie bemerkte, daß er eine häßliche Puppe für ein Kind meines Alters sei. Ich sah ihn nicht wieder, aber ich behielt noch einige Zeit das imaginäre Gefühl der Brandwunde, die ich im Traume erhalten hatte, und statt wie bisher, gern mit Feuer zu spielen, setzte mich schon der Anblick desselben in Schrecken.
Bald darauf gingen wir nach Chaillot, um meine Tante Lucie zu besuchen, die dort ein kleines Haus nebst Garten besaß. Ich konnte schon gehen, wünschte aber, fortwährend von meinem Freunde Pierret getragen zu sein, für den ich von Chaillot bis zu dem Boulevard eine ziemlich schwere Last wurde. Um mich Abends auf dem Nachhausewege zum Gehen zu bewegen, stellte sich meine Mutter, als wollte sie mich allein auf der Straße zurücklassen. Es war an der Ecke der Straße von Chaillot und der Champs-Elysées, wo gerade in diesem Augenblicke eine kleine, alte Frau die Straßenlaternen anzündete. Ueberzeugt, daß man mich nicht allein lassen werde, blieb ich, entschlossen nicht zu marschiren, ruhig stehen, und meine Mutter entfernte sich mit Pierret einige Schritte, um zu sehen, was ich bei der Aussicht, allein zu bleiben, thun würde. Da die Straße fast menschenleer war, hatte die Frau, welche die Laternen anzündete, unsern Streit mit angehört— sie drehte sich jetzt nach mir um und sagte mit zitternder Stimme: „Nimm Dich in Acht vor mir — ich nehme die kleinen unartigen Mädchen mit und sperre sie die ganze Nacht in die Laterne.“
Es schien, als hätte der Teufel der guten Frau den Gedanken eingegeben, der mich am meisten schrecken konnte. Ich erinnere mich nicht, je wieder ein ähnliches Entsetzen empfunden zu haben, wie das, welches sie mir einflößte. Die Laterne mit ihrem blitzenden Reflector nahm für mich phantastische Formen an, und schon sah ich mich in dieses krystallne Gefängniß eingeschlossen und von der Flamme verzehrt, welche nach dem Willen des Polichinell im Unterrocke aufleuchtete. In ein durchdringendes Geschrei ausbrechend, lief ich hinter meiner Mutter her. — Ich hörte die Alte lachen, und das Schnarren der Laterne, die sie wieder hinaufzog, verursachte mir einen nervösen Schauder, als ob ich mich mit von der Erde aufgezogen und in der höllischen Laterne aufgehangen fühlte.
Die Furcht ist, glaube ich, das größte moralische Leiden der Kinder. Sie zu zwingen, den Gegenstand, der ihnen Furcht einflößt, nahe zu besehen oder zu berühren, ist ein Heilmittel, mit dem ich nicht einverstanden bin. Man muß sie vielmehr davon entfernen und sie zerstreuen, denn das Nervensystem beherrscht ihre Organisation, und wenn sie ihren Irrthum erkannt haben, haben sie doch, während man sie dazu zwang, so viel Angst ausgestanden, daß sie das Gefühl der Furcht nicht wieder verlieren. Es ist zum physischen Uebel geworden, das ihre Vernunft nicht mehr bewältigen kann. — Dasselbe ist es mit den nervenschwachen und ängstlichen Frauen. Man thut unrecht, sie in ihrer lächerlichen Schwäche zu bestärken, aber es ist noch schlimmer, ihnen rauh entgegen zu treten, und der Widerspruch bringt oft wirkliche Nervenzufälle bei ihnen hervor, selbst wenn die Nerven anfänglich nicht ernstlich im Spiele gewesen wären.
Meine Mutter hatte nicht diese Grausamkeit. Wenn wir an der Dampfmaschine vorübergingen, und sie sah, daß ich erblaßte und mich kaum noch aufrecht zu erhalten vermochte, gab sie mich dem guten Pierret auf den Arm — er verbarg mein Gesicht an seiner Brust und das Vertrauen, das er mir einflößte, beruhigte mich. Es ist besser für das moralische Uebel ein moralisches Mittel zu suchen, als der Natur Gewalt anzuthun und das physische Leiden durch ein noch größeres physisches Leiden zu heilen.
In der Rue Grange-Batelière fiel mir ein alter kurzer Auszug aus der Mythologie in die Hände, den ich jetzt noch besitze und dessen große Kupfertafeln das Drolligste sind, was man sich denken kann. Wenn ich mich an das Interesse und an die Bewunderung erinnere, mit welchem ich diese grotesken Bilder betrachtete, scheint es mir, als sähe ich sie noch so, wie sie damals erschienen. Dank diesen Bildern lernte ich, ohne den Text zu lesen, bald die Hauptzüge der Mythologie kennen und das interessirte mich ungemein. Man führte mich zuweilen nach dem chinesischen Schattenspiel des „ewigen Seraphin,“ und zu den Zaubertheatern des Boulevards. Dann erzählten mir meine Mutter und meine Schwester die Märchen von Perrault, und wenn diese verbraucht waren, nahmen sie keinen Anstand, neue zu erfinden, die mir nicht minder interessant schienen. — Man erzählte mir vom Paradiese und regalirte mich mit dem Frischesten und Hübschesten der katholischen Allegorie, und die Engel und Amors, die heilige Jungfrau und die gute Fee, die Polichinells und Zauberer, die Teufelchen im Theater und die Heiligen der Kirche vereinigten sich in meinem Kopfe zu dem sonderbarsten, poetischen Mischmasch, den man sich denken kann.
Meine Mutter hatte religiöse Ideen, die niemals durch einen Zweifel berührt wurden, denn sie prüfte dieselben nie — sie nahm sich also auch nie die Mühe, mir die wunderbaren Geschichten, die sie mit vollen Händen ausstreute, als wahr oder als symbolisch darzustellen. Sie war selbst Künstlerin und Dichterin, ohne es zu wissen, und glaubte als solche an Alles in ihrer Religion, was gut und schön erschien, und stieß alles Finstere und Drohende zurück. Sie erzählte mir mit ebenso großem Ernste von den drei Grazien und den neun Musen, als von den christlichen Tugenden und den weisen Jungfrauen.
War es nun Erziehung, Einflüsterung oder eigne Anlage, gewiß ist, daß sich eine leidenschaftliche Liebe zum Roman meiner bemächtigte, ehe ich noch vollständig lesen gelernt hatte — und zwar auf folgende Weise:
Ich vermochte die Feengeschichten noch nicht zu lesen. Die einfachsten gedruckten Worte blieben fast ohne Sinn für mich, und erst durch die Erzählung wurde mir verständlich, was man mir hatte lesen lassen. Aus eignem Antriebe las ich nichts, denn ich war meiner Natur nach träge, und es ist mir nur mit großer Anstrengung gelungen, mich selbst zu überwinden. Ich suchte also in den Büchern nur die Bilder — aber Alles, was ich mit den Augen und Ohren lernte, drang siedend in meinen kleinen Kopf, und meine Träumereien ließen mich oft den Begriff der Wirklichkeit verlieren, in deren Mitte ich mich befand. Da ich, wie ich schon bemerkte, lange Zeit sehr gern mit dem Feuer im Ofen spielte, so konnte meine Mutter, die keine Magd hatte und immer mit Kochen oder Nähen beschäftigt war, sich meiner nicht anders erwehren, als daß sie mich in ein Gefängniß sperrte, das sie für mich erfunden hatte, und das aus vier Stühlen bestand und einem Kohlenbecken ohne Feuer in der Mitte zum Sitzen, denn den Luxus eines Kissens kannten wir nicht. Die Stühle hatten Strohsitze und ich beschäftigte mich damit, diese mit meinen Nägeln aufzulösen — ich glaube, man hatte sie mir für diesen Gebrauch geopfert. Wie ich mich erinnere, war ich noch so klein, daß ich, um mich diesem Vergnügen zu überlassen, auf das Kohlenbecken steigen mußte — dann konnte ich meine Ellbogen auf einen der Sitze stemmen und benutzte meine Nägel mit einer wunderbaren Geduld. Aber indem ich so dem Bedürfnisse genügte, meine Finger zu beschäftigen, ein Bedürfniß, das ich noch immer fühle, dachte ich nicht im Geringsten an das Stroh der Stühle, sondern componirte mit lauter Stimme endlose Erzählungen, die meine Mutter meine Romane nannte. Sehr oft erklärte sie dieselben, ihrer Länge und der Entwicklung der Nebenumstände wegen, für außerordentlich langweilig. Es ist dies ein Fehler, den ich noch habe, wie man sagt, denn ich meinestheils gestehe, daß ich mir wenig Rechenschaft von dem gebe, was ich thue, und daß ich heute wie damals, als ich vier Jahr alt war, bei dieser Art von Schöpfungen ein völliges Michgehenlassen nicht besiegen kann.
Es scheint, daß meine Geschichten eine Art Abguß von Allem waren, was mein kleines Gehirn erfüllte. Es entstand immer eine Skizze in der Weise der Feenmärchen, und die Hauptpersonen waren eine gute Fee, ein guter Prinz und eine schöne Prinzessin. Böse Wesen gab es nur wenige darin, und ein großes Unglück niemals. Alles entwickelte sich unter dem Einflusse eines Gedankens, so lachend und optimistisch, wie die Kindheit selbst ist. Das Merkwürdigste war die Länge der Geschichten und ihre Fortsetzungen, denn ich nahm den Faden der Erzählung genau da wieder auf, wo ich ihn am Tage vorher hatte fallen lassen. Vielleicht hat mir meine Mutter, ohne es zu wissen, geholfen, mich in den langen Geschichten wieder zurecht zu finden, die sie unwillkürlich mit anhörte. Auch meine Tante erinnert sich dieser Erzählungen mit vieler Heiterkeit und weiß noch, daß sie mich oft gefragt hat: „Nun Aurora, ist Dein Prinz noch nicht wieder aus dem Walde gekommen? Ist Deine Prinzessin bald damit fertig, ihr Schleppkleid und ihre goldne Krone anzulegen?“ „Laß sie in Frieden,“ sagte dann meine Mutter; „ich kann nicht eher in Ruhe arbeiten, als wenn sie ihre Romane zwischen vier Stühlen anfängt.“
Noch genauer erinnere ich mich meines Eifers bei Spielen, die eine wirkliche Handlung vorstellten. Anfänglich war ich immer verdrießlich, und wenn meine Schwester oder die älteste Tochter des Glasers mich zu den klassischen Spielen „pied de boeuf“ oder „main chaude“ aufforderten, so fand ich diese nicht nach meinem Geschmacke oder war ihrer bald müde, aber mit meiner Cousine Clotilde oder andern Kindern meines Alters spielte ich mit Leidenschaft Spiele, die meine Phantasie anregten. Wir führten Schlachten auf, oder Fluchten durch die Wälder, die in meiner Einbildung eine so große Rolle spielten; oder eine von uns hatte sich verirrt und die Andern riefen und suchten sie — sie war dann unter einem Baume eingeschlafen, d. h. unter dem Sopha, und wir kamen ihr zu Hülfe. Eine von uns war die Mutter der Andern oder ihr General, denn der militärische Geist drang von außen selbst in unser Nest, und mehr als einmal habe ich den Kaiser gemacht und auf dem Schlachtfelde kommandirt. Wir zerschlugen die Puppen und die Wirthschaftsgegenstände und es scheint, als hätte mein Vater eine ebenso jugendliche Einbildungskraft besessen als wir, denn er konnte die mikroskopische Darstellung der Greuelscenen, die er im Kriege sah, nicht ertragen. „Ich bitte Dich, fahre mit dem Besen über das Schlachtfeld der Kinder,“ sagte er zu meiner Mutter; „es ist Thorheit, aber ich kann diese Arme, Beine und rothen Lappen nicht auf der Erde liegen sehen.“
Wir gaben uns keine Rechenschaft von unsrer Grausamkeit, weil die Puppen die Metzelei geduldig ertrugen, aber indem wir auf unsern eingebildeten Pferden umhergaloppirten und mit unsern unsichtbaren Säbeln die Meubel und das Spielzeug zerschlugen, überließen wir uns einem Enthusiasmus, der zum Fieber wurde. Man machte uns wegen unsrer Knabenspiele Vorwürfe und gewiß ist es, daß meine Cousine und ich nach wilden Aufregungen verlangten. Besonders deutlich erinnere ich mich eines Herbsttages, wo es, während das Diner servirt wurde, finster in der Stube geworden war. Wir befanden uns nicht bei uns, sondern wie ich glaube, bei meiner Tante in Chaillot, denn es waren Bettvorhänge da und wir besaßen keine. Wir, Clotilde und ich, verfolgten einander zwischen den Bäumen, d.h. hinter den Fallen der Bettvorhänge. Das Zimmer entschwand unsern Augen und wir befanden uns beim Einbruche der Nacht wirklich in einer dunkeln Landschaft. Man rief uns zu Tisch, aber wir hörten nicht — endlich kam meine Mutter und nahm mich auf den Arm, um mich an den Tisch zu tragen, und ich erinnere mich noch immer meines Staunens, als ich die Lichter, den Tisch und alle wirklichen Gegenstände erblickte, die mich umgaben. Ich hatte eine vollständige Vision gehabt, und es that mir weh, so plötzlich herausgerissen zu werden. — Zuweilen, wenn ich in Chaillot war, glaubte ich in Paris zu sein, und umgekehrt; und es kostete mich oft eine Anstrengung, mich zu überzeugen, wo ich mich befand, und meine Tochter war als Kind derselben Sinnentäuschung ausgesetzt.
Ich glaube nicht, daß ich seit 1808 in Chaillot gewesen bin, denn nach der spanischen Reise, bis zu der Zeit, wo mein Onkel sein kleines Besitzthum an den Staat verkaufte, weil es sich auf dem Platze befand, der für den Palast des Königs von Rom bestimmt war, habe ich Nohant nicht verlassen. Aber mag ich mich täuschen oder nicht, ich will hier einfügen, was ich über dieses Haus zu sagen habe, welches damals ein wirkliches Landhaus war. Chaillot war zu jener Zeit nicht so gebaut, wie es jetzt ist.
Es war — wie ich jetzt weiß,da mir die Gegenstände, die mir im Gedächtniß geblieben sind, in ihrem wahren Werthe erscheinen — die bescheidenste Wohnung der Welt, aber in meinem damaligen Alter schien sie mir ein Paradies zu sein. Ich würde den Plan des Hauses und Gartens geben können, so genau habe ich noch Alles in der Erinnerung. Der Garten besonders war für mich ein Ort der Wonne, denn es war der einzige, den ich kannte. Meine Mutter, die, was man damals auch meiner Großmutter von ihr sagte, in einer Beschränkung lebte, die an Armuth grenzte und eine Sparsamkeit und einen häuslichen Fleiß zeigte, die einer Frau des Volkes würdig waren, führte mich nicht in die Tuilerien, um unsere Toilette zur Schau zu stellen, denn wir hatten keine, und um mich beim Spiel mit Reifen und Schnur unter den Augen der Laffen in der Ziererei zu üben. Wir verließen unsere traurige Zurückgezogenheit nur, um zuweilen das Theater zu besuchen, das meine Mutter außerordentlich liebte und öfter noch, um nach Chaillot zu gehen, wo wir immer mit Freudengeschrei empfangen wurden. Die Fußpartie und das Passiren der Dampfmaschine war mir zwar zuwider, aber kaum befand ich mich in dem Garten, so glaubte ich auf einer der Zauber-Inseln meiner Märchen zu sein, Clotilde, die sich dort den ganzen Tag in Sonnenschein aufhalten durfte, war frischer und fröhlicher als ich, und sie machte die Honneurs ihres Eden mit der Gutmüthigkeit und ungezwungenen Heiterkeit, die ihr immer eigen geblieben sind, Sie war jedenfalls die Beste von uns Beiden; sie war gesünder und weniger launenhaft als ich, und ich betete sie an, obwohl ich mir oft Ausfälle gegen sie erlaubte, auf die sie mit Spöttereien antwortete, die mich verdrossen. Sie verdrehte zum Beispiel, wenn sie unzufrieden mit mir war, meinen Namen Aurora und nannte mich „Horreur“, eine Beleidigung, die mich außer mir bringen konnte. Aber wie sollte ich lange zürnen bei dieser grünen Hagebuchenhecke, bei dieser mit Blumentöpfen eingefaßten Terrasse? Dort habe ich auch die ersten „Fäden der Jungfrau“ gesehen, die weiß und glänzend in der Herbstsonne umherflogen. Meine Schwester war an tiefem Tage bei uns und erklärte uns mit weiser Miene, daß die Jungfrau selbst diese Faden auf ihrer Elfenbeinspindel zu spinnen pflegte; darum wagte ich nicht sie zu zerreißen, und machte mich ganz klein, um darunter durchzuschlüpfen.
Der Garten war ein längliches Viereck und in Wahrheit sehr klein, aber mir erschien er ungeheuer groß, obwohl ich ihn täglich wohl zweihundert Mal umkreiste. Er war nach alter Weise in regelmäßige Beete abgetheilt und enthielt Gemüse und Blumen, gewährte aber nicht die geringste Aussicht, da er ganz von Mauern umgeben war. Im Hintergründe befand sich eine mit Sand bestreute Terrasse, zu der einige steinerne Stufen führten und die an jeder Seite mit einer großen Vase von gebranntem Thon und von merkwürdig einfältiger Form verziert war. Und auf dieser Terrasse, die mir wie ein zauberhafter Ort erschien, wurden unsere großen Spiele: Schlacht, Flucht und Verfolgung vorgenommen.
In diesem Garten habe ich auch die ersten Schmetterlinge gesehen und große Sonnenblumen, die mir wenigstens hundert Fuß hoch schienen. Eines Tages wurden wir in unsern Spielen durch einen großen Lärm unterbrochen. Man rief: „Es lebe der Kaiser!“ man ging eilig vorüber, entfernte sich und das Rufen dauerte fort. Der Kaiser kam wirklich in der Ferne vorüber: wir hörten den Trab der Pferde und die Bewegung der Menge. Leider konnten wir nicht durch die Mauer sehen; aber in meiner Einbildung war es wunderschön, und wir schrien aus Leibeskräften und von sympathetischer Begeisterung erregt: „Es lebe der Kaiser!“
Wußten wir, was der Kaiser war? ich kann mich nicht mehr darauf besinnen; aber es ist wahrscheinlich, daß wir unaufhörlich von ihm sprechen hörten. Kurz nachher machte ich mir auch einen klaren Begriff von ihm; ganz genau kann ich die Zeit nicht angeben, aber es mußte wohl zu Ende des Jahres 1807 sein.
Er hielt eine Revue auf dem Boulevard und war nicht weit von der Magdalenenkirche, als es meiner Mutter und Pierret gelang, bis zu den Soldaten vorzudringen. Pierret erhob mich in seinen Armen über die Tschacko's, damit ich etwas sehen sollte; dieser Gegenstand, der sich über die Soldatenreihen erhob, zog die Augen des Kaisers unwillkürlich an, und meine Mutter rief mir zu: „Er hat Dich angesehen! vergiß es nie, es wird Dir Glück bringen!“ Ich glaube, der Kaiser hörte diese naiven Worte, denn er sah mich nun wirklich an, und es ist mir, als sähe ich noch jetzt eine Art von Lächeln über das bleiche Antlitz streifen, dessen kalte Strenge mich anfangs erschreckte — und niemals werde ich sein Gesicht vergessen und vor Allem nicht den Ausdruck seines Blickes, den keines seiner Bilder wiederzugeben vermag. Der Kaiser war zu jener Zeit ziemlich stark und bleich; er trug einen Ueberrock über der Uniform, aber ich weiß nicht mehr, ob es ein grauer war. Im Augenblick, als ich ihn sah, hielt er den Hut in der Hand, und ich wurde gleichsam magnetisirt durch seinen klaren, im ersten Momente so harten Blick, der plötzlich sanft und wohlwollend wurde. Ich habe ihn später noch mehrere Male gesehen, aber nur undeutlich, weil er weiter entfernt war und schnell vorüberging.
Auch den König von Rom habe ich als Kind in den Armen seiner Amme gesehen. Sie stand mit ihm an einem Fenster der Tuilerien, und er lachte die Vorübergehenden an. Als er mich erblickte, lachte er noch freundlicher, — denn Kinder üben immer sympathetischen Einfluß auf einander aus — und warf mir ein großes Bonbon zu, das er in seiner kleinen Hand hielt. Meine Mutter wollte dasselbe aufnehmen, um es mir zu geben, aber die Schildwache, die das Fenster bewachte, wollte ihr nicht gestatten, die bezeichnete Linie zu überschreiten, obwohl die Wärterin durch Zeichen zu verstehen gab, daß das Bonbon für mich wäre, und daß man es mir geben sollte. Wahrscheinlich stand davon nichts im Befehl der Schildwache, und so blieb sie taub gegen unsere Vorstellungen. Ich war durch dies Benehmen sehr verletzt und fragte meine Mutter im Weitergehen, warum dieser Soldat so unhöflich wäre. Sie erklärte mir, daß er dies kostbare Kind zu behüten hätte, und daß es seine Pflicht wäre, jede Annäherung zu vermeiden, weil schlecht gesinnte Menschen ihm Böses zufügen könnten. Der Gedanke, daß irgend Jemand im Stande wäre, einem Kinde Böses zu thun, erschien mir fürchterlich; aber ich war damals neun oder zehn Jahre und der kleine König höchstens zwei Jahre alt — so daß diese Anekdote eine Abschweifung ist.
Aber mein erstes musikalisches Gefühl gehört unter die Erinnerungen aus meinen vier ersten Lebensjahren.
Meine Mutter hatte in einem Dorfe bei Paris, ich weiß nicht mehr in welchem, einen Besuch gemacht. Die Wohnung, in die wir uns begaben, lag in einer obern Etage, und da ich zu klein war, um aus dem Fenster auf die Straße zu sehen, erblickte ich nur die Giebel der angrenzenden Häuser und ein großes Stück Himmel. Wir blieben einen großen Theil des Tages dort, aber ich bekümmerte mich um nichts, weil ich die ganze Zeit über durch den Ton eines Flageolets in Anspruch genommen war, das eine Menge Melodien spielte, die mir herrlich erschienen. Der Ton kam aus einer der höchsten Dachstuben und zwar sehr aus der Ferne, denn meine Mutter, die ich fragte, was das wäre, hörte ihn kaum. Mein Gehör war zu jener Zeit wahrscheinlich feiner und empfindlicher und so verlor ich auch nicht eine Modulation des kleinen Instrumentes, dessen Töne in der Nähe so scharf und von weitem so weich sind. Ich war ganz entzückt; es war mir, als hörte ich die Töne im Traume; der Himmel war rein und von glänzender Bläue und diese zarten Melodien schienen über den Dächern zu schweben und sich im Himmel zu verlieren. Wer weiß, ob der Musiker nicht ein Künstler voll hoher Begeisterung war, der in tiefem Augenblicke nur mich als Zuhörer hatte? es konnte freilich ebenso gut ein Küchenjunge sein, der sich die Melodie der Monaco und der Folies d'Espagne einübte. Das mochte nun sein wie es wollte, ich hatte einen unaussprechlichen musikalischen Genuß und stand ganz in Entzücken versunken an jenem Fenster, wo ich zum ersten Male in unbestimmter Weise die Harmonie der äußern Welt begriff, indem meine Seele in gleichem Maße durch die Musik und die Schönheit des Himmels hingerissen war.