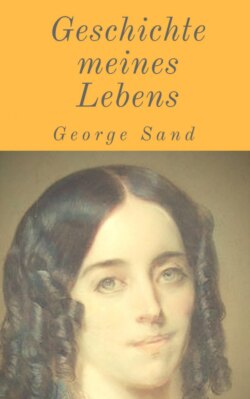Читать книгу Geschichte meines Lebens - George Sand - Страница 77
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Siebenter Brief.
ОглавлениеParis, den 9. Ventose.
„Meine liebe, gute Mutter, wenn ich Deinen Brief in dem Tone lesen wollte, worin Du ihn geschrieben hast, so bliebe mir nichts übrig, als mich in's Wasser zu stürzen. Aber ich bin überzeugt, daß Du nicht ein Wort von dem glaubst, was Du geschrieben hast. Einsamkeit und Entfernung lassen Dich die Dinge für größer ansehen, als sie sind, aber obwohl ich mich auf das Zeugniß meines Gewissens berufen darf, bin ich doch durch Deine Sprache sehr schmerzlich berührt. Du wirfst mir beständig mein Mißgeschick vor, als ob ich im Stande gewesen wäre, es zu beschwören, und als ob ich Dir nicht hundert Mal gesagt und bewiesen hätte, daß alle Mitglieder des Generalstabes in die vollständigste Ungnade gefallen sind.
„Es ist auch nicht anzunehmen, daß Zufall oder Gunst sich bedeutend für oder gegen uns erklären. Der Kaiser hat nun einmal sein System! Clarke und Caulaincourt haben sich bei ihm auf das Angelegentlichste für mich verwendet. Dupont selbst hat mir in der letzten Zeit Gerechtigkeit erwiesen und hat sich vielfach für mich bemüht. Ich beklage mich über Niemand und vor Allem beneide ich Niemand. Ich freue mich über die Gunstbezeugungen, die meinen Verwandten und Freunden zu Theil werden, ich sage mir dabei nur, daß ich nicht auf demselben Wege vorwärts kommen werde, weil ich mich nicht darauf verstehe. Der Kaiser wählt und ernennt allein; der Kriegsminister ist nur noch ein erster Commis. Der Kaiser weiß genau, was er thut und was er will: er will Alle, welche die Hochmüthigen gespielt haben, heranziehen, er will sich und seine Familie mit Höflingen umgeben, die er der alten Partei abwendig gemacht hat. Er hat ja nicht nöthig, uns untergeordneten Offizieren zu gefallen, die wir den Krieg aus Begeisterung mitgemacht haben und von denen er nichts zu fürchten hat. Wenn Du Dich in der Gesellschaft bewegtest, wenn Du in Intriguen verflochten wärest, wenn Du mit den Freunden des Auslandes gegen ihn conspirirtest, würde für mich Alles besser stehen, ich wäre nicht vergessen und verlassen: ich hätte nicht nöthig gehabt, mein Leben in die Schanze zu schlagen, im Wasser und im Schnee zu schlafen, hundert Gefahren zu trotzen und unser kleines Vermögen im Dienste des Vaterlandes zu opfern. Meine gute Mutter, ich mache Dir keinen Vorwurf wegen Deiner Uneigennützigkeit, Deiner Weisheit und Tugend; im Gegentheil, ich liebe, achte und verehre Dich wegen Deines Charakters — aber verzeihe mir nun auch, wenn ich nur ein braver Soldat und ein aufrichtiger Patriot bin.
„Wir wollen uns übrigens trösten, denn laß nur den Krieg wieder beginnen, so ändern sich wahrscheinlich alle Verhältnisse. Sobald es sich wieder um Flintenschüsse handelt, sind wir auch wieder zu etwas gut und dann wird man sich unserer erinnern.
„Ich will die letzte Seite Deines Briefes nicht wieder lesen — ich habe sie verbrannt. Ach! was sagst Du mir? Nein, meine Mutter, ein braver Mann entehrt sich nicht, wenn er ein Weib liebt und ein Weib ist keine Dirne, wenn sie von einem ehrenhaften Manne geliebt wird, der sie für die Ungerechtigkeiten des Geschicks zu entschädigen sucht. Du weißt das besser als ich! meine Ansichten haben sich nach Deinen Lehren gebildet, die ich immer ehrfurchtsvoll aufgenommen habe und so sind sie nur ein Widerschein Deiner Seele. Welch ein unbegreifliches Verhängniß bringt Dich nun dazu, mir vorzuwerfen, daß ich der Mann bin, den Du geistig und körperlich gebildet hast?
„Aber auch aus Deinen Vorwürfen bricht Deine Zärtlichkeit immer hervor. Ich weiß nicht, wer Dir gesagt haben mag, daß ich eine Zeitlang im Elende war, so daß Du Dich nachträglich darum ängstigst. Nun ja! es ist wahr, ich habe im vergangenen Sommer eine kleine Dachstube bewohnt — und die Häuslichkeit des Dichters und Verliebten bildete einen sonderbaren Gegensatz zu den goldenen Stickereien meiner Uniform. Wegen dieses Augenblicks der Verlegenheit, von dem ich Dir nicht gesagt habe, und über welchen ich mich nie beklagen werte, darfst Du Niemand anklagen. Er war durch eine Schuld veranlaßt, die ich längst bezahlt glaubte. Ich hatte das Geld ungetreuen Händen übergeben, aber jetzt ist der Schaden bereits durch meinen Sold ausgeglichen. Ich habe jetzt auch eine sehr hübsche kleine Wohnung und entbehre nichts.
„Was sagte mir denn Andrezel? Du würdest vielleicht nach Paris kommen, würdest Nohant vielleicht verkaufen? Ich verstehe das nicht recht. Ach komm, meine gute Mutter, komm! alle unsere Leiden wird eine zärtliche und aufrichtige Erklärung in die Flucht jagen! Aber verkaufe Nohant nicht, Du würdest Dich dahin zurücksehnen. Lebe wohl, ich umarme Dich von ganzer Seele. Ich bin sehr traurig und niedergeschlagen über Deine Unzufriedenheit und doch ist Gott mein Zeuge, daß ich Dich liebe, und daß ich Deine Liebe verdiene.
Moritz.“
In dem letzten Briefe dieser Correspondenz spricht mein Vater ziemlich weitläufig über einen Vorfall, der seine Mutter sehr zu quälen schien.
Man hatte soeben Marmontel's hinterlassene Memoiren herausgegeben. Meine Großmutter hatte Marmontel in ihrer Kindheit viel gesehen, aber sie sprach nie von ihm und seine Memoiren sagen deutlich, aus welchem Grunde.
Hier ist ein Bruchstück aus diesen Denkwürdigkeiten.
„Die Art von Wohlwollen, welche man an diesem Hofe [Der Hof des Kronprinzen, Vater Ludwig's XVI.] für mich hatte, diente wenigstens dazu, mir bei einem merkwürdigen Vorfalle Gehör und Glauben zu verschaffen. Das Taufzeugniß von Aurora, Tochter des Fräuleins von Verrières bekundete, daß sie das Kind des Marschalls von Sachsen [Marmontel irrte sich, da es nöthig wurde, dies Zeugniß durch Parlamentsbeschluß umzuändern.] ist, und nach dem Tode des Vaters hatte die Frau Kronprinzessin die Absicht, sie erziehen zu lassen. Das war der Ehrgeiz der Mutter; aber plötzlich fiel es dem Kronprinzen ein, zu behaupten, sie wäre meine Tochter und dieser Ausspruch that seine Wirkung. Frau von Chalut theilte mir denselben lachend mit, aber ich nahm die Sache von der ernsthaftesten Seite; nannte den Scherz des Kronprinzen leichtsinnig, machte mich anheischig zu beweisen, daß ich Fräulein Verrières erst während der Reise des Marschalls nach Preußen, also ein Jahr nach der Geburt dieses Kindes kennen gelernt hatte und sagte, daß es grausam sein würde, der Kleinen ihren wirklichen Vater zu nehmen und mich dafür auszugeben. Frau von Chalut [Diese Frau von Chalut war eine geborne Baranchon und die begünstigte Kammerfrau der ersten und zweiten Kronprinzessin. Die letzte verheirathete sie und ihr Mann wurde zum General-Pächter gemacht, Sie und der Marquis von Polignac haben meinen Vater über die Taufe gehalten.] übernahm es, diese Sache bei der Kronprinzessin zu führen und der Kronprinz gab nach. So wurde denn Aurora auf ihre Kosten in einem Nonnenkloster von St. Cloud erzogen, und aus Gefälligkeit für mich und auf meine Bitte übernahm es Frau von Chalut, welche in St. Cloud ein Landhaus besaß, diese Erziehung in ihren Einzelnheiten zu überwachen.“
Dieses Fragment konnte meine Großmutter nicht verletzen, aber an einer andern Stelle sprach sich der Verfasser der „Incas“ in weniger zurückhaltender Weise über seinen Verkehr mit Fräulein von Verrières aus. Obwohl er mit Achtung und Zuneigung von dem Betragen, dem Charakter und dem Talent dieser jungen Schauspielerin redet, geht er auf Einzelnheiten von so zarter Natur ein, daß dadurch das Gefühl der Tochter nothwendig leiden mußte. Diese schrieb darum an meinen Vater, um ihn aufzufordern, das Mögliche zu thun, diesen Abschnitt aus den spätern Auflagen zu streichen. Der Onkel Beaumont wurde zu Rath gezogen; er war bei der Sache in gleicher Weise interessirt, denn Marmontel erzählt bei dieser Gelegenheit, wie er die Veranlassung gewesen ist, daß der Marschall von Sachsen dem Fräulein von Verrières die Pension von 12,000 Livres entzog, welche er ihr und ihrer Tochter ausgesetzt hatte; aber daß diese schöne Frau durch den Fürsten von Türenne dafür entschädigt wurde, nachdem Marmontel das Versprechen gegeben hatte, mit ihr zu brechen. Nun war aber, wie ich schon gesagt habe, der Onkel Beaumont ein Sohn des Fräuleins von Verrières und dieses Fürsten Türenne, Herzogs von Bouillon; aber er nahm die Sache nicht so ernst.
„Beaumont versichert,“ schrieb mein Vater an meine Großmutter, „daß dies nicht so viel Kummer verdient, wie Du Dir darüber machst. Vor allen Dingen sind wir, so viel ich weiß, nicht reich genug, um die erste Ausgabe anzukaufen und zu erwirken, daß die zweite verändert wird. Wären wir aber im Stande dies zu thun, so gäbe dies den verkauften Exemplaren nur um so größern Reiz, und früher oder später könnten wir es doch nicht hindern, daß man eine neue Auflage nach der ersten veranstaltete. Würden außerdem die Erben Marmontel's auf unsern Vertrag mit den Buchhändlern eingehen? ich zweifle daran, und wir sind auch nicht mehr in den Zeiten, wo man mit Versprechungen oder Drohungen, oder durch geheime Verhaftsbefehle gegen die Freiheit der Schrift einschreiten konnte. Man darf die „schuftigen“ Schriftsteller und Drucker nicht mehr mit Stockprügeln zurechtweisen — und meine gute Mutter, die schon zu jener Zeit zur Partei der Encyclopädisten und der Philosophen gehörte, kann es nicht unrecht finden, daß unsre Sitten und Gesetze anders geworden sind. Ich begreife vollkommen, wie sehr es Dich schmerzt, daß so leichtsinnig von Deiner Mutter gesprochen wird — aber wie kann das Dein Leben berühren, das immer so streng, oder Deinen Ruf, der immer so rein war? Was mich betrifft, so kümmert es mich sehr wenig, ob man im Publikum erfährt, was ein Theil der Gesellschaft schon längst von meiner Großmutter mütterlicher Seite wußte. Ich sehe aus den fraglichen Memoiren, daß sie eine liebenswürdige, sanfte Frau war, ohne Intriguen, ohne Ehrgeiz und die in Betracht ihrer Verhältnisse ein gutes, vernünftiges Leben führte. Es ist ihr gegangen wie so vielen Andern! Die Verhältnisse haben ihre Fehler hervorgebracht, aber wegen ihres sanften, liebenswürdigen Wesens hat man diese ertragen. Dies ist der Eindruck, welchen die Zeilen, die Dich so furchtbar quälen, in mir hervorgebracht haben und Du kannst versichert sein, daß das Publikum nicht strenger ist als ich.“
Hiermit endigen die Briefe meines Vaters an seine Mutter; ohne Zweifel schrieb er ihr noch oft während der vier letzten Jahre seines Lebens, und während der häufigen Trennungen, welche der Wiederausbruch des Krieges verursachte. Aber diese Correspondenz ist verschwunden, warum und auf welche Weise, ist mir unbekannt. Bei der Fortsetzung der Geschichte meines Vaters kann ich nun also nichts mehr zu Rathe ziehen, als seine Dienstlisten, einige Briefe an seine Frau und die unbestimmten Erinnerungen meiner Kindheit.
Im Lauf des Ventose begab sich meine Großmutter nach Paris, in der Absicht, die Ehe ihres Sohnes zu trennen; sie hoffte sogar seine Einwilligung dazu zu erlangen, denn sie hatte ihn niemals ihren Thränen widerstehen sehen. Sie kam ohne sein Wissen nach Paris, denn sie hatte ihm den Tag ihrer Abreise nicht gemeldet und ließ ihn auch nicht, wie sie früher gewohnt war, von ihrer Ankunft benachrichtigen. Sie ging zuerst zu Herrn Desèze, den sie über die Gültigkeit der Ehe zu Rath zog. Herrn Desèze erschien dieser Fall eben so neu wie die Gesetzgebung, durch welche er möglich geworden war. Er berief zwei andere berühmte Advokaten, und das Ergebniß ihrer Berathung war, daß zwar Grund zu einem Processe vorläge — denn in allen Dingen dieser Welt ist jederzeit Grund zu Processen vorhanden — daß man aber neun gegen eins wetten könnte, die Heirath von den Gerichten bestätigt zu sehen; daß mein Geburtsschein meine Legitimität feststellte, und daß es im Fall einer Trennung der Ehe unfehlbar die Absicht und die Pflicht meines Vaters sein müßte, die nöthigen Formalitäten zu erfüllen, um mit der Mutter des Kindes, das er legitimiren wollte, eine neue Ehe zu schließen.
Meine Großmutter hatte vielleicht nie die ernstliche Absicht gehabt, gerichtlich gegen ihren Sohn einzuschreiten, und hätte sie auch diesen Plan gefaßt, so würde ihr der Muth der Ausführung gefehlt haben. Wahrscheinlich wurde sie von der Hälfte ihres Schmerzes befreit, als sie ihre feindseligen Versuche einstellte, denn wir verdoppeln unser Leid, wenn wir unsre Lieben mit Härte behandeln. Sie wollte indessen noch einige Tage vergehen lassen, ohne ihren Sohn zu sehen, vielleicht um das Widerstreben ihres Sinnes zu besiegen oder um neue Erkundigungen über die Schwiegertochter einzuziehen. Aber mein Vater entdeckte ihren Aufenthalt in Paris; er begriff, daß sie Alles erfahren haben mußte und übertrug es mir, seine Sache zu führen. Er nahm mich in seine Arme, stieg in einen Fiaker, hielt vor dem Hause, wo meine Großmutter abgestiegen war, gewann mit wenigen Worten das Wohlwollen der Pförtnerin und übergab mich dieser Frau, die sich in folgender Weise ihres Auftrages entledigte:
Sie begab sich in die Wohnung meiner Großmutter und verlangte unter irgend einem Vorwande mit ihr zu sprechen. Als sie vorgelassen war, sagte sie ihr, ich weiß nicht was, unterbrach sich aber plötzlich in ihren Plaudereien, um zu bemerken: „Sehen Sie mal, Madame, welche hübsches kleines Mädchen ich hier habe. Ich bin ihre Großmutter; ihre Amme hat sie mir heute gebracht und ich bin so glücklich darüber, daß ich mich keinen Augenblick von ihr trennen kann.“
„Ja, sie ist sehr frisch und kräftig.“ sagte meine Großmutter, indem sie ihre Bonbonnière suchte; sogleich legte mich die gute Frau, die ihre Rolle vortrefflich spielte, auf den Schooß der Großmutter, die mir Süßigkeiten reichte und anfing mich mit Erstaunen und einer gewissen Bewegung zu betrachten. Plötzlich stieß sie mich zurück und rief: „Sie täuschen mich, dies Kind gehört nicht Ihnen! Es sieht Ihnen nicht ähnlich — ich weiß, ich weiß, was es ist!“
Es scheint, daß ich, erschreckt über die Bewegung, die mich von dem mütterlichen Schooße entfernte, anfing, nicht zu schreien, sondern wirkliche Thränen zu vergießen, die bedeutenden Eindruck machten. „Komm, mein guter, kleiner Liebling,“ sagte die Pförtnerin, indem sie mich wieder hinnahm; „man will Dich nicht haben, wir gehen fort!“
Meine gute Großmutter war besiegt: „Geben Sie mir die Kleine wieder,“ sagte sie; „das arme Kind! ihre Schuld ist es ja nicht! aber wer hat sie hergebracht?“— „Ihr Herr Sohn selbst, Madame; er wartet unten und ich will ihm seine Tochter wieder bringen. Verzeihen Sie, wenn ich Sie beleidigt habe, aber ich, ich wußte nichts! ich weiß nichts! Ich dachte Ihnen eine Freude zu bereiten — eine schöne Ueberlaschung ...“ „Gehen Sie, gehen Sie, meine Liebe, ich zürne Ihnen nicht,“ sagte meine Großmutter: „holen Sie meinen Sohn und lassen Sie mir das Kind.“
Mein Vater sprang die Treppe in großen Sätzen herauf, fand mich auf dem Schooße, in den Armen meiner Großmutter, welche sich weinend bemühte, mich zum Lachen zu bringen. Man hat mir nicht erzählt, was zwischen den Beiden vorging, und da ich erst acht oder neun Monate alt war, ist es wahrscheinlich, daß ich nichts davon verstand. Eben so wahrscheinlich ist es, daß sie miteinander weinten und sich dann um so inniger liebten. Meine Mutter, welche mir dies erste Abenteuer meines Lebens mittheilte, hat mir gesagt, daß ich, als mich der Vater zu ihr zurückbrachte, einen schönen Ring mit einem großen Rubin in den Händen hielt; meine Großmutter hatte ihn sich vom Finger gezogen, hatte mir aufgetragen, ihn meiner Mutter anzustecken, und mein Vater sorgte dafür, daß ich dies pünktlich vollführte.
Es verging indessen noch einige Zeit, ehe meine Großmutter einwilligte, ihre Schwiegertochter zu sehen; aber schon verbreitete sich das Gerücht, daß mein Vater eine unpassende Verbindung geschlossen hätte und ihre Weigerung, meine Mutter zu empfangen, mußte nothwendigerweise zu nachtheiligen Folgerungen über dieselbe und also auch über meinen Vater Anlaß geben. Meine Großmutter erschrak über den Schaden, der aus ihrem Widerwillen entstehen konnte; sie empfing die zitternde Sophie und wurde durch ihre naive Unterwürfigkeit, durch ihre zärtlichen Liebkosungen vollständig entwaffnet. Die kirchliche Trauung wurde im Beisein meiner Großmutter gefeiert, und darauf besiegelte ein Familiendiner die Anerkennung meiner Mutter, sowie die meinige.
Ich wurde später, wenn ich meine eignen Erinnerungen, die mich nicht irre leiten können, zu Rathe ziehe, den Eindruck schildern, welchen diese beiden in Gewohnheiten und Ansichten so ganz verschiedenen Frauen auf einander machten. Für den Augenblick beschränke ich mich darauf zu sagen, daß das Benehmen Beider vortrefflich war, daß sie sich Mutter und Tochter nannten, und daß die Heirath meines Vaters vielleicht für einen engern Kreis ein Aergerniß abgab, daß jedoch die Gesellschaft, welche mein Vater besuchte, sich nicht darum kümmerte und meine Mutter aufnahm, ohne nach ihren Ahnen und ihrem Schicksal zu fragen. Aber sie liebte die Gesellschaft nie und ließ sich an Mürat's Hofe nur vorstellen, weil sie durch das Amt, das mein Vater späterhin bei diesem Fürsten bekleidete, gleichsam dazu gezwungen wurde.
Meine Mutter fühlte sich weder gedemüthigt noch geehrt, wenn sie mit Leuten zusammentraf, die sich über sie erhaben dünken konnten. Sie verspottete auf feine Weise den Hochmuth der Einfältigen, die Eitelkeit der Emporkömmlinge, das Gefühl ihrer Abstammung vom Volke durchdrang sie bis zu den Fingerspitzen, und darum hielt sie sich für adliger, als alle Patrizier und Aristokraten der Erde. Sie pflegte zu sagen, daß die Abkömmlinge ihres Stammes ein rötheres Blut und weitere Adern hätten, als die der andern, und ich möchte das fast glauben, denn wenn es wahr ist, daß die Vortrefflichkeit der Geschlechter auf der moralischen und physischen Thatkraft beruht, so läßt sich auch nicht leugnen, daß sich dieselbe bei allen Familien vermindert, welche aufhören sich in Arbeit, in Muth und in Leiden zu üben. Dieser Satz kann gewiß nicht ohne Ausnahme gelten und man kann hinzufügen, daß ein Uebermaß von Arbeit und Leid die Organisation eben so entkräftet wie ein Uebermaß von Weichlichkeit und Unthätigkeit. Aber im Allgemeinen ist es gewiß, daß das Leben aus den untern Schichten der Gesellschaft hervorströmt und sich um so mehr verliert, je mehr es sich dem Gipfel nähert, wie das auch bei dem Safte der Pflanzen der Fall ist.
Meine Mutter gehörte nicht zu jenen kühnen Intriguantinnen, deren geheimes Verlangen ist, gegen die Vorurtheile ihrer Zeit zu kämpfen und die sich zu erhöhen glauben, wenn sie sich an die falsche Größe der Welt anklammern, auf die Gefahr hin tausendmal zurückgewiesen zu werden. Sie war viel zu stolz, um sich nur einer kalten Begegnung auszusetzen; ihre Haltung war so zurückhaltend, daß sie schüchtern zu sein schien — aber wenn man sie durch herablassende Mienen zu ermuthigen suchte, wurde sie mehr als zurückhaltend, wurde sie kalt und schweigsam.
Ihr Benehmen gegen Personen, die ihr eine gegründete Achtung einflößten, war ausgezeichnet, das heißt sie war zuvorkommend und liebenswürdig; aber von Natur war sie lustig, neckisch, rührig und vor Allem dem Zwange feind. Große Diners, lange Abendgesellschaften, gewöhnliche Besuche, Bälle sogar waren ihr verhaßt. Sie war für die Häuslichkeit geschaffen, oder für einen raschen, heitern Spaziergang. Aber im Hause und bei ihren Streifereien bedurfte sie der Vertraulichkeit, der Unbefangenheit, eines vollständig zwanglosen Umganges und der gänzlichen Freiheit in ihren Gewohnheiten und im Gebrauch ihrer Zeit. Sie lebte daher immer zurückgezogen und ließ es sich viel angelegener sein, genante Bekanntschaften zu vermeiden, als vortheilhafte Bekanntschaften aufzusuchen. Das war auch ganz die Sinnesart meines Vaters, und in dieser Beziehung konnte nie ein Ehepaar besser harmoniren. Glücklich fühlten sie sich nur in ihrer kleinen Häuslichkeit; an allen andern Orten mußten sie ein melancholisches Gähnen unterdrücken, und sie haben auch mir diese geheime Sauvagerie vererbt, welche mir die Gesellschaft unerträglich und das „Daheim“ nothwendig macht.
Alle Schritte meines Vaters — die freilich mit einiger Nachlässigkeit gethan wurden— führten zu nichts. Er hatte nur zu sehr recht, als er sagte: daß er nicht dazu gemacht wäre, seine Sporen in Friedenszeiten zu verdienen, und daß ihm die Kämpfe in den Vorzimmern keine Erfolge gewährten. Der Krieg allein konnte ihn aus der Sackgasse des Generalstabes erlösen.
Er kehrte mit Dupont in das Lager von Montreuil zurück. Meine Mutter folgte ihm im Frühling 1805, brachte aber nur zwei oder drei Monate daselbst zu. Während dieser Zeit übernahm meine Tante Lucie die Sorge für meine Schwester und mich. Diese Schwester, auf deren Dasein ich schon hingedeutet habe, und von welcher ich später mehr erzählen werde, war nicht das Kind meines Vaters. Sie war fünf bis sechs Jahr älter als ich und hieß Caroline. Zu derselben Zeit, als sich meine Mutter mit meinem Vater vermählte, hatte meine gute Tante Lucie Herrn Maréchal, einen pensionirten Offizier geheirathet. Fünf oder sechs Monate nach meiner Geburt wurde ihnen eine Tochter geschenkt, meine theure Clotilde, die beste Freundin vielleicht, die ich jemals gehabt habe. Meine Tante wohnte damals in Chaillot, wo mein Onkel ein kleines Haus gekauft hatte, das zu jener Zeit im freien Felde stand und jetzt zur Stadt gehört. Um uns spazieren zu führen, miethete meine Tante den Esel eines benachbarten Gärtners; wir wurden auf Heu in die Körbe gesetzt, die zum Transport der Flüchte und Gemüse bestimmt waren; in dem einen Korbe befand sich Caroline, in dem andern waren Clotilde und ich und es scheint, als hätte uns diese Art von Bewegung sehr gefallen.
Während dieser Zeit begab sich der Kaiser Napoleon, der sich mit andern Dingen und andern Spazierfahrten beschäftigte, nach Italien, um sein Haupt mit der eisernen Krone zu schmücken. Guai a chi la tocca! hatte der große Mann gesagt. England, Oestreich und Rußland entschlossen sich danach zu langen und der Kaiser hielt sein Wort.
Im Augenblicke, als die Armee, die am Ufer des Kanals vereinigt war, mit Ungeduld das Signal zu der Ueberfahrt nach England erwartete, änderte der Kaiser, der sein Glück auf dem Meere gefährdet sah, alle seine Pläne in einer Nacht. In einer jener eingebungsvollen Nächte, wo das Fieber in seinen Adern nachließ, verzichtete er auf ein übermächtiges Unternehmen, um ein neues Project in seinem Geiste entstehen zu lassen.