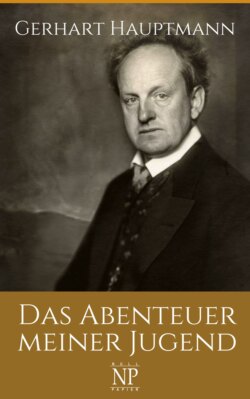Читать книгу Das Abenteuer meiner Jugend - Gerhart Hauptmann - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Achtzehntes Kapitel
ОглавлениеAm 13. Juli 1870 reiste mein Vater für einen Tag nach Dominium Lohnig und nahm mich mit. Aus welchem Grunde er diesen für ihn ungewöhnlichen Besuch machte, weiß ich nicht. Das Verhältnis zwischen ihm und Onkel Gustav Schubert war achtungsvoll, aber man hatte sich nicht sehr viel zu sagen. Grade darum muss die Ursache von Bedeutung gewesen sein.
Die langen Gespräche zwischen Vater und Onkel hinter verschlossenen Türen, die kurz bemessene Frist des Aufenthalts und der Ernst, der auch beim Abendessen nicht aus den Mienen der Männer wich, ließen die alte Spielfreude zwischen Vetter Georg und mir diesmal nicht aufkommen. Morgens darauf brachte uns Onkel in der üblichen Landkutsche nach Striegau zur Bahn, eine Fahrt, die mehrere Stunden verlangte. Ich weiß nicht, wer es war, der uns in einer gleichen Kutsche entgegenkam, sie halten ließ und uns zuwinkte.
Das Dumpfe, das über der ganzen Reise gelegen hatte, löste, wie Gewitterschwüle ein erster Blitz, die Nachricht, die der Winkende mitbrachte. »Meine Herren«, rief er, »wir haben den Krieg! Gestern hat König Wilhelm in Bad Ems den Gesandten Napoleons, der ihn wie einen Lakaien Frankreichs behandeln wollte, einfach auf die Straße geworfen. Die gesamte norddeutsche Armee mobilisiert, auch die süddeutschen Fürsten machen mit, Bayern, Baden, Württemberg. Es braust ein Ruf wie Donnerhall!«
Mein Vater und Onkel Schubert waren bleich geworden.
Damals stand ich noch vor Vollendung des achten Lebensjahres, aber es war nicht schwer zu begreifen, dass sich etwas ganz Ungeheures, Grundstürzendes ereignen sollte. Und nun wurde im Weiterfahren zum ersten Mal zwischen Vater und Onkel der Name Bismarck laut, ein Name, den mein Bewusstsein bis dahin nicht registriert hatte. »Bismarck,« sagte der Onkel, »stürzt uns in ein sehr schlimmes und sehr gefährliches Abenteuer hinein. Der Allmächtige sei uns gnädig! Weder sind wir gerüstet genug, aber wenn wir es wirklich wären, wie wollen wir den überlegenen Waffen und Massen Frankreichs widerstehen?«
Dem weichen und gütigen Onkel Gustav Schubert gegenüber schien mein Vater ein ebenso sanftes und wiederum gänzlich verändertes Wesen zu sein, aber er wollte doch nicht in die Verzagtheit des lieben Verwandten einstimmen. Mit ruhigen und bestimmten Worten trat er für Bismarck und seine Haltung ein: er habe immer gewusst, was er wolle, und es immer zum guten Ende geführt. Er nannte dann Moltke, Roon, Vogel von Falckenstein und erklärte, wenn wirklich Bayern, Württemberg, Baden und Sachsen mitgingen, hätte der Sieg eine große Wahrscheinlichkeit.
*
Man schrieb den 25. November 1870, als der Brunneninspektor Ferdinand Straehler, mein Großvater, starb. Die Depeschen König Wilhelms, die Nachrichten glänzender Siege und wieder Siege waren noch an sein Ohr geschlagen: die Erstürmung von Weißenburg, die der Spicherer Höhen, die Siege bei Wörth, Gravelotte und St. Privat, schließlich die Kapitulation von Sedan.
Das bedeutete die Heraufkunft einer neuen Zeit. Er stand vor dem Abschluss einer alten, die zugleich mit dem seines Lebens vollendet war.
Einigermaßen feierlich pilgerte ich mit meiner Mutter in das Sterbehaus. Tante Gustel und Tante Liesel hatten verweinte Augen. Schweigend begaben wir uns in ein hinteres Zimmer des Dachrödenshofs, das nach meiner Erinnerung nur durch ein Guckloch oben in der Wand Licht erhielt. Es war Ende November, aber ein sonnenheiterer, frischer Tag.
Etwas unter einem leinenen Bettuch Verborgenes hatte für mich eine schauerliche Anziehungskraft. Man deckte es ab, und ich sah eine mir zunächst unverständliche Masse, die langsam durch einen Fuß, durch eine gelbe runzlige Hand, durch etwas Haupthaar und Ohr als menschliche Form zu erkennen war. Es waren die irdischen Reste meines Großvaters.
Man hatte den Toten mit großen Blöcken Eises umlegt. Ich war nicht gerührt. Hätte meine Empfindung Ausdruck gefunden, vielleicht würde es durch ein befremdetes Kopfschütteln geschehen sein. Ich war wirklich ganz ein befremdetes Kopfschütteln.
Die tote Masse, die da lag, zwischen Eisstücken – konnte sie mein Großvater sein und gewesen sein? Das war er gewesen, er, dessen stolze Gleichgültigkeit mich verletzt, dessen ganze Erscheinung mir aber doch Ehrfurcht erweckt hatte? Also das war unser aller Los! Man hatte wohl Grund, sich das gegenwärtig zu halten.
*
Die Stunden darauf vereinigten äußerste Aktivität im Spiel und verschwiegene Meditationen, wie denn vielleicht überhaupt Träumerei und Aktivität vielfach verbunden sind.
Es gab einen rötlich gestrichenen hohen Karren mit zwei Rädern in unserm Hof. Ich bespannte ihn mit etwa acht Jungens zu vier und vier und stand, eine Peitsche schwingend, darauf. Ein Wirrsal von Zuckerschnüren ersetzte die Zügel. So rasten wir polternd über die Dorfstraße, rasten in den Posthof hinein, wo die Rosskastanien mit dem Gold ihrer Blätter den Boden verdeckt hatten und braune Früchte in Menge herumlagen. Dort beluden wir, von Sonnenschein und Herbstfrische belebt, unsern Karren mit Laub, um ich weiß nicht was damit auszurichten. Und nun rasten wir wieder dorthin, wo wir herkamen. Äußerlich war es für mich ein herrlicher Rausch. Im Innern jedoch hatte sich eine ungesuchte Erkenntnis wie ein Pfeil eingebohrt, ein Zustand, der sich nicht ändern konnte. Den Pfeil zu entfernen, die Wunde zu heilen, gab es keine Möglichkeit.
Eigentlich zum ersten Mal hatte ich den Gedanken des unabwendbaren Todes mit mir selbst in Verbindung gebracht. Du entrinnst, stelle dich, wie du willst, so sprach eine Stimme in mir, dem Ende deines hochmögenden Großvaters nicht: er reichte einer Zarin den Mundbecher, aber das rettete ihn keineswegs vor dem Schicksal, das eben das allgemeine ist. Schiebe es noch so lange hinaus, suche es noch so sehr zu vergessen, lenke dich tausendfältig in die Fülle und den Reichtum des Lebens ab: eines Tages wird es auch dir unabwendbare Gegenwart. Du kannst es keinem anderen zuschieben, du musst dabeisein, du ganz persönlich. Und wenn du auch hundert Jahre alt würdest, geht es am Ende nicht ohne dich. Du wirst atmen, leben und leben wollen wie jetzt, dann wird es heißen: leg weg, was du in Händen hast, ein Stück Brot, eine Handvoll Zuckerschnüre, oder was es auch immer sei, es ist aus, du musst fort – musst sterben. Und das Sterben wie das Leben wirst du hinnehmen müssen als Gegenwart.
An meinem letzten Geburtstag, den ich vor wenigen Tagen gefeiert hatte, standen acht brennende Jahreslichter um den obligaten Streuselkuchen herum. Alles in diesen Blättern Erzählte lag hinter mir, ja unendlich viel mehr, was einigermaßen erschöpfend mitzuteilen Menschenkraft übersteigen würde. Durch fünf von diesen acht Jahren war ich gleichsam mit fliegendem Haar hindurchgestürmt, hatte gelacht, geweint, gerast, gelitten, gekämpft, und was noch sonst. Aber über alles siegte der innere, fließende Strom von Lebenslust. Unbequemes und Unangenehmes wurde mit einer Bewegung ähnlich der eines Fohlens, wenn es, die Mähne um sich werfend, eigensinnig davongaloppiert, abgeschüttelt.
Nun aber, seit Großvaters Tode, gelang dies mitunter so ganz nicht mehr.
*
Wenn sich meine Mutter im Sommer nach den Strapazen in der glühenden und lärmenden Hotelküche, nachdem einige hundert Menschen abgefüttert waren, todmüde in ihr Schlafzimmer geflüchtet hatte und, schwer aufseufzend und halblaut gegen alles und alles protestierend, auf dem Bett lag, ließ ich mir von ihr ängstlich bestätigen, dass sie doch nicht etwa sterben werde. Eine solche Befürchtung lag gar nicht so fern. »Gerhart, ich bin so lebensmüde!« war ja immer wieder ihr Stoßseufzer. Allerlei, wie ich fühlte, nagte an ihr. Es entdeckte sich nicht nur in den mancherlei Klagen, besonders im Sommer über Hitze, Arbeitsüberhäufung, Küchenärger, Hotelbetrieb.
In Wahrheit stand eine unsichtbare Mauer zwischen dem Gasthof zur Preußischen Krone und dem benachbarten Dachrödenshof, ihrem Elternhaus. Die Heirat mit meinem Vater war dort schließlich verziehen, aber niemals gebilligt worden. Da meine Mutter nun keineswegs in dem erwarteten Sinne glücklich geworden war, ging ein Zwiespalt durch ihre Seele.
Ich ahnte das alles in manchem drückenden Augenblick, wenn ich in Mutters Nähe weilte, aber dann tat ich eben wieder dem Fohlen gleich und galoppierte davon, ins Freie.
Die wirtschaftlichste unter den Töchtern des Brunneninspektors war meine Mutter. Heut weiß ich, dass sie auch die klügste gewesen ist. Rein äußerlich wäre vielleicht eine größere Harmonie erzielt worden, wenn die geniale und sehnige Tante Julie mit ihren gesellschaftlichen Talenten in den Gasthof, meine Mutter in das Dominium Lohnig eingeheiratet hätte. Auf einem Gutshof, sagte sie immer, sei ihr wahres Wirkungsfeld. Auch ist es ein Gutsbesitzer in Quolsdorf gewesen, dem sie um meines Vaters willen einen Korb gegeben hat.
Nicht beim Tode des Brunneninspektors, aber bei Verteilung der Erbmasse brachen alle verharschten Wunden in den Seelen meiner Eltern wiederum auf.
*
Mich mit den Angelegenheiten der Erwachsenen ernstlich zu beschäftigen, bestand bisher keine Notwendigkeit. Es war selbstverständlich, dass meine Eltern, menschliche Götter, in jeder Beziehung für mich sorgten. Zweifel an der gesicherten Macht und Kraft, aus der sie es taten und tun mussten, bestanden nicht. Auf dem Wege von Lohnig nach Striegau, in der Landkutsche, ging mir zum ersten Mal meine Verbundenheit mit einer großen Volksgemeinschaft auf, von deren Wohl und Wehe mein eigenes nicht zu trennen war. Und mehr als das: nämlich so weit verbreitet, so zahlreich, so stark und wehrhaft diese Volksgemeinschaft war, sie war verletzlich, sie konnte in Frage gestellt, ja zerstört werden.
Die gewohnheitsmäßigen, fortlaufenden Knabensorgen störten mich nicht, sie gehörten zu meiner Persönlichkeit. Nun aber wurde ich in die allgemeine Sorge um Volk und Vaterland hineingezogen, und etwas mir bisher ganz Fernes und Fremdes belastete mich.
Diese befremdlichen Düsternisse im Raume meines Gemüts wurden bald vom Fanfarengeschmetter der Siege aufgelöst. Feuerwerke, Raketen, Leuchtkugeln, Sonnen stiegen immerwährend, sogar am hellichten Tage, empor, als gälte es, der natürlichen Sonne am Himmel den Rang abzulaufen.
Jetzt aber, nach dem Tode des Großvaters, erwies sich ein anderer Boden, dessen unantastbare Festigkeit ich als selbstverständlich vorausgesetzt hatte, als nicht ganz so fest und nicht ganz so tragfähig. Und ich sah mich abermals gezwungen, fremde Angelegenheiten, solche erwachsener Menschen, meiner eigenen Eltern sogar, in gewissem Betracht zu den meinen zu machen.
Vom Begräbnis des Großvaters weiß ich nichts, verständigermaßen wurde ich ganz und gar davon ferngehalten. Auch weinte sich meine Mutter nicht vor uns Kindern aus. Dann kam die Eröffnung des Testaments, von der wir erfuhren und über die wir Geschwister uns allerlei spannende Dinge zutuschelten. Wir fühlten bald, dass zugleich zwischen Vater und Mutter eine Spannung eingetreten war, die sich bei meinem Vater als Zurückhaltung, ja als Kälte äußerte. Er verabscheute Heuchelei. Die Trauer aber um den alten, steifen, unversöhnlichen Schwiegervater kann bei ihm nicht sehr tief gewesen sein.
*
Der Eröffnung des Testaments beizuwohnen, hatte mein Vater, wie ich im Nebenzimmer hören konnte, erregt und beinahe mit Verachtung abgelehnt, worauf meine Mutter weinend allerlei, was ich nicht verstehen konnte, antwortete. Es fielen Ausdrücke wie Leichenfledderei, die der Krieg populär gemacht hatte. Er treibe sie nicht, so sagte mein Vater, er entwürdige sich nicht durch Leichenfledderei. Kurz, meine Mutter musste allein gehen, da sie doch ihre Interessen nicht unvertreten lassen konnte.
Ich verhielt mich mäuschenstill in der Vier, als die Mutter am späten Nachmittag aus dem Dachrödenshof zurückkehrte und in der Drei auf den Vater traf. Sie hatte ihm, wie sie uns später einmal erzählte, eine Schürze voll Gold im Werte von tausend Talern nicht ohne einige Freude und einigen Stolz mitgebracht. Ich hörte zunächst, wie mein Vater äußerst erregt die Worte »Behaltet euch euren Mammon!« der Mutter entgegenschleuderte, und dann das Fallen, Klingen und Rollen von Geld.
Ich weiß nicht, was meine Mutter, verwundet und verletzt, wie sie sein musste, geantwortet hat, sie muss aber auch bei ihm eine wunde Stelle berührt haben. Vielleicht schob sie ihm unter, dass ihm die Summe zu gering wäre.
Jedenfalls brach die Entrüstung meines Vaters ungehemmt und in einer nie gehörten Weise aus, die mich zittern machte. Man fühlte, wie sich jahrzehntelang verletzter Stolz aufbäumte und in Machtlosigkeit der Empörung überschlug. Eine unüberbrückbare Kluft zwischen meiner Mutter und meinem Vater tat sich auf, von deren Vorhandensein in meine glückliche Daseinsform kaum der Schatten einer Vermutung gefallen war. Das Ganze war in einer langen Reihe von Punkten eine Anklage gegen die Familie meiner Mutter. Hauptsächlich warf er ihr Hochmut, Dünkel in jeder Form, Herzenskälte und was nicht noch alles vor. Am Ende des sich furchtbar steigernden Wortwechsels brach meine Mutter wieder in Tränen aus. Weinend warf sie dem Vater vor, er habe ihr vor der Hochzeit fest versprochen, den Gasthof zur Krone binnen höchstens zwei Jahren zu verkaufen. Er habe dieses Versprechen nicht eingelöst und sie diesem Moloch geopfert. Sie hasse das Haus, sie verfluche das Haus. Sie habe ihren Abscheu vor dem ganzen Gasthauswesen klar und deutlich ohne jeden Rückhalt ihm immer und lange vor der Ehe zum Ausdruck gebracht. Sie habe es sich aber lange nicht schlimm genug gedacht, es sei alles noch sehr viel schlimmer gekommen. Es habe ihre Liebe zerstört, ihre Ehe zerstört. Das wolle heißen: ihr Glück zerstört. »Oder«, fuhr sie dann immer weinend fort, »willst du behaupten, dass ein Familienleben in diesem Marterkasten möglich ist? Im Sommer stecke ich die Nase nicht aus der Küche heraus; sehe ich dich oder höre ich dich, ist es höchstens, wenn du mich oder jemand anders runterkanzelst. Du machst im Büro oder Salon den vornehmen Mann, und ich, angezogen wie eine Schlumpe, schäle in der Küche Kartoffeln oder pelle Schoten aus. Und wenn ich auf Ordnung halten will und die Leute, voran der Chef, mich angrobsen, gibst du nicht mir, sondern ihnen recht. Du speisest im Saal, Gerhart und Carl kriegen ihre Teller voll Essen in der Büfettstube. Ich sehe den ganzen Sommer keinen gedeckten Tisch« – meine Schwester Johanna war damals in einem Pensionat, mein Bruder Georg in Bunzlau auf der Realschule – »und im Winter ist es wie eben jetzt. Man hat sich den Sommer hindurch nicht einen Augenblick Ruhe gegönnt, bei dreißig Grad Hitze unter dem Glasdach der Küche halb tot geschunden, damit man im Winter schlaflose Nächte in Sorgen und Ängsten hat. Du sitzt mit Gustav im Büro, ihr schreibt, ihr rechnet, ihr rechnet und schreibt, und wenn ihr noch so sehr rechnet und schreibt, ihr rechnet und schreibt die Schulden, die uns drücken, nicht weg und könnt die fälligen Zinsen nicht aufbringen. Dann nimmst du verstimmt mit mir und den Kindern dein bisschen Abendbrot und gehst mit Gustav in die Schenkstube. Du brauchst Zerstreuung, wie du sagst, ich bleibe allein in dem großen, zugigen, kalten Haus und mag sehen, wie ich mich mit meinen Gedanken, meinen Sorgen, meinen berechtigten Zukunftsängsten abfinde. Wenn du mich wenigstens einweihtest, aber du schweigst, du sagst mir nichts. Ich will deine Sorgen mit dir tragen, das Leben würde für mich viel leichter sein.«
Ich könnte von diesen Dingen nicht mehr sprechen, wie ich es heute kann, wenn ich sie damals nicht registriert hätte. Wie alt ein achtjähriger Knabe sein kann, ahnen im Allgemeinen erwachsene Menschen nicht. Was mich zunächst am tiefsten überraschte und schmerzte, war das Verhältnis der Mutter zu dem Hause, ohne das ich mich und die Welt nicht zu denken vermochte. Diese schönen Säle, Bilder und Zimmer, diese rätselhaften Kammern unterm Dach, diese Treppen, Korridore und tausendfältigen Schlupfwinkel, die Welt Unterm Saal, der hallende Tunnel, der von dort in den Hintergarten ging, die bemoosten Dächer, der Taubenschlag: der geradezu einzigartige, unübertreffliche Schauplatz meines Werdens, meiner Spiele, meines Lebens überhaupt sollte in Wahrheit ein wohl auch kinderfressender, glühender Moloch sein, der das Lebensglück meiner Mutter vernichtet hatte? Meine Mutter selber behauptete das.
Ihr das zu glauben, ihren unbegreiflichen Irrtum, ihre Blindheit diesem Paradiese gegenüber auch nur zu entschuldigen, war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Und so stand ich auf Vaters Seite, als er sagte, dass nun einmal sein seliger Vater ihm dies Haus hinterlassen habe und er, selbst die Pietät gegen den mühsam errungenen Besitz seiner Eltern beiseitegesetzt, es keinesfalls gegen ein Butterbrot verschleudern könne.
Die peinliche Auseinandersetzung und ihre leidenschaftliche Maßlosigkeit kamen einem lokalen Erdbeben gleich, das den familiären Boden erschütterte. Niemals erlangte er mehr seine alte Festigkeit.
Mit diesen Erfahrungen war die Erkenntnis verknüpft, dass die selbstverständlichen Voraussetzungen meines bisherigen Daseins nicht durchaus standhielten. Mir gingen bestimmte Sätze und Worte meiner Mutter immer aufs neue durch den Sinn: »Du sitzt mit Gustav im Büro, ihr schreibt, ihr rechnet, ihr rechnet und schreibt, und wenn ihr noch so sehr rechnet und schreibt, ihr rechnet und schreibt die Schulden, die uns drücken, nicht weg und könnt die fälligen Zinsen nicht aufbringen.«
Auch meinen Geschwistern waren die schweren Krisen zwischen Vater und Mutter nicht verborgen geblieben. Seltsamerweise nahmen wir für den Vater und gegen den Dachrödenshof Partei. Aus dem erregten Gemunkel von Johanna und Carl und gelegentlich hingeworfenen Worten der Mutter ging mir nach und nach, gegen mein Widerstreben, auf, dass noch andere Menschen als wir Eigentumsrechte auf den Gasthof zur Krone hatten, was mich aufs schmerzlichste traf und entrüstete.