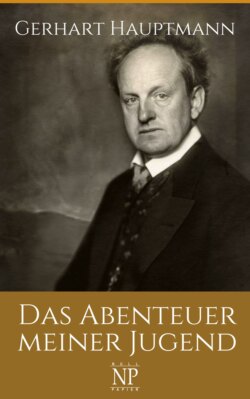Читать книгу Das Abenteuer meiner Jugend - Gerhart Hauptmann - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Dreiundzwanzigstes Kapitel
ОглавлениеDie Familie feierte in diesem Jahr ein sehr anspruchsloses Weihnachtsfest, das mir allerdings eine Dreiviertelgeige als Geschenk brachte. Ich hatte mir eingeredet, es schlummre in mir vielleicht ein Musiker. Allein der Grund, weshalb ich mir eine Geige gewünscht hatte, war nicht der. Durch zwei Umstände ist er wahrscheinlich gelegt worden. Meinem Vater war eine Geige gestohlen worden, die er von seinem Großvater überkommen hatte, einem Weber und Dorfmusikus, der als solcher auch im Kirchendienst der Stadt Hirschberg mitwirkte. Die Geige in ihrem Kasten hatte im Großen Saale der Krone gestanden, Einbrecher hatten zur Winterzeit die Scheiben der großen Glastüren eingedrückt und die Geige vielleicht nur deshalb geraubt, weil der glänzende Messingbeschlag des Kastens sie anlockte. Es mag ein gutes, altes Tiroler Instrument gewesen sein, beileibe kein Stradivarius, aber die Pietät, die mein Vater dafür besaß, ferner die Fantasie von uns Kindern und schließlich die unbegrenzten Möglichkeiten, die bei alten Geigen gegeben sind, machten sie am Ende dazu.
Diese Geige lag mir im Sinn und desgleichen der musikalische Urgroßvater. Und überdies lebte in Salzbrunn Doktor Oliviero, ein vielbeschäftigter praktischer Arzt, der ausgebildeter Geiger war und seine berufsfreien Stunden der Geigenkunst widmete. Während des Kursaalwinters entstand das fantastische Gerücht, dass er wegen einer Geige in Unterhandlungen stehe, die fünf-, sechs- oder achttausend Taler kosten solle. Es war ein begründetes Gerücht, die Geige gelangte in seine Hände.
Irgendwie hatte sich im Anschluss an diese Umstände eine fanatische Geigensehnsucht in mir festgesetzt. Es kam wohl auch Eitelkeit dazu, Eindrücke der Gepflogenheiten des eleganten Kapellmeisters von der Kurkapelle. Wenn diese, wie öfters, Straußsche Walzer spielte, nahm er die Geige selbst in die Hand, um die Spieler zu höherem Schwunge fortzureißen.
So zog mein Vater denn Doktor Oliviero zu Rat, als mein Wunsch immer brennender wurde. Man möge mir, sagte der Doktor, ruhig willfahren, man bekomme ja schon für einige Taler ein für den Anfang genügendes Instrument, und was solle ein Versuch, geigen zu lernen, dem Knaben schaden? Und schließlich bot Oliviero sich an, mich, selbstverständlich ohne Entgelt, zu unterweisen.
Worauf denn auch wirklich der Unterricht nach Neujahr begann.
Doktor Oliviero hatte die gepflegteste und behaglichste Häuslichkeit. In den Zimmern hörte man keinen Tritt, weil die Fußböden mit einer dünnen Schicht Stroh überdeckt und mit Teppichen überspannt waren. Das Ehepaar Oliviero war kinderlos. Er, ein nicht großer Mann mit einem beethovenähnlichen, aber gelassen-gütigen Musikerkopf, sie, eine stattliche, schöne Frau, die erheblich jünger als er sein musste. Ich fühlte mich wohl in diesem Hause, dessen Kultur eine in Salzbrunn ungewöhnliche war und in dem ich mit einem stillen Gleichmaß von Güte behandelt wurde.
Doktor Oliviero ging während der Unterrichtsstunde, immer mit ausgesuchtester Akkuratesse gekleidet, die Geige an der Schulter, mit bequemen Schritten hin und her, jede Pause meiner jämmerlichen Kratzerei benutzend, um sich mit Läufen, Trillern, Doppelgriffen, Oktavgängen und Flageoletts schadlos zu halten.
Mitunter blickte oder trat die schöne Arztfrau herein, an vornehmer Haltung und Kleidung ein Typ, nach dem man heut im Hause eines Landarztes ebensolange wie damals suchen müsste. Manchmal erhielt ich dann eine Süßigkeit, oder es wurde uns, wenn es draußen sehr kalt war, in den stets überheizten Zimmern Tee serviert. Man spürte in allem, Tapeten, Möbeln, Bildern und Vorhängen, eine besondere Wohlhabenheit, die in der Tat hier zugrunde lag und nicht aus der Bergmanns-Praxis stammte.
Nie übrigens sah man Doktor Oliviero in irgendeiner Gaststube noch in der Restauration irgendeines Hotels oder gar seine Frau und ihn bei winterlichen Ressourcebällen oder den sommerlichen Soireen für Badegäste. Fürstlich privilegierter Badearzt war Doktor Oliviero nicht.
*
Eine Drei-Kaiser-Zusammenkunft stand vor der Tür. Bismarck hatte sie im Interesse des Friedens – der Sieger will immer den Frieden! – angeregt. Alexander II. von Russland, Franz Joseph von Österreich und Wilhelm I. einigten sich zur Aufrechterhaltung des Friedens und des Status quo. Kurz, alles traf alle möglichen Anstalten, um dem neuen Reich und der neuen Welt eine Friedensepoche zu gewährleisten, in der sich ein friedlicher Wettstreit, dessen Kräfte wie ungeduldige Rosse in den Gebissen schäumten, grenzenlos entfalten konnte und sollte.
In diese erwartungsvolle, von nah erfüllbaren Hoffnungen aller Art gesättigte, freudigerregte Epoche fiel plötzlich und gänzlich unerwartet der kalte, finstere Schatten des Thanatos. Ich weiß nicht, wo zuerst: in Deutschland waren die Schwarzen Pocken, war die Schwarze Pest ausgebrochen und raffte, durch ärztliche Kunst nicht aufzuhalten, aber und aber tausende Menschen hinweg. Endlich fiel auch in Salzbrunn der erste Schlag. Man hörte am ersten Tage von einem, von zwei, von drei Fällen im Niederdorf, die schon am zweiten, mit zehn anderen, tödlich endeten, während am dritten Tage die Zahl der Toten auf zwanzig, am vierten auf dreißig, vierzig stieg, Opfer, von denen uns die meisten bekannt waren. Man schloss die Schulen, und wir Kinder durften nur unter Wahrung strengster Vorsichtsmaßregeln aus dem Haus.
War ich nun eigentlich angst- und furchtgequält oder sonst tiefer bewegt, als die unsichtbare Hand immer mehr Leute aus dem Leben riss, fast in jede bekannte Familie griff und sich dem Oberdorf und dem Kursaal bedrohlich annäherte?
Soweit war ich durchaus noch Kind, dass ich die Schließung der Schule als einen Glücksfall begrüßte.
So hafteten auch keineswegs die Warnungen meiner Eltern und des Doktors Straehler vor möglicher Ansteckung: war ich wie immer dem Hause entsprungen, so hatte ich an sie keine Erinnerung. Ich schlug die strengen Gebote, keinen Menschen zu sprechen, noch gar zu berühren, beileibe kein Haus zu betreten, nicht eigentlich in den Wind, sondern dachte immer erst dann an sie, wenn ich dies alles nach alter Gewohnheit getan hatte. Doktor Straehler riet davon ab, mich einzusperren, da ich, an freies Herumtollen doch gewöhnt, durch Stubenarrest am Ende noch ärger gefährdet würde.
Ich tummelte mich im Dorf umher und betrat denn auch Zimmer, in denen Leute zu Bett lagen. War es ein Pockenkranker oder nicht, an den ich in einem modrigen Gartengelass durch irgendeinen Zufall geriet? Jedenfalls ist ein Eindruck damit verknüpft, der sich mir ins Gemüt ätzte. Im gleichen Zimmer befand sich ein wenig bekleidetes, schlumpiges Weib. »Wasser!« flehte der Kranke sie an. – »Wasser?!« schrie sie, »hol dir doch Wasser!« – »Ich kann nicht, ich bin zu schwach«, sagte er. – »Faul bist du, du bist faul!« war die Antwort. – »Merkst du denn nicht, wie es mit mir steht? Ich bin hin. Ich werde von diesem Bett nicht mehr aufstehen.« – »Dann bleibe doch liegen, Lumpenhund!« – »Frau«, klang es zurück, »denk daran, dass es eine Gerechtigkeit auf Erden, und wenn nicht auf Erden, dann im Himmel gibt. Du sollst die Strafen Gottes nicht so herausfordern!« – Sie brach in ein hässliches, wildes Lachen aus. »Du redest von Strafen Gottes, du Schuft, gehörst du nicht zehnmal an den Galgen?!« – »Wasser!« flehte aufs neue der Kranke. »Reich mir doch mal die Medizin!« – »Hol dir das Wasser, nimm dir die Medizin!« – »O Gott, wenn es doch endlich schon aus wäre!« – »Ich mache drei Kreuze: ja, wenn es doch aus wäre! Wenn es doch aus wäre! Ich spränge ellenhoch in die Luft! Ein Faulenzer weniger auf der Welt, eine schlechte Lumpencanaille weniger!«
Ich verschloss diese schreckliche Offenbarung in mein Knabengemüt, wo ich manche ähnliche Mitgift in meinem späteren Leben entdeckt habe.
Hatte ich die Schließung der Brendel-Schule als den Beginn einer freien Ferienzeit begrüßt, bald sollte ich mich nach ihr zurücksehnen. Denn wieder hatte die Pädagogik meines Vaters eingesetzt. Heiter durchgreifend aber war sie diesmal nicht, sondern auf einfache Weise zwar, aber auch auf überaus strenge durchgreifend. Vater machte mir höchst persönlich am Fenster des Billardzimmers einen Tisch zurecht, gab mir einen von seinen dutzendweise vorrätig gehaltenen neuen Federhaltern, mit einer englischen Stahlfeder frisch versehen, und stellte ein entkorktes sauberes Tintenfläschchen vor mich hin; köstliche weiße Quartbogen wurden von uns beiden zusammengeheftet, ich erhielt Bleistift und Lineal und musste sie unter seiner Anleitung liniieren.
Von da ab hatte ich nichts zu tun, als die vor mir aufgeschlagene »Weltgeschichte für das deutsche Volk« von Friedrich Christoph Schlosser abzuschreiben. »Auf diese Weise«, sagte mein Vater, »lernst du lesen, schreiben und Weltgeschichte zu gleicher Zeit.«
So weit wäre dies nun ganz gut gewesen, hätte nicht mein Vater ein tägliches Pensum von mir verlangt, gegen das meine früheren Schulaufgaben einfach nicht in Betracht kamen. Mit zwei bekritzelten und beklecksten Seiten meines Schulheftes erklärte Brendel seine Zufriedenheit, jetzt musste ich sitzen wie angenagelt und wurde nicht eher losgelassen, bis das mir unmöglich Scheinende Wahrheit geworden war und ich sechs bis acht Druckseiten sauber kopiert hatte.