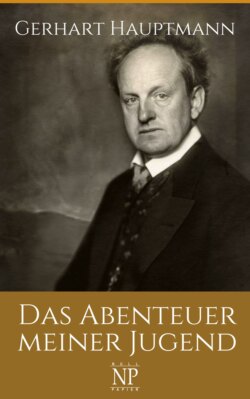Читать книгу Das Abenteuer meiner Jugend - Gerhart Hauptmann - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sechsundzwanzigstes Kapitel
ОглавлениеAnders und tiefer war der Kampf, den meine Mutter damals, durch Jahre, um die Seele der Tochter kämpfte, die ihrer Meinung nach ihre kindliche Pflicht vergaß und in ein fremdes Lager überging.
Wie meine Mutter fühlte und nicht fühlte, lebte sie in einer Art Aschenputtelexistenz. Gram und Kummer deswegen waren vielfach auch mir gegenüber zum Ausdruck gekommen. Sie setzte instinktiv bei Johanna ein ähnliches Fühlen voraus. Vielleicht schwebte ihr von dieser Seite eine Entlastung vor, die sie anderwärts nicht erhoffen konnte.
Johanna ging einen anderen Weg. Obgleich sie, wie mein Vater es nannte, als Siebenmonatskind nur ein kleines Leben war, bestand ein starker Wille in ihr, den auch ich nicht selten zu spüren bekam. Sie schwieg, wo sie anderer Meinung war, verharrte jedoch umso fester auf ihrer. Das Beispiel der Mutter, die in den Sorgen und der Mühsal des Haushaltes ertrunken war, glich einer immerwährenden Warnung, aus Willensschwäche einem ähnlichen Schicksal anheimzufallen. Nein! Eier quirlen, Bouillon abraumen, Knochenbänder durchhauen, Hühner und Fische schlachten, Pfannen reinigen, scharfen Fettdunst einatmen, Bohnen schneiden, Schoten auspahlen, Kirschen entkernen, Strümpfe stricken und Strümpfe stopfen lag meiner Schwester nicht.
Unwiderstehlich fühlte sie sich vielmehr durch die vornehme Geistigkeit des von Randowschen Kreises angezogen, wo man Englisch und Französisch trieb, deutsche Dichter las und am Klavier Mozart, Schubert und Beethoven pflegte.
Die Auseinandersetzungen zwischen meiner Mutter und meiner Schwester, die nicht selten in meiner Gegenwart stattfanden, steigerten sich mitunter zu großer Heftigkeit. Meine Mutter war hierin kurzsichtig. Wäre Johanna ihr gefolgt, wahrscheinlich wäre sie zeitig zugrunde gegangen, denn eine Entwicklung, wie die hier für sie erstrebte, war für sie bei der Zartheit ihrer Anlage Unnatur.
Eine Art Lebenstaumel beherrschte den Badeort, der in dieser Saison den Zustrom von Gästen kaum bewältigen konnte. Während des Trubels inmitten der Julihitze hieß es plötzlich, dass das Fräulein von Randow gestorben sei. Ich schlang gerade wieder einmal mein Mittagessen in der Büfettstube, als mir die Mitteilung gebracht wurde. Im Vorraum kamen und gingen die Kellner und machten mit lauter Stimme ihre Bestellungen. Ich war nicht wenig überrascht, als in meinem abgelegenen öden Raum eine vornehme Dame in tiefer Trauer erschien, die mich nach meinen Eltern fragte. Die Erscheinung war nicht nur wegen der schwarzen Tracht auffällig. Ein blasses, edles Gesicht mit brennenden Augen ward sichtbar, als die Dame den Schleier zurücklegte. Voll Ungeduld ging sie hin und her.
Endlich, als ob sie die Fremde gesucht hätte, trat meine Schwester Johanna ein, entschuldigte die leider unabkömmlich beschäftigten Eltern und entfernte sich mit der Besucherin.
Es sei eine Baronin Maria von Liebig, sagte man mir, eine Freundin von Fräulein Jaschke, die zum Begräbnis von deren Pflegemama eingetroffen war.
Johanna nahm mich mit in den Kurländischen Hof. Hier war das Fräulein aufgebahrt; ein schweres Brokatkleid ist mir erinnerlich, dessen Schleppe man über den Rand des metallenen Sarges bis zur Erde drapiert hatte.
Ich habe vermöge meiner offenen und anschmiegsamen Natur vielen einfachen Leuten, Kutschern, Hausdienern, Dienstmädchen und Kellnern, wie meinesgleichen nahegestanden. Ich hatte mich in diesem Sommer an einen lustigen, liebenswürdigen Sachsen besonders angeschlossen, der als Kellner auch von meinem Vater bevorzugt wurde und sehr tüchtig war. Überraschend hatte sich dieser bis dahin so eifrig tätige Mensch aus dem Dienst entfernt, kam nicht zurück und wurde da und dort in den Kneipen des Orts gesichtet, wo er, ohne grad im Trinken auszuschweifen, seiner Umgebung Reden hielt.
Dieser junge George oder Fritz oder Jean, mit Strohhut, Stöckchen und elegantem Sommerpaletot, stand eines Tages, während ich speiste, vor mir in der Büfettstube. Er schwenkte sein Stöckchen, hob den Hut, wischte mit einem seidenen Taschentuch seine Stirn und fragte mit einer mir an ihm fremden Ungeniertheit: »Sagen Sie, Gerhart, wo ist Ihr Vater?« Ich war erschreckt, denn ich merkte, dass etwas bei ihm nicht in Ordnung war. Als ich zunächst durch Schweigen antwortete, fiel ihm das, wie mir schien, nicht auf. Er pflanzte sich vor den Spiegel und bürstete sorgfältig seinen Scheitel, der tadellos von der Stirn bis zum Nacken ging. Er müsse meinen Vater sprechen, erklärte er, weil er ein Geheimnis entdeckt habe. Er sagte das aber nicht zu mir, sondern führte ein Selbstgespräch, währenddessen er meine Gegenwart, wie ich fühlte, vergessen hatte. »Ich habe ein Geheimnis entdeckt!« war der Schluss, der sich wohl zwanzigmal wiederholte.
Es hieß am gleichen Nachmittag, der arme hübsche Junge sei auf der Promenade einer Generalin buchstäblich aufgehuckt, also auf den Rücken gesprungen, und sei, arretiert, in Tobsucht verfallen. Unheilbar geistesgestört, steckte er wenige Tage später hinter den Gitterstangen einer Irrenanstalt.
Es war das erste Mal, dass ich die Zerstörung eines Geistes aus der Nähe beobachten konnte. Ein mir vertrauter, liebenswerter Mensch erlitt plötzlich lebendigen Leibes den geistigen Tod. Dass etwas dergleichen schon in diesem Leben möglich ist, erschwert die Antwort auf die Frage nach geistiger Unsterblichkeit und macht den Glauben daran beinah unmöglich.
*
Ich befand mich damals im zehnten Jahr, genoss nach wie vor bei Brendel den Schulunterricht, erhielt von Doktor Oliviero in dessen Wohnung Geigenstunde und trieb mich die meiste Zeit in Feld, Wald, Wiese sowie noch immer auf der Kleinen Seite von Ober-, Mittel- und Nieder-Salzbrunn herum. Immer noch spukte die Indianerromantik, Robinson und das Steppenroß. Unter dem alten Birnbaum rührten wir Jungens noch immer die Trommel, machten rechtsum, linksumkehrt unter dem Befehle Grossers, des einstigen Feldwebels, und sangen: »Heil dir im Siegerkranz« – nicht mehr mit dem Schluss »Heil, König …« sondern »Heil, Kaiser, dir!« Im Herbste, als sich der Kurort geleert hatte und der eingesessene Salzbrunner zu sich selber kam, wachten die Kriegervereine auf, Feste wurden gefeiert, patriotische Reden gehalten, und besonders das Pflanzen von Friedenseichen war im Deutschen Reich allgemein. Auch in Ober-Salzbrunn wurde die Wurzel eines Eichenbäumchens nach feierlichem Aufmarsch der Schule und der Kriegsteilnehmer dem Boden anvertraut. Man gedachte dabei der Gefallenen. Durch die berühmte Waldenburger Bergkapelle wurde mezzo-forte »Ich hatt’ einen Kameraden …« intoniert und der Gesang von »Deutschland, Deutschland über alles« begleitet.
*
Diese Zeremonie wurde von mir eine Woche später in Gemeinschaft mit vielen Dorfjungens abermals mit einem besonderen Bäumchen auf einem besonderen Platz ausgeführt. Wir ahmten alles getreulich nach, nur dass wir keine Kapelle hatten. Als wir das Bäumchen gepflanzt und tüchtig begossen hatten, hielt ich mit lauter Stimme die Festrede. Ich sagte: der Krieg sei gut und noch besser der Sieg, am allerbesten aber der Friede. Um seinetwillen werde ja schließlich Krieg geführt – und ich weiß genau, welche wohlige Empfindung heiterer Sicherheit sich dabei um meine Brust legte. Konnten wir damals ahnen, dass eine Friedensepoche fast ohnegleichen, von mehr als vier Jahrzehnten, vor uns und dem deutschen Volke stand?
Beim Pflanzen der Friedenseiche, das versteckt hinter dichten Hecken in einem Garten geschah, sind wir trotzdem belauscht worden. Es hatten sich außerhalb Menschen angesammelt. Als ich meine Rede beschloss, wurde mir von dort aus durch Händeklatschen und Bravorufe der erste Beifall meines Lebens bezeigt.
*
Immer tiefer gerieten wir in den Herbst hinein, und am 15. November brannten zehn Lichter um meinen Geburtstagskuchen. In meinem Gedächtnis ist dieser Tag verzeichnet gleichsam als epochaler Augenblick. Höchstens drei- oder viermal hat es einen solchen gegeben im ersten Vierteljahrhundert meines Daseinskampfs.
Was war es? Was verlieh dem Zehnlichtertag diese Wichtigkeit? Die Frage ist heut nicht mehr leicht zu beantworten. Gewiss ist, sie lag in meinem Geiste, denn hier fand eine bishin unmögliche Art von Einkehr statt. Es war, als wenn ich jetzt erst zum Denken erweckt würde.
Eine Erfahrung, die ich gemacht hatte, war das immer schnellere Entschwinden der Zeit. Ein Tag, der mir früher endlos erschienen war, wurde jetzt, in unendlicher Kette, vom nächsten im Handumdrehen abgelöst. Hatte ich in diesem einen Jahrzehnt meine bodenständige Welt so durch und durch kennengelernt, dass sie mir nichts Neues bieten konnte und etwas wie stumpfe Gleichgültigkeit bei mir herrschend ward, wodurch sich dann der Tag ohne neue Erkenntniswerte schnell und gleichgültig abgehaspelt hätte? Eine gewisse kindlich-selbstverständliche, fast gedankenlose Art der Lebensführung hatte sich in der Tat zum größten Teil ausgelebt.
Eine Art Reue kam mich an, als ob ich eine unendliche Reihe vorüberfliehender Tage nicht genügend benützt hätte; beileibe nicht etwa im Sinne Brendels oder sonst eines Schulmeisters. Ich erkannte vielmehr in dem Geschenk eines Tages, in der Darbietung einer solchen Sonnenfrist eine ungeheure Kostbarkeit. Wollte ich ihren Verlust überhaupt nicht wahrhaben, so erst recht nicht ihre Verschleuderung.
Andrerseits strebte mein innerer Blick plötzlich in die Zukunft hinaus: nicht das Morgen, das Übermorgen, das Weihnachtsfest oder sonst eines im Jahreslauf war mehr sein Ziel, sondern er verlor sich im Unergründlichen. Anhaltspunkte für kosmische oder transzendente Erkenntnis suchte er diesmal nicht, sondern solche, die Aufschlüsse über mein eigenes wartendes Schicksal bringen konnten. Dieser neue, ausdrucksvolle Blick jedoch wurde zugleich von einer Mauer gehemmt, die er zu meiner Pein nicht durchdringen konnte.
Hatte ich dereinst meine Einmaligkeit und damit mein unverbrüchliches Alleinsein erkannt, so sah ich mich heut zum ersten Mal einem neblichten Schicksal gegenübergestellt, das ich allein zu tragen hatte. Wie würde es nach der Enthüllung aussehen? Welche Lasten lud es mir auf?
Das große Fragezeichen blieb fortan vor meiner Seele wie ein Memento aufgerichtet. Dahinter war eine wolkenhafte Finsternis, in welcher Drohungen wetterleuchteten. Gott sei Dank war das Ganze mit einer Himmelsrichtung verknüpft, während die übrigen und die dazwischenliegenden Punkte meines Gesichtskreises frei waren. Durch einen dieser Punkte fand sich ein Radius vom Zentrum hinausgeführt. Er glich einem silbernen Strahl, der sich allerdings auch im Raume verlor, aber gleichsam in einem silbernen Nebel.
Nie eigentlich gab es in unserm Hause private Gesellschaft. Sommers konnte davon nicht die Rede sein, und da meine Mutter sich im Allgemeinen an Kaffeekränzchen und dergleichen nicht beteiligte, fehlte auch im Winter die Veranlassung. Vater und Mutter pflegten im Ort keinerlei Geselligkeit, eher mit Bewusstsein das Gegenteil.
Einmal aber wurden doch die Gemächer des ersten Stockes für den Empfang einer größeren Abendgesellschaft hergerichtet, und zwar die ganze Zimmerflucht. Alles wurde sorgsam durchwärmt. Im ersten Raume stand das Büfett mit Leckerbissen, Gläsern und geöffneten Weinflaschen, im zweiten und dritten waren Esstischchen aufgestellt, das vierte Zimmer aber hatte mein Vater zu einem Lesekabinett ausersehen, wo man allerlei Bücher und Zeitschriften durchblättern konnte, aus den sonst wenig benützten Schätzen seines Bücherschranks: Meyers Universum mit seinen schönen Illustrationen, ein dickes Prachtwerk, das, in Kupferstich reproduziert, einen großen Teil der Schätze des Berliner Museums enthielt, ein französisches Werk mit farbigen Lithografien, »Muses et fées«, und Illustrationen zur Ilias, die in einen deutschen Prosatext des Werkes eingefügt waren.
Selbstverständlich, dass ich vor dem Eintritt der Gäste alle diese Werke eifrig durchmusterte.
Besonders »Muses et fées« mit seinen durch Gazekleidchen lose verhüllten rosigen Mädchenkörpern entzückte mich. Dann kam die Ilias an die Reihe. Als ich lange das Buch durchblättert und Prosastücke entziffert hatte, ging mir jäh wie ein helles Licht der Gedanke auf, man müsste diese Prosa in Verse umwandeln. Wenn du diese Aufgabe lösen könntest, dachte ich – der Ruhm eines großen Dichters würde damit gewonnen sein.
Ich habe damals weder vom Vorhandensein der Ilias noch der Odyssee noch eines Dichters namens Homer gewusst.
Diese Erkenntnis, der Gedanke, die Ilias zu dichten, die, ohne dass ich es wusste, als Dichtung bereits vorhanden war, die damit verknüpfte Hoffnung des Dichterruhms war eben der silberne Strahl, der keine Mauer zu durchdringen brauchte und sich in freier Ferne in einem silbern-lockenden Nebel verlor.
Irgendeinen Versuch, die gefasste Idee zu verwirklichen, habe ich damals nicht unternommen. Keinerlei Überlegung, sondern höchstens ein unbewusstes Wissen meiner knabenhaften Unzulänglichkeit hielt mich davon zurück.
*
Von großer Bedeutung wurde für mich der dicke Band, der Malereien und plastische Bildwerke Berlins, insonderheit seines Museums, wiedergab. Ich habe zu bekennen, dass mich Murillos »Semele hingegeben dem wolkenhaften Zeus« auf eine rätselhafte Weise angezogen hat, gesünder die Amazone von Kiß, jenes plastische Bildwerk, das noch heut auf der Treppenwange des alten Museums zu sehen ist: in Erz gegossen ein bäumender Gaul, ein nacktes Weib zum Speerwurf ausholend, um einen Panther zu durchbohren, der seine Pranken um die Brust des Pferdes geschlagen hat.
Auch das Denkmal Friedrichs des Großen von Rauch mit seinem Gewirre kleiner Figuren erregte mir Bewunderung, und ich setzte als selbstverständlich voraus, dass nur Halbgöttern, nicht gewöhnlichen Menschen, wie wir es waren, Werke wie das von Kiß und das von Rauch gelingen könnten. Es war eine kindliche Annahme, die ich lange belächelt habe. Heute weiß ich, dass sie zu Recht bestand.
Außer diesen plastischen Bildwerken hatte sich mir von irgendwoher die Ariadne von Dannecker eingeprägt, und ich trug sie als eines von drei Wundern der Kunst im Geiste mit mir herum.
Scheinbare Zufälle sind es meist, durch die folgenschwere Wirkungen ausgelöst werden. Hätte mein Vater nicht wider seine Gepflogenheit eine Gesellschaft gegeben und, um sie anzuregen, den Inhalt seines Bücherschranks ausgelegt, so würde ich weder die Konzeption des großen Homerischen Gedichts haben fassen können, noch hätten sich jene berühmten plastischen Kunstwerke in meiner Vorstellungswelt festgesetzt. An ihnen lernte ich die Wahrheit des Satzes kennen, den Demokritos gesprochen hat, wonach die großen Freuden aus der Betrachtung schöner Werke abzuleiten sind. Hatte die von mir entdeckten eine übermenschliche Kraft geschaffen, so erfüllte sie selber in meinen Augen außer- und übermenschliche Wesenheit. Sie wurden mir in sich und an sich Kultbilder, wie es mir die Kreuzabnahme geworden war und die Raffaelische Madonna im Großen Saal.